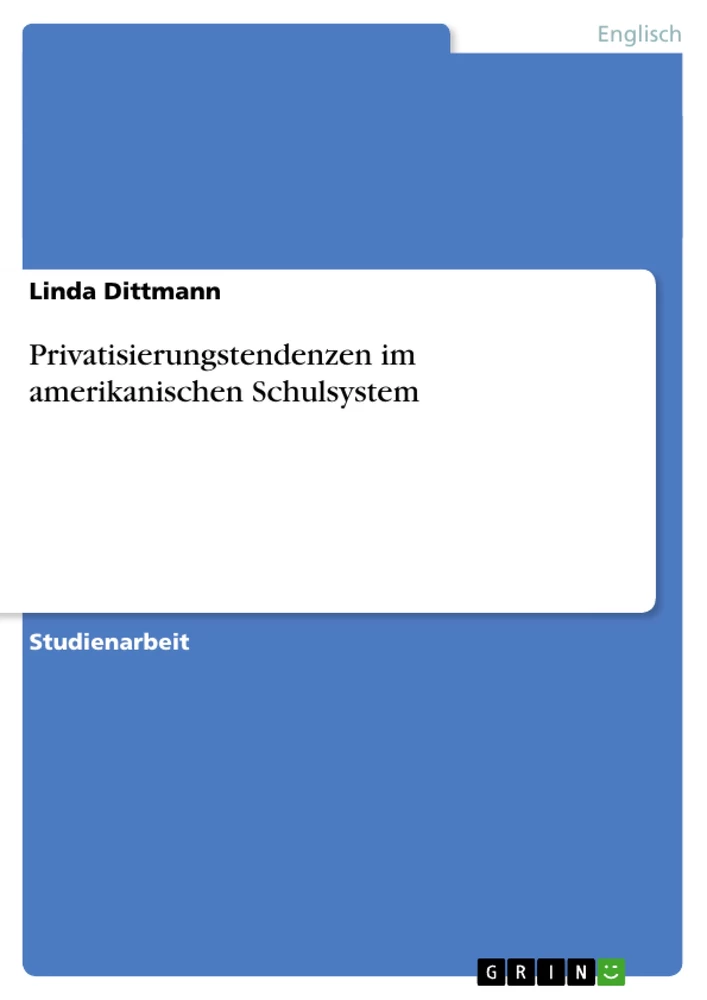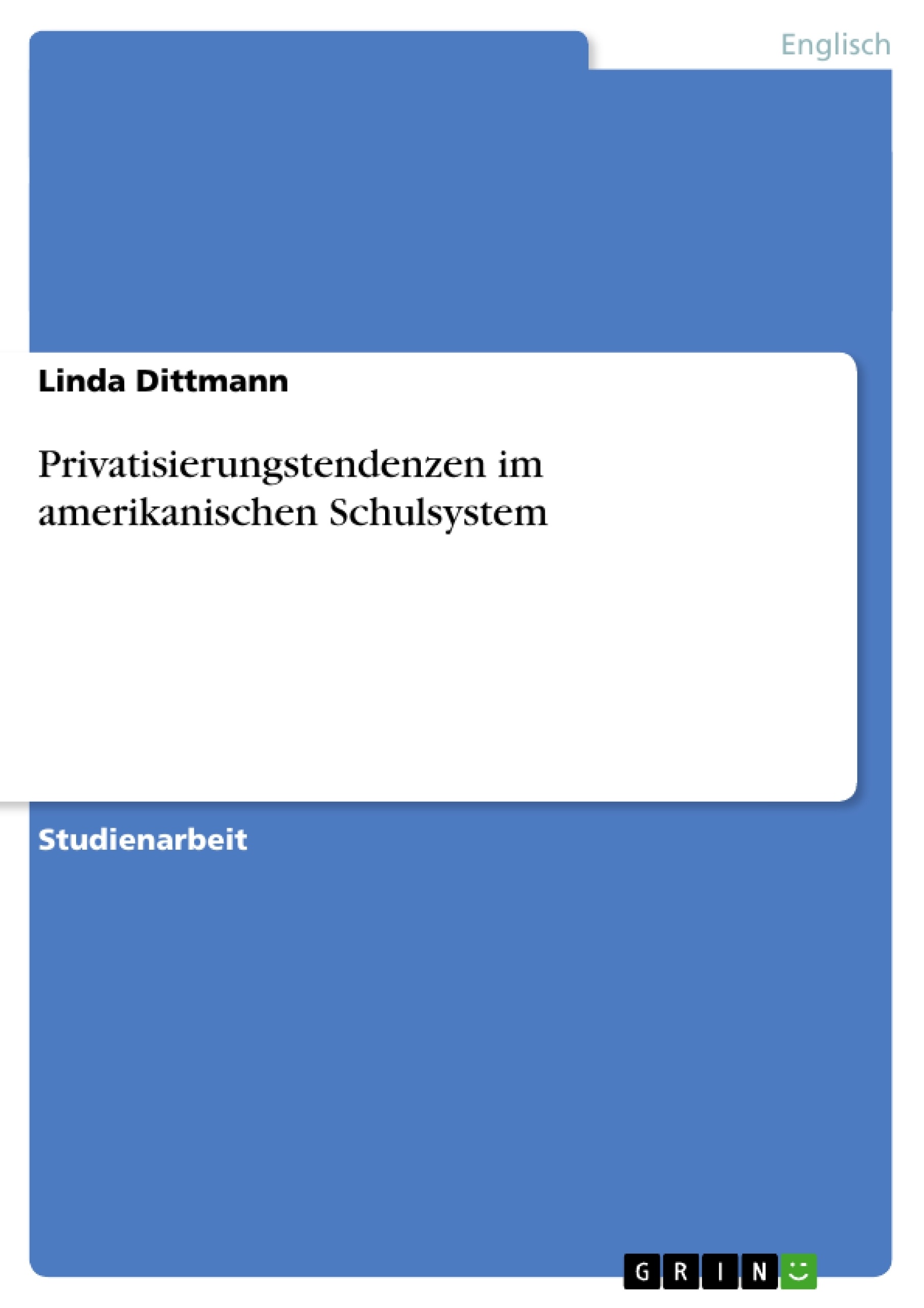Inhalt
1. Einführung
2. Vouchers
2.1 Ziele
2.2 Vorteile und Nachteile
3. Charter Schools
3.1 Ziele
3.2 Vorteile und Nachteile
4. Contracting
4.1 Ziele
4.2 Vorteile und Nachteile
5. Homeschooling
5.1 Vorteile und Nachteile
6. Zusammenfassung
7. Literatur
1. Einführung
Das große Ziel der Bildung war und ist für die amerikanische Regierung, die Gleichheit der Bildungschancen bei gleichzeitiger Leistungsoptimierung. Unter der jetzigen Regierung ist die Leistungsoptimierung allerdings vorrangig. Viele öffentliche Schulen, besonders die in Großstädten, werden von Gewalt, Drogenmissbrauch oder sexueller Promiskuität regiert. Deshalb suchen Eltern und auch Lehrer Möglichkeiten, ihre Kinder auf bessere Schulen zu schicken. So besuchen ca. 6 Millionen Schüler von insgesamt 52 Millionen amerikanischer Schüler Privatschulen. Diese Schulen haben aber natürlich ihren Preis, was für viele Eltern nicht erschwinglich sind. Da man in Amerika aber die Chancengleichheit für jeden bieten möchte, sollen öffentliche Bildungsinstitute privatisiert werden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte in dieser Arbeit vier dieser Möglichkeiten aufführen – die Bildungsgutscheine (Vouchers), die Charter Schools, das Contracting und das Homeschooling. Hierbei werde ich zunächst allgemein die einzelnen Privatisierungstendenzen definieren und deren gesetzlichen Hintergründe vorstellen. Dazu werde ich die Ziele auflisten und ganz besonders auf die Vor- und Nachteile dieser Möglichkeiten eingehen. Für diese Übersicht der jeweiligen Privatisierungstendenzen war mir das Buch Das amerikanische Schulwesen zwischen Marktideologie und staatlicher Verantwortung von Barbara Friehs sehr hilfreich, denn dies ist das einzige kompakte Werk, zu dieser Thematik, welches man im Moment auf dem Markt finden kann.
2. Vouchers
Vouchers sind Bildungsgutscheine, welche die öffentlichen Haushälter entlasten sollen . Der Punkt ist, dass die Eltern vom Staat Gutscheine bekommen, damit sie ihre Kinder auf eine private oder öffentliche Schule schicken können (vgl. Coulson 1998, S. 1). Die „Zuständigkeit für einen Teil der Schulfinanzierung“ (Friehs 2002, S. 107) wechselt somit. Normalerweise bekommen die Schuldistrikte Mittel vom Einzelstaat und vom Bund, außerdem erziehen sie Gelder aus der lokalen Grundstücksteuer. Die Schuldistrikte erteilen dann den Schulen einzelne Geldbeträge zu (vgl. Friehs 2002, S. 23f.). Bei den Vouchers bekommen die Eltern Gelder vom Staat und geben es dann der gewählten Schule. Diese Gutscheine entsprechen dem durchschnittlichen Wert, was ein schulpflichtiges Kind bezahlen müsste, würde es auf eine staatliche Schule gehen und dies selbst bezahlen. Das wäre ein Wert der zwischen 6,000$ und 18,000$ variiert (vgl. Friehs 2002, S. 24). Die Höhe hängt von der „Schulstufe, Schulform aber auch lokale Lage der Schule“ ab (Friehs 2002, 108). Hier gilt also das Nachfrage-Angebots-Prinzip, in anderen Worten, die privaten Bildungsinstitute werden nicht von behördlichen Einrichtungen gelenkt, sondern der Nachfrager, die Eltern und Schüler, beeinflussen das pädagogische Profil der Schule und somit findet das staatliche Schulmonopol ein Ende, die Zentralbürokratie wird enttrohnt und die Angebotsvielfalt wird begünstigt (vgl. Friehs 2002, 109).
2.1 Ziele
Eines der großen Ziele die durch die Vouchers erreicht werden sollen, ist natürlich die Schaffung einer Angebotsvielfalt. Dies geschieht indem auch staatliche Schulen dem System der Vouchers angehören, denn es soll nicht „über die Zukunft zentralgesteuerter staatlicher oder marktwirtschaftlich orientierten Schulen entschieden“ werden (Friehs 2002, 109). Damit soll also folgendes geschaffen werden: die Schulen sollen mit den finanziellen Mitteln in der Lage sein , selbstständig erzieherische Profile hervorbringen, die den Schülern und Eltern , also den Nachfragenden präsentiert werden. Es soll also eine Schulvielfalt geschaffen werden, in denen Eltern die Möglichkeit haben, eine Schule für ihre Kinder zu wählen, die deren kulturellen oder weltanschaulichen Vorstellungen entsprechen. Schule soll also „nicht mehr nach dem Prinzip der Zwangsgemeinschaft fungieren“ (Friehs 2002, 109), sondern soll gleichgesinnte Gruppen freiwillig zusammenschließen.
Die zweite große Funktion, die diese Gutscheine haben soll, ist dass sie eine Chancengleichheit schaffen sollen. Dies geschieht indem Eltern ihre Kinder an solche Schulen schicken, bei denen sie der Meinung sind, dass sie die Begabungen und Bedürfnisse ihrer Kinder am besten gerecht werden. Also eine „gezielte, individuelle Förderung des einzelnen Nachfragenden“ (Friehs 2002, 108). Eine Chancengleichheit hinsichtlich der sozialen Schichten ist auch gegeben, denn ärmere Familien können den gleichen bzw. ähnlichen Bildungsstandart für ihre Kinder schaffen, wie es in reicheren Familien der Fall ist.
Weitere Gründe für diese Gutscheine im amerikanischem Schulsystem sind natürlich auch die Verlagerung der Erbringung von Schulleistungen auf private Träge und die finanzielle Entlastung.
2.2 Vorteile und Nachteile
Natürlich hat jedes Programm seine Vor- und Nachteile. Bei diesen Bildungsgutscheinen kann man auch Nutzen und Mängel herausfiltern. Zum einem ist die freie Schulwahl sehr nützlich, denn sie erhöht die Angebotsvielfalt und die Eltern können die Schule wählen, die am besten zu den Bedürfnissen ihrer Kinder passt. Das wiederum stärkt die Rechte der Eltern, was im jeden Fall zu den Vorteilen zu zählen ist. Weitere Vorteil sind zudem, dass die Schulen eine finanzielle Selbstständigkeit erhalten und somit die Schulverwaltung „dezentralisiert“ wird (Friehs 2002, 108). Die Chancengleichheit, die in der Verfassung verankert ist, kann bei den Vouchers garantiert werden, wobei diese Chancengleichheit auch zu einem Nachteil werden kann. Denn die Schulen können sich ausgewählten Zielen widmen, welche mit Ausleseverfahren verbunden sind und somit kann gar keine Chancengleichheit mehr garantiert werden. Negativ einzuordnen wäre auch das Zusammenschließen der jeweiligen kulturellen oder religiösen Gruppen, denn dadurch kann Rassenhass und Vorurteile gefördert und Toleranz vermindert werden.
3. Charter Schools
Charter Schools sind unabhängige öffentliche Schulen. Sie sind befreit von der Bürokratie ( RPP 1998, 1).
[Sie] sind eigenständige juristische Personen, wobei die Rahmengesetzgebung den Begründern der Schulen die Möglichkeit lässt, jede Organisationsform zu wählen, die unter den allgemeinen Bestimmungen des jeweiligen Bundesstaates zulässig ist (Friehs 2002, 120)
Gegründet und organisiert werden Charter Schools meist von Eltern und Lehrern. Somit sind die Lehrer oft Angestellte oder gar Partner der Schule, in andern Worten, die Lehrer besitzen die Schule gemeinschaftlich (vgl. Friehs 2002, 120). Von separatistischen Gruppen, sowie gläubigen Gemeinschaften darf keine Charter School gegründet werden. Jedoch dürfen private Schulen einen Charter School Status erhalten. Das rentiert sich für die meisten Privatschulen aber kaum (vgl. Friehs 2002, 121). Deshalb werden meist nur staatliche Schulen in Charter Schools umgewandelt. Die Schulen werden durch Sponsoren finanziert. Diese Sponsoren sind zum Beispiel lokale und staatliche Schoolboards, Non-Profit Organisationen, staatliche Universitäten, (vgl. RPP 1998, 1) und in einigen Staaten dürfen auch private Unternehmen und Einzelpersonen als Sponsoren auftreten. Zwischen diesen Sponsoren und den Schulen bestehen Verträge, in denen festgelegt wird, in welcher Art und Weise die Schule Organisatorisches, sowie pädagogische Pläne umsetzt. Laut diesen Verträgen muss in regelmäßigen Abständen, anhand standardisierten Tests nachgewiesen werden, dass die Schüler ihre Leistungen verbessern. Dafür erhalten die Schülen völlige Selbstständigkeit. Soweit sich die Leistungen der Schüler verbessern, werden die Verträge verlängert, wenn dies nicht der Fall ist, werden die Schulen geschlossen. Auch wenn zu wenige Schüler die Schule besuchen oder die Finanziellen Mittel zweckentfremdet oder schlecht verwendet werden, führt das zur Schließung der Schule. Die Höhe des Betrages, den die Sponsoren der Schule zuweisen wird von dem Bundesstaat festgelegt, dieses entspricht meist dem Durchschnitt, den ein Staat pro Schüler ausgibt.
Die Charter Schools treffen alle Verfügungen selbst, dafür müssen die Charter Schools allerdings auch die Verantwortung übernehmen (vgl. Friehs 2002, 118). Eine dieser Entscheidungen ist zum Beispiel die Erstellung des Lehrplanes, welchen die Charter Schools autonom erstellen können (vgl. Friehs 2002, 119).
Diese Art von Schule entsteht, weil die öffentlichen Schulen einen sehr schlechten Ruf hinsichtlich ihrer Qualitäten haben. Daher braucht man Möglichkeiten, die auch ärmere Schichten nutzen können. Ländliche Schulen, „die aufgrund ökonomischer Überlegungen, etwa wegen ihrer geringen Schülerzahl, von der Schließung durch die verantwortlichen Schulausschlüsse bedroht […] kann […] durch die Errichtung einer Charter School erfolgreich entgegengewirkt werden.“ (Friehs 2002, 119).
Charter Schools sind reine Wahlschulen, daher dürfen Lehrer und Schüler diesen Schulen nicht zugewiesen werden.
3.1 Ziele
Wie auch viele andere Programme, haben die Charter Schools das große Ziel die schulischen Leistungen der Schüler zu verbessern (vgl. RPP 1998, 1). Der Beweis, dass eine Charter School diese Verbesserung von schulischen Leistungen vorweisen kann, soll durch standardisierte Test belegt werden. Zudem soll die Qualität einer Charter School dadurch begründet sein, dass sie existiert. Denn „die elterliche Wahlmöglichkeit [stellt] sicher, dass erfolglose Schulen wieder schließen müssen, da Eltern ihre Kinder in diesem Fall einfach in eine andere Schule senden.“ (Friehs 2002, 135f.). Die Wertbeständigkeit der Bildungsinstitute soll ganz besonders auch für unbegünstigte Kinder vergrößert werden (vgl. Friehs 2002, 118). Neben diesen Zielen soll zudem erreicht werden, dass die öffentlichen Schulen angeregt werden, sich zu verbessern . Das bedeutet, dass eine Wettbewerbssituation zwischen den staatlichen Schulen und den Charter Schools geschaffen werden soll. Charter Schools haben eine niedrige Schülerzahl (ca. 250 Schüler) und somit können sie sich besser auf die Bedürfnisse der Schüler konzentrieren (vgl. RPP 1998, 1). Die Qualität der Charter Schools soll aber auch noch mit besseren Arbeitsleistungen der Lehrer steigen. Was an sich auch ein Ziel der Charter Schools sein soll (vgl. Friehs 2002, 118). Die Lehrer sollen in der Lage sein, ihre erzieherischen Ideen im Klassenzimmer umsetzen zu können, denn „ein Lehrer an einer Charter School ist den hierarchischen Zwängen des Superintendanten und Schulausschüssen nicht mehr ausgesetzt“ (Friehs 2002, 125).
3.2 Vorteile und Nachteile
Hebung des Bildungsstandart für bedürftige Kinder, Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Lehrer, Schaffung einer Wettbewerbssituation zwischen Charter Schools und öffentlichen Schulen, sowie die Umsetzung neuer, ultimativer, pädagogischer Ideen sind wunderbare Ziele, die ein Bildungssystem revolutionieren würde. Doch können diese Ziele auch genauso umgesetzt werden?
Die Charter Schools sollen anhand eines Wettbewerbs indirekt auch die öffentlichen Schulen verbessern. Da es in einigen Bundesstaaten Bestimmungen gibt, dass das Geld was den öffentlichen Schulen durch Wechseln auf Charter Schools verloren geht, trotzdem gezahlt wird, kann es keinen Wettbewerb geben. (vgl. Friehs 2002, 133). Die öffentlichen Schulen haben bis auf weniger Schüler gar keinen Nachteil, denn sie bekommen weiterhin die gleichen finanziellen Mittel. Zudem sind Charter Schools so aufgebaut, dass sehr klein sind und nur wenige Schüler haben. Sie können daher, wie oben erwähnt besser auf die einzelnen Bedürfnisse der Schüler eingehen, was an öffentlichen Schulen aus institutionellen Gründen gar nicht möglich ist.
Der Charakter einer kleinen überschaulichen Schule weißt aber einen Nachteil auf, der erwähnt werden muss. Da die Schulen nur wenig Kapazität besitzen, kann die Chancengleichheit, die immer wieder propagiert wird, nicht gerecht werden. Denn obwohl Charter Schools reine Wahlschulen sind und eine Auswahl verboten ist, „kann [man] davon ausgehen, dass in einigen Charter Schools trotz anderslautender Behauptungen oft eine ziemlich eigenmächtige Selektion der Kinder erfolgt.“ (Friehs 2002, 120). Zudem gibt es für viele Schüler kaum Möglichkeiten die Schule mit dem Bus zu erreichen, denn von den Schuldistrikten werden diese nur selten zur Verfügung gestellt (vgl. Friehs 2002, 130).
Ein Punkt, der als positiv angesehen werden kann ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Lehrer. Obwohl Charter Schools gegründet werden, um ein ganz neues pädagogisches Programm aufzuweisen, passiert dies nur relativ selten. Dies liegt wohl daran, dass die Lehrer, die an den Charter Schools kommen meist an die alte Lehrweise gewöhnt sind und dies an den neuen Schulen nicht ändern. Entscheidende Erneuerungen gibt es nur an solchen Charter Schools, die von Lehrern mit neuen Konzepten gegründet wurden (vgl. Friehs 2002, 126f).
So können einige positive Aspekte von Charter Schools durch negative Neben- oder Nachwirkungen widerlegt werden. Dennoch ist auch hier die Schulwahlfreiheit der Eltern als Vorteil zu bewerten.
4.Contracting
Genau wie bei den Charter Schools handelt es sich bei dem Contracting um Verträge, die Schulen mit Non-Profit-Organisationen, sowie profitorientierten Unternehmen, auch EMOS genannt, eingehen. Dies ist keine neue Idee, denn schon seit Jahren beauftragen staatliche Schulen private Unternehmen mit außerunterrichtlichen Angelegenheiten, wie zum Beispiel Buchhaltung, Transportwesen, Reinigungspersonal etc. Neu ist, dass das Contracting den Unternehmen ganz und gar die Verantwortung einer Schule oder eines Schuldistrikts übergibt (vgl. Friehs 2002, 137f.).
Die Schulen erhalten solange öffentliche finanzielle Mittel, wie der Vertrag mit den Vertragpartnern läuft. Wiederrum wird aber vertraglich abgesichert, dass eine bestimmte Anzahl an Schülern vorhanden ist und dass ein bestimmter Standart an Leistung gegeben ist. Außerdem kann festgelegt werden, dass die Schulen eigene Lehrpläne aufstellen müssen und dass die Schüler in bestimmten Abständen standardisierte Tests absolvieren müssen. Als weiteres können von den Behörden auch Kriterien vorgegeben werden, nach denen die Lehrer und Schüler ausgesucht werden (vgl Friehs 2002, 138f.).
4.1 Ziele
Auch hier sind die Ziele kurz zu nennen. Wie in den vorhergehenden Programmen sollen die Ausgaben verringert werden. Die öffentlichen Schulen sollen durch dieses Contracting eine Verbesserung der schulischen Leistungen der Schüler vorweisen können . Das Verhältnis zwischen den Einzelschulen und der Schulbehörde soll sich ändern – die Schulen sollen unabhängiger werden. Zudem fordert die Behörde Leistungsnachweise und stellt Bedingungen ob die Schule eine Berechtigung für öffentliche Gelder hat.
4.2 Vorteile und Nachteile
Die Abschaffung ständiger politischer Auseinandersetzungen ist ein durchaus erfreulicher Aspekt. Doch die Vorgabe von standardisierten Tests verhindert natürlich die autonome Stellung der Schule. In anderen Worten, die Lehrer müssen die Lehrpläne so ausrichten, dass die Schüler die Tests bestehen. Es bleibt also kaum Zeit, um andere Themen, die nicht zu den Tests gehören, zu behandeln. Da die Behörden die Kriterien vorgeben können, nach denen die Lehrer und Schüler ausgesucht werden, ist eine Chancengleichheit überhaupt nicht gegeben
Weitere Probleme weisen die Verträge auf, die oftmals nicht klar formuliert sind, dadurch kommt es zu Missverständnissen der Aufgabenverteilung. Es ist also nicht ganz klar, welche Aufgaben die Behörden und welche die Schule übernimmt, so zum Beispiel auch in der Finanzgebung. Es ist nicht eindeutig, welche Kosten von den privaten Firmen und welche von den Behörden übernommen werden (vgl. Friehs 2002, 139).
Das größte Defizit ist, dass profitorientierte Unternehmen aus den Verträgen mit Schulen Profit machen wollen. Dies ist allerdings nur möglich, indem sie Lehrer entlassen und zu wenig Lohn zahlen, was natürlich zu höheren Klassenschülerzahlen führt. Viele Lehrer haben auch kein Zertifikat und sind deshalb weniger qualifiziert. Eltern müssen oft die Reparaturkosten tragen. Und durch standardisierte Lehrpläne gibt es Einsparungen bei der Entwicklung von neuen Lehrplänen und an Materialen für den Unterricht wird auch gespart. Die Verwaltung wird standardisiert, denn auch das senkt die Kosten und behinderte oder ausländische Schüler, sowie Schüler, die besondere Ausnahmeangebote benötigen, sind nicht gern gesehen. Diese Schüler verursachen natürlich Kosten. Hier kann also kaum von einer Chancengleichheit geredet werden (vgl. Friehs 2002, 140). Kurz und knapp, hier wird an der Qualität der Schule und an den Kindern gespart. Das Geld sollte an die Kinder gehen und nicht an die Firma.
5. Homeschooling
Homeschooling erklärt sich aus dem Begriff selbst – die Kinder werden nicht in einer Bildungsinstitution, sondern zu Hause, meist von den Eltern unterrichtet. Seit etwa den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts erlebte das Homeschooling einen regelrechten Boom, was dazu führte, dass im Moment ca. 1 Million amerikanischer Kinder nach dem Prinzip des Homeschoolings gebildet werden (vgl. Friehs 2002, 247). Etwa 20% dieser Kinder gehören zu Familien, deren Eltern die Meinung vertreten, die „Qualität des öffentlichen Schulwesens“ (Friehs 2002, 147) würde immer mehr abnehmen. Die Kinder sollen nicht „autoritär, lehrerzentriert, schulbuchorientiert, kompetitiv und rein auf akademische Leistungen fokkusiert“ unterrichtet werden, denn alle Kinder [hätten] den natürlichen Wunsch und die angeborene Fähigkeit […] such selbst zu erziehen und zu bilden, und Schulen [verhindern] die natürliche Ausbildung und Entwicklung von Kindern (Friehs 2002, 147).
Familien, zu dieser Art von Homeschooling-Anhängern gehören, sind in der Regel weiß und gutsituiert (vgl. Friehs 2002, 148).
Die restlichen 80% der 1 Million zu Hause unterrichteter Kinder gehören den Fundamentalistischen Christen an. Diese führen ein Leben, welches der Bibel und Gott ausgerichtet ist. Deshalb wollen sie ihre Kinder nicht dem „antireligiösen Materialismus, Gewalttätigkeit, sexuelle Promiskuität und Drogenmissbrauchs“ (Friehs 2002, 148), der an amerikanischen Schulen vorherrscht, aussetzen.
Nun ist es aber nicht so einfach, die Kinder zu Hause zu unterrichten. Natürlich gibt es gesetzliche Vorschriften, die Familien, die das Konzept des Homeschoolings vorziehen, befolgen müssen: Homeschooling wird dem Unterricht an öffentlichen Schulen dann gleich gesetzt, wenn das Material, was genutzt wird, auch dem entspricht, das öffentliche Schulen verwenden. Zudem müssen Eltern ausreichend geschult sein. Kinder dürfen keinerlei Nachteile erleiden und es muss für sie die Möglichkeit bestehen, sozialen Kontakt zu anderen Kindern aufbauen zu können (vgl. Friehs 2002, 150f.).
Ausgangspunkt des Homeschoolings war ein Gerichtsurteil 1972, welches den amish Kindern erlaubte zu Hause unterrichtet zu werden, weil nur so deren Lebensweise und Kultur weiterhin fortgeführt werden konnte. Heute ist Homeschooling in ganz Nordamerika erlaubt, dennoch gibt es in 34 Bundesstaaten gesetzliche Bestimmungen für das häusliche Unterrichten. In 29 Staaten müssen die Schüler in Abständen Entwicklungen vorweisen. In anderen Staaten ist es sehr einfach eine Erlaubnis zu bekommen. Hier muss man sich nur brieflich beim Unterrichtsministerium absichern (vgl. Friehs 2002, 151f.).
5.1 Vorteile und Nachteile
Ein ganz besonders positiver Aspekt ist natürlich, dass die Institution Familien in dieser Art des Unterrichtens gefestigt wird, denn die Familie verbringt Zeit miteinander, zum Beispiel bei der Entwicklung des Lehrplans. Zudem können Eltern dann besser auf den persönlichen Wissensdrang und Probleme ihrer Kinder reagieren. Das ist auch der Grund, warum Kinder, die zu Hause unterrichtet werden bessere Ergebnisse bei standardisierten Tests erhalten, als Schüler von öffentlichen Schulen. Auch Universitäten sind interessiert an Homeschooling-Kinder, „da sie viel stärkere Selbstmotivation und Kreativität mitbringen als Altersgenossen“ (Friehs 2002, 149).
Diese Vorteile des Homeschoolings können sehr überzeugend sein, doch hat dieses ganze Konzept natürlich auch negative Aspekte. So erfahren die Kinder wenig sozialen Kontakt, sie sind also sozial isoliert und da ein Elternteil meist nicht der Arbeit nachgehen kann, da es ja für die Bildung des Kindes sorgt, muss sich die Familie finanziell einschränken (vgl. Friehs 2002, 148ff.). Das bedeutet sicher auch, dass alleinerziehende Eltern diese Art von Unterricht nicht ausüben können. Einer der wichtigsten Nachteile ist, dass wenn die Eltern nicht genügend geschult sind und dadurch nicht das ausreichende Wissen vermitteln können, kann es möglich sein, dass dem Kind ein „erfolgreiches Leben in einer modernen Gesellschaft“ genommen wird (Friehs 2002, 150).
6. Zusammenfassung
Die in dieser Arbeit aufgeführten Schulwahlmöglichkeiten sollen für eine freie Schulwahl sorgen, die Rechte der Eltern stärken, die einzelnen Schulen finanziell autonomisieren, die Schulverwaltung dezentralisieren, eine Wettbewerbssituation gegenüber staatlichen Schulen schaffen und vor allem Leistungsoptimierung bei gleichzeitiger Chancengleichheit bieten. Diese Ziele können teilweise auch erreicht werden, doch zeigen diese Privatisierungstendenzen auch Defizite auf, die nicht von der Hand zu weisen sind. So können Zusammenschlüsse von ethischen Gruppen, bei den Vouchers, Intoleranz fördern und die Chancengleichheit, die bei den Charter Schools propagiert wird, kann wegen geringer Kapazitäten nicht verwirklicht werden. Noch weniger positiv ist das Contracting einzuschätzen, denn bei profitorientierten Organisationen kann das Geld wichtiger sein, als das Wohl der Kinder. So kann man sagen, dass mit diesen Privatisierungstendenzen versucht wird dem schlechten Ruf der staatlichen Schulen entgegenzuwirken, dies aber bislang kaum nachzuweisen war.
7. Literatur
Coulson, Andrew J.. “School Vouchers. Kap.1: Issues and Arguments” (1998), IASLonline. URL:http//www.schoolchoices.org/ (06.06.2003).
Friehs, Barbara (2002). Das amerikanische Schulwesen zwischen Marktideologie und staatlicher Verantwortung. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit "Inhalt"?
Die Arbeit untersucht verschiedene Privatisierungstendenzen im amerikanischen Schulsystem mit dem Ziel, Gleichheit der Bildungschancen bei gleichzeitiger Leistungsoptimierung zu erreichen. Sie betrachtet Bildungsgutscheine (Vouchers), Charter Schools, Contracting und Homeschooling.
Was sind Bildungsgutscheine (Vouchers)?
Bildungsgutscheine sind staatliche Zuschüsse, die Eltern erhalten, um ihre Kinder an privaten oder öffentlichen Schulen ihrer Wahl anzumelden. Sie sollen die öffentlichen Haushalte entlasten und die Wahlfreiheit der Eltern erhöhen.
Welche Ziele verfolgen Bildungsgutscheine?
Die Hauptziele sind die Schaffung einer Angebotsvielfalt an Schulen, die Förderung der Chancengleichheit, die Verlagerung von Schulleistungen auf private Träger und die finanzielle Entlastung des Staates.
Was sind die Vor- und Nachteile von Bildungsgutscheinen?
Vorteile: Freie Schulwahl, Stärkung der Elternrechte, finanzielle Selbstständigkeit der Schulen, garantierte Chancengleichheit (theoretisch). Nachteile: Mögliche Ausleseverfahren, Förderung von Rassenhass und Vorurteilen durch Zusammenschlüsse kultureller oder religiöser Gruppen.
Was sind Charter Schools?
Charter Schools sind unabhängige öffentliche Schulen, die von Bürokratie befreit sind. Sie werden oft von Eltern und Lehrern gegründet und durch Sponsoren finanziert. Sie operieren auf Grundlage von Verträgen, die Leistungsverbesserungen der Schüler durch standardisierte Tests nachweisen müssen.
Welche Ziele verfolgen Charter Schools?
Die Ziele sind die Verbesserung der schulischen Leistungen, die Erhöhung der Wertbeständigkeit der Bildungsinstitute, die Anregung öffentlicher Schulen zur Verbesserung, die Konzentration auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Lehrer.
Was sind die Vor- und Nachteile von Charter Schools?
Vorteile: Hebung des Bildungsstandarts für bedürftige Kinder, Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Lehrer, Schaffung einer Wettbewerbssituation, Umsetzung neuer pädagogischer Ideen. Nachteile: Kein Wettbewerb, wenn öffentliche Schulen weiterhin finanzielle Mittel erhalten, Selektion der Kinder trotz anderslautender Behauptungen, mangelnde Busverbindungen.
Was ist Contracting im Bildungsbereich?
Contracting bezeichnet Verträge, die Schulen mit Non-Profit-Organisationen oder profitorientierten Unternehmen (EMOS) eingehen, um die Verantwortung für eine Schule oder einen Schuldistrikt zu übernehmen.
Welche Ziele verfolgt das Contracting?
Die Ziele sind die Verringerung der Ausgaben, die Verbesserung der schulischen Leistungen, die Unabhängigkeit der Schulen von der Schulbehörde und die Festlegung von Leistungsnachweisen.
Was sind die Vor- und Nachteile von Contracting?
Vorteile: Abschaffung ständiger politischer Auseinandersetzungen. Nachteile: Einschränkung der Autonomie durch standardisierte Tests, fehlende Chancengleichheit, unklare Aufgabenverteilung, Profitmaximierung der Unternehmen auf Kosten der Schulqualität (z.B. durch Entlassungen, geringe Löhne, Einsparungen bei Materialien).
Was ist Homeschooling?
Homeschooling bedeutet, dass Kinder zu Hause, meist von den Eltern, unterrichtet werden. Es erlebte einen Boom seit den 1970er Jahren.
Welche Gründe gibt es für Homeschooling?
Ein Grund ist die Kritik an der Qualität des öffentlichen Schulwesens. Ein weiterer Grund ist der Wunsch fundamentalistischer Christen, ihre Kinder vor unerwünschten Einflüssen zu schützen.
Was sind die Vor- und Nachteile von Homeschooling?
Vorteile: Festigung der Institution Familie, individuelle Förderung der Kinder, bessere Ergebnisse bei standardisierten Tests, stärkere Selbstmotivation und Kreativität. Nachteile: Wenig sozialer Kontakt, finanzielle Einschränkungen der Familie, mangelnde Qualifikation der Eltern.
- Quote paper
- Linda Dittmann (Author), 2004, Privatisierungstendenzen im amerikanischen Schulsystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108494