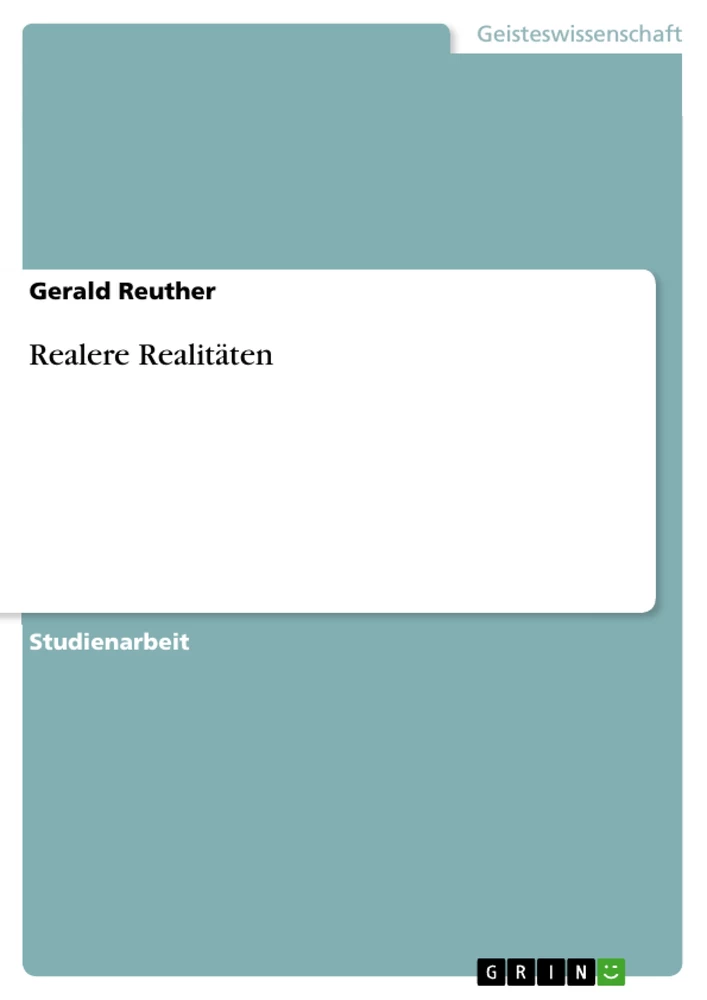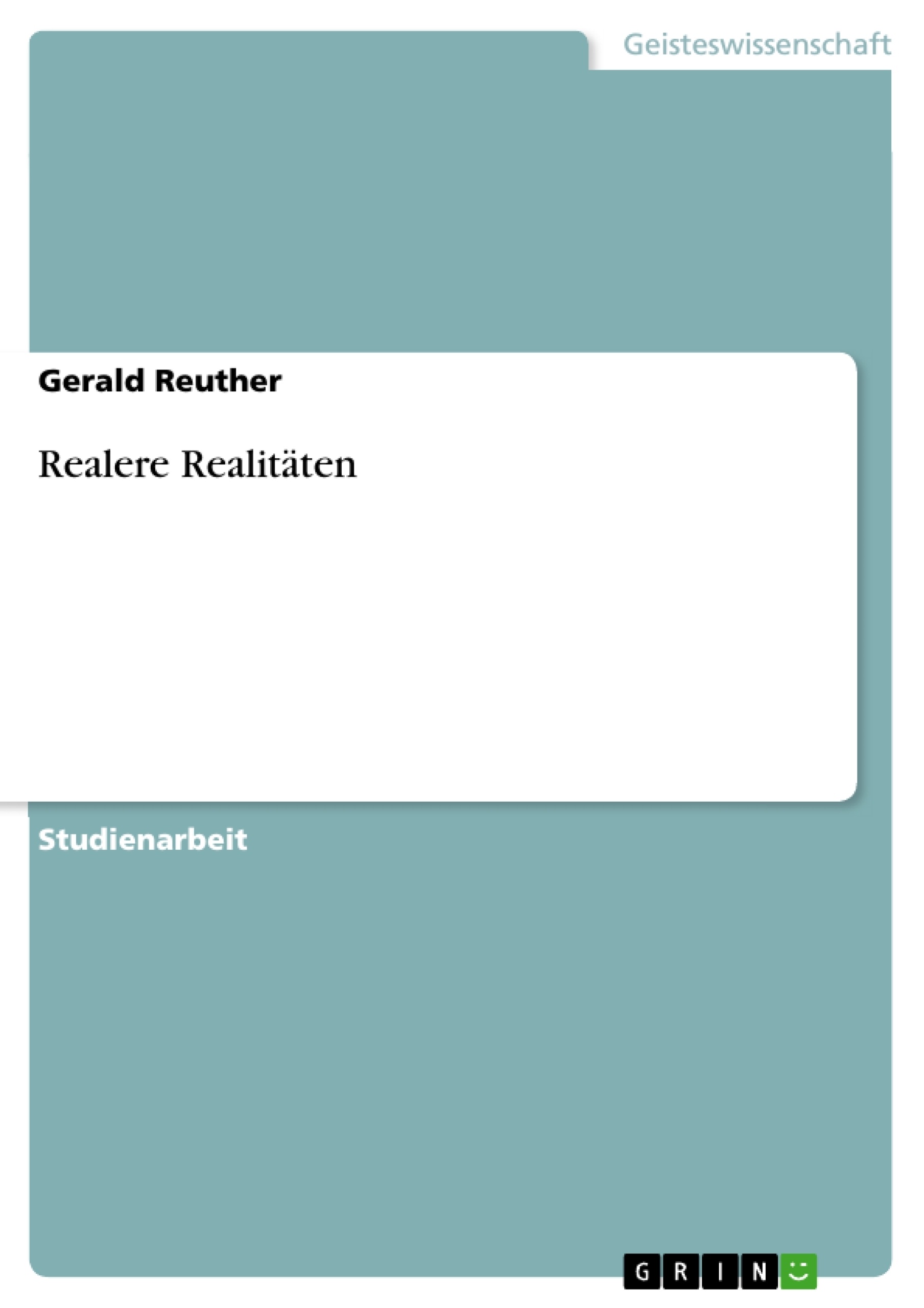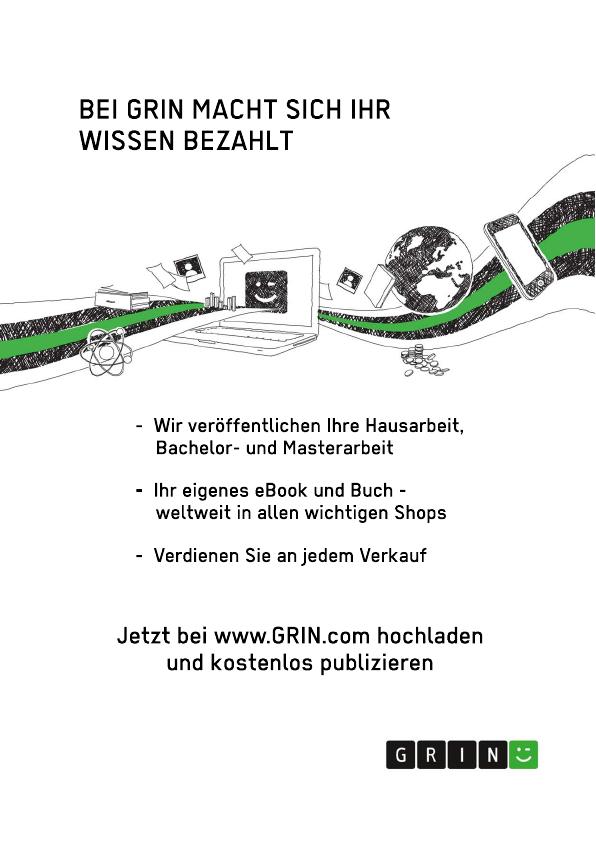Gliederung
I. Gliederung
II. Metaphorik als Erkenntnisprinzip
III. Kunst schaffen - Welt imitieren
1. Die Idee der ,Idee’
2. Von der Unmöglichkeit zur Veränderung
3. Welches Problem einer haben dürfte...
4. Metaphorik zwischen Volk und Göttern
IV. Bild vom Bild
1. Platons Höhle
2. Zeichendeutungen
3. Sokrates sein und Glaukon werden
V. Realere Realitäten
VI. Literatur
Metaphorik als Erkenntnisprinzip
„In der Mitte des Raums steht eine große Kiste. Metallschrott ist auf ihr angehäuft. Ofenrohre verschiedener Länge und Stärke, eine Schubkarre, eine Badewanne, Nägel, Hämmer. Alles ist alt, rostig und sieht so aus, als wäre es auf dem Schrottplatz aufgelesen worden. Die Wirklichkeit der Requisiten besteht aus Rost und Metall. Mit ihnen werden die Schauspieler im Fortschreiten der Handlung eine absurde Zivilisation aufbauen; eine Zivilisation der Gaskammern, angedeutet durch Ofenrohre, die die ganze Raumausstattung prägen, wenn die Schauspieler sie an Schnüren aufhängen oder am Boden festnageln. Auf diese Weise vollzieht sich der Übergang von den Tatsachen zur Metapher.“ (GROTOWSKI 1968/ 1994, S.68)
Man kann von den Metaphern zu den Tatsachen gelangen, die unsere Kultur geprägt haben, indem man ihren Interpretationen und ihren Rezeptionserfolgen entlang einer Oberfläche folgt, mit den Fingern tastend entlang ihrer Beschaffenheit erkundet, bis man in der bloßen Andeutung einer Ahnung zu verstehen beginnt, wie sie sich bei Berührung verhalten (würden). Man kann den Grenzverläufen der Begriffe folgen, dort, wo sie ins Indifferente abzugleiten drohen und aus dem Bereich ihrer Ambivalenz heraus die Ordnung der Dinge mit dem Verdacht unterlegen, sie sei historisch gewachsen, demnach kulturellen Ursprungs, in dieser Feststellung den Zweifel an ihrer Unveränderbarkeit tief ins Wissen um die Welt einschreiben, um einer neuen Flexibilität der Realität willen, die kein Geringerer als Martin Heidegger, zum Sekundärautor mutiert, einem Friedrich Nietzsche eben noch als Motiv unterlegt hatte:
„An dem, was ,war’ stößt sich das Vorstellen und sein Wollen. Gegenüber dem, was ,war’ kann das Wollen nichts mehr ausrichten. Gegenüber allem ,es war’ hat das Wollen nichts mehr zu bestellen. Dieses ,es war’ widersetzt sich dem Wollen des genannten Willens. Das ,es war’ wird zum Stein des Anstoßes für alles Wollen. Es ist derjenige Stein, den der Wille nicht mehr wälzen kann. So wird das ,es war’ zur Trübsal und zum Zähneknirschen jeden Wollens, das, als ein solches, immer vorwärts will und gerade dies nicht kann gegenüber dem, was als vergangen festund zurückliegt. Das ,es war’ ist so das Widrige für alles Wollen.“ (HEIDEGGER 1954/ 2001, S.55F)
Man kann, kurz gesagt, die Gültigkeit der Wahrnehmungswelt bezweifeln, um im menschlichen Beobachter jener Ordnungen wieder Herr zu werden, die man bei Externalisierung (in Form etwa der ,Natur’, der Vergangenheit’ etc.) als Grundlage passiv hätte hinnehmen müssen. Indessen lässt sich all dies nur metaphorisch bewerkstelligen: Man kann vorübergehend von der Existenz der Existenz absehen, um sie im passenden Moment an unerwarteter Stelle wiederzu(er)finden und es gilt dabei nur dem Vorwurf zu entgehen, die Erfahrbarkeit von Lebenswelt als Prinzip geleugnet zu haben.
„Die Reduktion sollte die Existenz der Welt nicht leugnen, sondern nur von ihr absehen.
(BLUMENBERG 1997, S.86)
Mithin bleibt das Ergebnis der Reduktion metaphorisch, insofern und so weit zwar die Ableitung aus den ,Tatsachen’ inhärent insistiert, die ,Tatsachen’ selbst jedoch durch ,vernünftige’ Blockaden in Form von Methoden, Techniken oder Reflexionen von jeglichem Einfluß ausgeschlossen werden. Der Mensch, wird man am Ende sagen, war zu schwach, um sich den vorhandenen Präkonfigurationen seiner Wahrnehmung zu entziehen, die ,vernünftige’ Ordnung der Dinge bleibt davon jedoch unbeeindruckt.
Dass diese ,Ordnung’ selbst eine Metapher ist, wird nach einer weiteren kleinen Reduktion sichtbar. Auf der einen Seite verbleibt die bloße Feststellung, beispielsweise eines Niklas Luhmann: Die Realität ist, wie bzw. was sie eben ist und wenn es uns unwahrscheinlicherweise gelingen sollte, sie zu abzubilden, erreichten wir nur ihre Dopplung. „Erkenntnis ist anders, als die Umwelt, weil die Umwelt keine Unterscheidungen enthält, sondern einfach ist, wie sie ist.“ (luhmann 2001, S.223) Diese ihrer Bedeutung beraubte Welt ist im Folgenden nur deshalb keine Metapher mehr, weil es nichts gibt, wofür sie stehen könnte. Auf der anderen Seite der Unterscheidung finden wir die bekannte cartesische Vorstellung wieder, konkretisiert als offene Frage danach, was aus einer Vernunft (noch) hätte werden können, wenn die menschliche Unzulänglichkeit (der Wahrnehmung) ihr nicht permanent in ihre Weltschöpfung gepfuscht hätte.
Man gelangt also von der Metapher zur Tatsache, von der Tatsache zur Metapher, indem man den Grenzverläufen (zwischen Welt und Vernunft, zwischen Ast und Stamm, zwischen den Dingen und ihrer Umwelt) folgt und endet schließlich vielleicht beim Bedenken eines Michel Foucault:
„Wenn alles absolute Verschiedenheit wäre, wäre das Denken der Einzähligkeit ausgesetzt, und wie die Statue von Condillac, bevor sie mit der Erinnerung und dem Vergleich begonnen hat, wäre es der absoluten Verstreuung und der absoluten Monotonie ausgeliefert. Es gäbe weder Erinnerung, noch mögliche Vorstellungskraft und infolgedessen auch keine Reflexion. Es wäre unmöglich, die Dinge miteinander zu vergleichen und einen gemeinsamen Namen zu begründen. Es gäbe keine Sprache. Sprache existiert, weil unterhalb der Identitäten der Boden der Kontinuitäten, der Ähnlichkeiten, der Wiederholungen und der natürlichen Verflechtungen liegt. Die Ähnlichkeit, die seit dem siebzehnten Jahrhundert aus dem Denken ausgeschlossen ist, bildet immer noch die äußere Grenze der Sprache: den Ring, der das Gebiet dessen umgibt, was man analysieren, ordnen und erkennen kann. Das ist das Gemurmel, das im Diskurs aufgelöst wird, ohne das er aber nicht sprechen könnte.“ (FOUCAULT 1966/1997, S.164)
Man hat mithin den leisen Verdacht, das Problematische an der Erkenntnis könne u.U. in der Erkenntnis selbst verborgen liegen, Sprache, Ordnung und Beobachtung implementierten den unumgänglichen Fehler in eine geschlossene Operation ,Welt’, die einerseits ganz gut ohne ihre Beobachter auskäme, dann andererseits freilich in der implizierten Latenz verharren dürfte, völlig ohne einen Unterschied zu machen. Geht man soweit konform, kann man anschließend entweder zu denken aufhören, die Welt der Zeichen und Bedeutungen weitgehend, vollends aber ihre Reflexion hinter sich lassend, oder nicht.
Mit anderen Worten: Die Vernunft kann von der Welt absehen, die Welt kann von der Vernunft absehen, jedoch weder die Welt von der Welt, noch, und das scheint für ihren Weltzugang entscheidend, die Vernunft von der Vernunft. Und selbst der Verzicht des Menschen auf Wahrnehmung oder Vernunft oder beides ist wiederum nur metaphorisch denkbar, weil der Mensch zwar angelegentlich - und historisch nicht einmal unauffällig - vom Menschen, nicht aber von eigenen Bedürfnissen oder (seinen) Bedeutungen absehen kann. Und dabei lässt sich dann zwanglos davon absehen, dass schon das Absehen ,an sich’ zumindest potentielle Sichtbarkeit voraussetzte.
Nun könnte man anhand dieser Überlegungen die Metapher definitiorisch zu erfassen suchen. Man könnte ihre Funktionen im Bereich wissenschaftlicher Erkenntnis suchen oder die Verknüpfungen analysieren, die das Bild (als Modell/ Reduktion/ Abbildung oder Inszenierung) mit seiner Bedeutung, die Bedeutung analog mit der Wahrheit und die Wahrheit mit der (Publikums-) Wirksamkeit verbinden. Das ist mehrfach getan worden und hat als Untersuchung durchaus seine Berechtigung. Für unseren konkreten Fall, die Inszenierungsanalyse des platonischen Höhlengleichnisses, existiert indessen eine gangbare Abkürzung in einer sehr einfachen Frage: Welches Problem muss einer eigentlich gehabt haben, der in der Inszenierung seiner Höhlenmetapher nicht allein einen grundlegenden Selbstzweifel durch dialogische Pädagogik überdeckt, sondern denselben Zweifel gleich der menschlichen Wahrnehmung prinzipiell unterlegt und sie somit - möglicherweise im historischen Primat[1] - phantomatisch[2] unterwandert?
Um es vorweg zu nehmen: Platon muss ein Problem mit jener foucaultschen Einzähligkeit des Denkens gehabt haben, das an Gewicht über die bloße Feststellung der Nutzlosigkeit weiterer Abstraktionen hinausging. Wie anders wäre der radikale Schnitt zu erklären, der den Weltzuschauer kurzerhand vom Geschehen ausschließt indem er eine Ebene in die Vorstellung einführt, die das ,Wirkliche’ vom ,Erfahrbaren’ so nachhaltig trennt, dass fürderhin schon Gewalt nötig sein wird, um den Menschen vom Einen zum Anderen oder zurück zu bringen? Wie, vor allem, wäre zu erklären, dass er in der Darstellung dieser Trennung Mittel verwendet, deren Wesenskern er allemal für philosophisch unwürdig hält - theatrale Mittel, rhetorische Finessen, Metaphorik! Da macht sich, kurz gesagt, einer zum Künstler, der die gesamte Kunst explizit lieber vermieden gewusst hätte:
„Selbst wertlos, vereint sich die nachahmende Kunst mit Wertlosem und zeugt Wertloses.“
(PLATON 2001B, S.443)
Und unter uns gesagt...
„Unter uns gesagt - ihr werdet mich ja nicht bei den Tragöden- und den andern nachahmenden Dichtern anzeigen -, scheint mir alle diese Dichtung ein Gift für den Geist der Hörer zu sein.“
(PLATON 2001B, S.431)
Man wird den Verdacht nicht mehr los, da spiele einer sehr überlegt und tief ironisch mit dem Gedanken, wo der Teufel nun einmal sei, könne man ihn ruhigen Gewissens mit dem Beelzebub austreiben. Aber das ist eine andere Geschichte...
Kunst schaffen - Welt imitieren...
Dezidierte Ablehnung von Kunst, aufgeschlüsselt nach zeitgemäßen Genres zieht sich gleichermaßen scharf formuliert bekanntlich durch das gesamte 10. Buch der ,Politeia’, säuberlich geordnet in folgender Reihe:
Malerei:
„’Es gibt da also dreierlei Stühle. Der eine ist der wahrhaft existierende; ihn hat, glaube ich, Gott erschaffen. Oder wer sonst?’ , Niemand anderer!’ ,Der zweite ist das Werk des Tischlers.’ ,Ja!’ ,Der letzte der des Malers?’ ,Gut!’“ (PLATON 2001B, S.434)
Tragödie:
„Dann ist ja auch der Tragödiendichter, sofern er Nachahmer ist, der dritte vom König und der Wahrheit her gerechnet, und ebenso alle andern Nachahmer.“ (PLATON 2001B, S.435)
Kunst im Allgemeinen:
„Weitab von der Wahrheit steht also die Kunst der Nachahmung, und gerade deshalb schafft sie alles nach, weil sie nur wenig von jedem Ding erfaßt und da nur sein Scheinbild.“ (PLATON 2001B, S.436)
Dichtung:
„Von Homer an ahmen alle Dichter nur ein Scheinbild der Vollkommenheit und der übrigen Dinge nach, über die sie dichten, erfassen aber die Wahrheit nicht; sondern sie sind wie der Maler, von dem wir sprachen: dieser malt, ohne selbst etwas von der Schusterei zu verstehen, einen täuschend ähnlichen Schuster.“ (PLATON 2001B, S.439)
„Indessen haben wir noch nicht die größte Anklage gegen die Dichtung vorgebracht! Daß sie die Kraft hat, auch vortreffliche Menschen zu schädigen - mit wenigen Ausnahmen -, das ist wohl furchtbar.“ (PLATON 2001B, S.447)
Komödie:
„Dieselbe Überlegung gilt auch für das Komische. Wenn Du in der Komödienaufführung oder bei Dir zu Hause Possen hörst, die du selbst zu machen dich schämen würdest (...).“ (PLATON 2001B, S.448)
Vom Staatsbann ausgenommen werden explizit lediglich die Hymnen auf Götter und die Loblieder auf gute Menschen, was aus Sicht des Autors offenbar keiner weiteren Begründung bedarf. (vgl. platon 2001B, S.449) Es mag dagegen einen Moment lang verwundern, dass die Musik in der Aufzählung völlig fehlt, insbesondere, wo der Flötist durchaus für wert gehalten wird, geradezu beispielhaft zu fungieren. Aus der Rolle, die Platon ihm mit seinem ,Spiel’[3] zugedacht hat, wird man allerdings vordergründig kaum schlau werden:
„Zwangsläufig muß der Benutzer jedes Dinges darin auch die größte Erfahrung haben und dem Erzeuger mitteilen, was er daran gut oder schlecht mache, auf Grund der praktischen Verwendung. So klärt der Flötenspieler den Flötenmacher über die Flöten auf, damit sie ihm beim spielen brauchbar sind, und gibt Weisungen für den Bau, der andere aber folgt ihm.“ (PLATON 2001B, S.441)
Man wird den kurzen Umweg über die Ideenlehre nehmen müssen, der im Hinblick auf die hier avisierte Interpretation des Höhlengleichnisses ohnehin angebracht erscheint, um den Flötisten in seine Stellung als Handwerker und Vorbild einzuführen.
(1) Die Idee der ,Idee'
Die Ideenlehre scheint zumindest der Rezeption stets als das Kernstück der platonischen Lehre, begründet sich dieser metaphysischen Wissenskonstruktion doch radikaler, als jeder anderen Stelle des literarischen Kanons jenes positive Welterkenntnisideal, das unter dem platonischen Namen des ,Realismus’ bis heute die gängige alltagssprachliche Umschreibung dafür geblieben ist, dass man irgendwann auf den sprichwörtlichen ,Boden der Tatsachen’ zurückkehren sollte. Dabei stört den gegenwärtigen Realisten kaum, dass Platon wohl eher das Gegenteil emanzipieren will und dies, würde man die Polemik nicht scheuen dürfte man es anfügen, wohl gerade aufgrund seiner Bodenhaftung.[4]
Zwar lässt sich die ,Rückkehr zur Realität’ argumentativ nur untermauern, indem man die klassische ,Wahrheit’ als Zufluchtsort dem Rückzug hinterlegt, demgegenüber jedoch wähnte der ,wahre’ Platoniker gerade auf jenem ,Boden’, dem tiefsten Höhlenboden nämlich, die in der menschlichen Seele verankerten ,Ideen’ am gründlichsten aus dem Blick verloren. Die Wahrheit scheidet sich im platonischen Begriff der ,Idee’ prinzipiell von ihrer Wahrnehmung. Es ist in seinem Verständnis durchaus nicht mehr die Projektionsfläche der Schatten, die Höhlenwand, über deren genaue Betrachtung man letzt(end)lich zur Wahrheit gelangt, ,Ideen’ erschließen sich vielmehr über die Reflexion. Der platonische Erkenntnisweg kehrt die Blickrichtung um und führt den Philosophen (zum wohl ersten Mal) nurmehr ins eigene Innere.
„Ich vermag noch nicht gemäß dem delphischen Spruche mich selbst zu erkennen. Lächerlich aber scheint es mir, solange man dies nicht kennt, das Fremde zu erforschen.“ (PLATON 1979, S.19)
Nun wollen wir Platon nicht ohne Bedenken die Erfindung der Wahrheit ans Revers heften, zum einen, weil kaum nachzuvollziehen ist, wo sie entstand, zum anderen, weil eben die platonische Wahrheit sich ihrer ,Erfindbarkeit’ kategorisch entzieht. (siehe unten) Tatsächlich taucht im Alten Testament der Bibel - das hier ruhig exemplarisch stehen darf, schon weil wir der Argumentation entsprechend ohnehin weder chronologisch noch genetisch etwas beweisen können - der Begriff der ,Wahrheit’ nur an einer Stelle auf. (psalmen 15,2) Dort nimmt er in etwa die Stelle ein, die wir gegenwärtig mit dem Begriff ,Ehrlichkeit’ bezeichnen würden.[5] Weiterhin findet sich bei Mose (2. mose 20,16/ 3. mose 19,11F) bekanntlich zweifach die Aufforderung, kein falsches Zeugnis abzulegen, wider den Nächsten.[6] Wahrheit wird also personal zugeschrieben, und bezeichnet im modernen Sinn eher die Begriffsinhalte ,Treue, Offenheit, Ehrlichkeit, Beständigkeit, Verlässlichkeit bzw. Zuverlässigkeit’. Wer in diesem Sinne ,wahr’ ist, muss längst nicht weise sein.
Platons Ideenwelt entwickelt vor diesem Hintergrund innovative Impulse zur Abstraktion und Objektivierung. Nicht nur, dass die ,Wahrheit’ von der Person und ihrer Wahrnehmung getrennt wird, sie entwickelt geradezu dynamische Tendenzen, sich selbst zu verteidigen, um (im zitierten Fall) nur an der Verteidigung des Sokrates zu scheitern, der sich in dieser Hinsicht, gleich Platon, sichtlich nicht ganz auf ihre Macht verlassen will:
„Welche Wirkung, Männer von Athen, meine Amkläger auf euch ausgeübt haben, weiß ich nicht. Denn ich selbst hätte unter ihrem Eindruck beinahe mich selbst vergessen, so bestechend sprachen sie. Indes, die Wahrheit haben sie eigentlich keinen Augenblick lang gesagt. (...) Von mir aber bekommt ihr jetzt die ganze Wahrheit zu hören - nicht, bei Gott, ihr Männer von Athen, mit schönen Reden, die, wie die von denen dort, mit kunstvoll gedrechselten Worten und Wendungen aufwarten; ihr bekommt vielmehr zu hören, was mir gerade einfällt, in ungesuchten Ausdrücken (ich bin nämlich überzeugt, daß ich in der sache recht habe), und niemand möge anderes von mir erwarten. Es nähme sich ja auch seltsam aus, wenn jemand in meinem Alter, als wäre er ein Knabe, mit Künsteleien vor euch träte.“ (PLATON 1987, S.3)
Diese sokratische Selbstinszenierung der eigenen ,Nacktheit’ kann man in einer theaterwissenschaftlichen Arbeit nurmehr für das Größte unterbrechen, um sich beispielsweise im Gefolge der Götterkarren vor die „Schau des Wahren“ führen zu lassen und endlich zu sehen:
„Es ist die Natur der Schwinge, durch ihre Kraft das Schwere in den Äther zu erheben und bis zu dem Orte zu tragen, wo das Göttergeschlecht haust. (...) Er aber, des Himmels großer Fürst Zeus, den geflügelten Wagen lenkend, fährt als erster dahin, der All-Ordnende und All-Waltende. Ihm folgt sodann in elf Scharen geordnet das Heer der Götter und Dämonen. Hestia nämlich bleibt allein im Götterhause. (...) Wenn aber die, die unsterblich heißen an den Gipfel gelangen, wenden sie nach außen und halten auf dem Rücken der Himmelskugel , und während sie stehen, schwingt sie die Umdrehung im Kreise mit sich: Sie aber schauen, was jenseits des Himmels ist.“[7] (PLATON 1979, S.44F)
Was sie sehen?
„’Was nun hingegen allein wahrhaft Seiend (...) genannt werden kann, weil es IMMER IST, ABER NIE WIRD, NOCH VERGEHT: das sind die realen Urbilder (...): es sind die ewigen Ideen, die Urformen aller Dinge. Ihnen kommt KEINE VIELHEIT zu: denn jedes ist seinem Wesen nach nur Eines, indem es das Urbild selbst ist, dessen Nachbilder, oder Schatten, alle ihm gleichnamige, einzelne, vergängliche Dinge derselben Art sind. Ihnen kommt auch kein ENTSTEHEN UND VERGEHEN zu: denn sie sind wahrhaft seiend, nie aber werdend, noch untergehend, wie ihre hinschwindenden Nachbilder. (In diesen beiden verneinenden Bestimmungen ist aber nothwendig als Voraussetzung enthalten, daß Zeit und Raum und Kausalität für sie keine Bedeutung noch Gültigkeit haben, und sie nicht in diesen dasind.) Von ihnen allein daher giebt es eine eigentliche Erkenntniß, da das Objekt einer solchen nur Das seyn kann, was immer und in jedem Betracht (also an sich) ist; nicht Das, was ist, aber auch wieder nicht ist, je nachdem man es ansieht.’ - Dies ist Platons Lehre.“ (SCHOPENHAUER 1859/1988, S.236)
(2) Von der Unmöglichkeit zur Veränderung
Wendet man den durchschauenden Blick nun vom Himmelsgewölbe wieder der Erde zu, in Spezifik unserem zurückgebliebenen Flötisten, so wird uns die Unmöglichkeit seiner Kunst deutlich. Hätte über der Polemik des Platon seine Rede von ,nachahmenden’ Künsten uns für die Problematik sensibilisiert, so würde uns spätestens Schopenhauer ans Licht geführt haben: Die Musik lässt sich nicht als Imitation externer Ideen darstellen und insofern gebührt der Musik der Stellenwert einer eigenen ,Idee’, der ihre Produktion von drittklassiger (künstlerischer) Reproduktion zu echter Handwerksarbeit avancieren lässt.
Damit akzentuiert Platon die Unveränderlichkeit seiner Ideenwelt, die ja schon als Prinzip alles Denkbare enthalten muss und verhindert kategorisch den Einbruch des Menschen in die Realität mittels Erfindung, Schaffung oder Herstellung alternativer ,Ideen’.
“Die Ideenlehre selbst, in ihrer ontologisch-ethischen Doppelfunktion, macht diese Feststellung unumgänglich: die Ideen sind ja nicht nur Vorlagen, wie dieses Werk gemacht werden kann, sondern zugleich verpflichtende Normen, daß es so gemacht werden soll. Daraus folgert Plato schnell sowohl die Einzigkeit des realen Kosmos als auch seine Vollständigkeit hinsichtlich des idealen Modells.“ (BLUMENBERG 1956/ 1996, S.69F)
Welches Problem man in der deterministischen Entmachtung der Menschheit entdecken kann, ist uns heute bekannt. Welches Problem sich eben im Denken der menschlichen Kreation verbirgt, weitgehend unbesprochen. Jeder realistischen Philosophie bleibt der schöpferische Mensch, den angekoppelten humanistisch-marxistischen Bedenken der neuzeitlichen Menschlichkeitsdefinitionen mittels Naturbeherrschungs und - veränderungsfiktion zum Trotz, in erster Linie paradoxe Bedrohung des ideellen Seins. Der Mensch, einmal vom wahrnehmenden Zugang zur Realität separiert, darf um nichts in der Welt wieder einen aktiven Part im Schutzbereich der ,reinen Wahrheit’ spielen, da er als neutral Beobachtender ansonsten auch seine Beobachtung in den Prozeß der Weltentstehung involvieren würde und die gemachte Veränderung in dieser Hinsicht willkürlich erschiene. In Differenz etwa zum mittelalterlichen Verständnis von ,bildunge’, dem religiösen Vorläufer der ,Bildung’, als Gestaltung des Menschen in Richtung auf die göttliche Determination seiner Welt gibt es bei Platon nicht einmal ,Gestaltungszielsetzungen’ für den menschlichen Eingriff.
“Jedenfalls haben schon Platons nächste Schüler, wie uns Alkinoos berichtet, geleugnet, daß es
Ideen von Artefakten gäbe.” (SCHOPENHAUER 1859/ 1988, S.284)
(3) Welches Problem einer haben dürfte...
Diese gemachten Setzungen ziehen nun nach sich, dass der seiner ,Schattenwelt’ verhaftete Mensch zunächst nicht die geringste Möglichkeit auf ,Erkenntnis’ im ,eigentlichen’ Sinne erhalten kann und man wird einem Autor dieser ,unrealen Lebenswelt’ zumindest unterstellen müssen, er habe einen guten Grund für diese Entscheidung gehabt, nicht zuletzt um ihn dem Vorwurf der Subversion zu entziehen, der solch einem Entwurf ansonsten kaum zu ersparen wäre, unterläuft das gezeichnete Bild die Lebenswelten doch kategorisch zugunsten transzendentaler Ordnung.
,Natürlich’ ging es Platon um das einfache Problem, wie Dinge von Subjekten in Gruppen zusammengefasst werden können. Es ging darum, warum ein Mensch, unabhängig von materieller Identität von zwei Gewächsen relativ klar sagen kann, dies ist ein Baum und ebenso jenes andere, während vom Haus, weiter hinten an der Strasse, dasselbe nicht behauptet werden wird. Und vielleicht ging es noch darum, sicherzustellen, dass alle Menschen diese Unterscheidung immer, eindeutig und übereinstimmend würden treffen können.
Die Lösung war schließlich, jenseits der Erscheinung das Vorbild in Form der klaren, schönen Idee des Baums vorzustellen, dessen bloßes Abbild wir in irdischer Gestalt zu sehen bekommen. Ihre Evidenz liegt in der leichten Kommunizierbarkeit; das vage Versprechen besteht in einer höheren Ordnung der Dinge, die, obschon verborgen, durch ihre irdischen Ableitungen hindurch erinnert (und postuliert) werden kann. Es ist ein Hinweis auf eine Bedeutung, eine Sehnsucht der Dinge nach ihrem Ursprung, die jenseits ihrer Oberfläche liegt und jede Festlegung prinzipiell überschreitet. Es geht um einen allgemeinen, objektiven und universellen Ordnungsanspruch, der sich andererseits - diesseits nämlich - nur auf eine theatrale Wiederkehr in Form der Metapher stützen kann.
Diese Motivation einer universellen Ordnung kehrt aber nun, dem platonischen Ideenkomplex sei Dank, spätestens in systemtheoretischer Codierung in das hierarchische Machtsystem zurück, dem solche Ordnung prinzipiell eher als der Philosophie zugehörig erscheint. Ordnung ist in mehr als einer Hinsicht eine Machtfrage, drängt sich kategorisch in die ,Politik’. Dort wird sie, bleibt sie bzw. war sie stets einer Sehnsucht nach Gerechtigkeit verbunden - und Platon muss die Pascalsche Feststellung vorausgeahnt haben, wenn er im Kern der Dinge bezweifelt, dass Demokratien überhaupt von der medial und rhetorisch beeinflußbaren Massenentscheidung unabhängige Gerechtigkeitsdispositive zur Verfügung halten können.
„Man muss also Gerechtigkeit und Gewalt vereinen, und um das zu erreichen, muß Gewalt haben, was gerecht ist, oder es muß gerecht sein, was Gewalt hat. Die Gerechtigkeit ist umstritten. Die Gewalt ist sehr klar erkennbar und nicht umstritten. Daher hat man der Gerechtigkeit keine Gewalt geben können, weil die Gewalt der Gerechtigkeit widersprochen und behauptet hat, diese sei ungerecht, und weiter, sie selbst sei gerecht. Und da man somit nicht erreichen konnte, daß Gewalt hat, was gerecht ist, hat man erreicht, daß gerecht ist, was Gewalt hat.” (PASCAL 1687/ 1987, S.57)
Endlich im Kern dessen, worum es hier geht:
„Und wenn er dort wieder im Unterscheiden der Schatten mit jenen Gefesselten wetteifern müßte, zur Zeit, da seine Augen noch geblendet sind und sich noch nicht umgestellt haben - und diese Zeit der Gewöhnung wird nicht kurz sein! - würde er da nicht ausgelacht werden und bespöttelt, er sei von seinem Aufstieg mit verdorbenen Augen zurückgekehrt; daher sei es nicht wert, den Aufstieg auch nur zu versuchen. Und wenn er sie dann lösen und hinaufführen wollte, würden sie ihn töten, wenn sie ihn in die Hände bekommen und töten könnten!” (PLATON 2001A, S.330)
,Wie SIE’, liesse sich zwanglos anfügen, ,Sokrates selbst, vor den Augen des protokollierenden Autors Platon, bereits getötet hatten!’ und mithin geht es plötzlich um die Legitimation seiner eigenen Figur, des Sokrates, die er gegen die Entscheidung des Volkes aufrecht zu erhalten hat, die aber der demokratischen Grundlage entbehrt. Und es fällt Platon so schwer wie jedem anderen konsequenten Denker, sich in einer Demokratie gegen die herrschende Meinung zu legitimieren. Wie kann sich derjenige Irren, der die Gerechtigkeit macht, als einzig in der Feststellung, dass er keinen Einfluß auf die ,wahre’
Gerechtigkeit nehmen kann? Und nach diesem festgelegten Muster argumentiert die Wissenschaft seit Platon: Mit wissenschaftlicher Wahrheit.[8]
(4) Metaphorik zwischen Volk und Göttern
In jenem explizierten Kraftfeld zwischen Realität, Lebenswelt und Volkesmeinung verliert die Metapher nun ihre Flexibilität, findet den ambivalenten Ort, an dem Platon sie numehr verwenden kann. Auch sie ist in diesem Geflecht ,Idee’ geworden, insoweit sie sich für den eingenommenen Raum in der neuen Ordnung der Dinge zu legitimieren hat. Die Kunst der Metaphernschöpfung findet sich - und man kann erahnen, warum dies im Quelltext keiner Ausführung gewürdigt wird - im Zwischenraum, man könnte sagen auf der Bühne der Ereignisse, dort, wo die Träger, jene platonischen Ideen vor den Feuern schwenken. Einerseits nämlich vertritt sie die konkreten Ideen, die selbst dem Autor gegenüber zunächst unerreichbar geblieben sind und somit nicht selbst, sondern nur qua Zeichen ,vertreten’ existieren, andererseits vermittelt die Metapher jene sokratische Position an das Volk, dessen Meinungen Sokrates zwar gleichgültig in jeder Bedeutung, Platon aber durchaus einen Seitenblick wert sind. Nicht ganz zu Unrecht bezweifelt er die Autonomie dessen, der die Wahrheit gesehen hat, vom ,Höhlenausflug’ jedoch zurückgekehrt, nunmehr in seinem ,wahren’ Wahn verbleibt.
Man darf sich selbst angelegentlich die Frage stellen, ob die durchschauende ,Weisheit’ des Sehenden dem nachfolgenden Ausschluß aus der Gesellschaft tatsächlich irgendwann adäquate Rezeptionsgewinne gegenüberstellen konnte. Der individuelle Zweifel, den man daran haben kann, findet sich letztlich quer durch die Jahrtausende gerade bei jenen dokumentiert, die es - nach eigener Zuschreibung - jeweils ausprobiert haben wollen. Dass indessen der Denker gegenwärtiger Realität nicht einmal qua genialischer Legitimation, etwa durch Nietzsche, eine ,Wahrheit’ oder ein ,Recht’ einzuklagen legitimiert wird, darf weiterhin - gerade bei jenen, die es immer angeht - als Allgemeinplatz gelten.
Bild vom Bilde
Versteht man, der griechischen Verwendung folgend, die ,Idee’ (idea) nun als Übersetzung für ,Bild’ wird die schon erwähnte Doppelfunktion der Metapher deutlicher.
„Die idea (das griechische Wort für ,Bild’) kritisiert allemal die nicht an sie heranreichende Erscheinung. Dies ist ja gerade der Grund, warum man ein Menschenbild hat oder sucht: Es soll Maß geben. Es gehört zum Grundwerkzeug des Pädagogen: Es hilft ihm fordern, beurteilen, beschämen; es erspart ihm physische Gewalt, indem es geistige Gewalt ausübt; es rechtfertigt, daß der, der es hat, den erzieht und bildet, der es noch nicht hat.“ (HENTIG 1996, S.24)
Nicht nur, dass die Metapher sich in diesem Kontext analog der Formulierung einer ,realeren Realität’ zum einen als Verdeutlichung des Konstruktcharakters der Ausführungen, zum anderen als tautologische Dopplung der Aussagekraft im Sinne einer Verbildlichung des Bildes verstehen lässt. Ihre Funktion wird vor Allem werden, die bildliche Darstellung des Bildes zu ersetzen, das nicht darstellbar ist, weil es dem Zugriff prinzipiell entzogen bleibt.
Es tritt das Bild einer Erkenntnisstruktur an die Stelle der begrifflichen Inhalte, der Pädagoge (paeideos) Sokrates vermittelt dem Schüler Einblick, nicht in seine reale Realität, sondern in die Modellierung ihrer Rekonstruktion qua philosophisch-sokratischer Reflexion. Falls Sokrates seine Höhle verlassen hatte, so lässt er den Zuhörer (Glaukon) darüber letztlich im Unklaren, geht es doch nicht um seine, des Sokrates Bildung, sondern um diejenige, die er - vorerst durch den Entscheid des Orakels legitimiert - Glaukon zuteil werden lassen darf.
„’Und nun’, fuhr ich fort, ,mache ich dir den Unterschied zwischen Bildung und Unbildung in unserer Natur an dem folgenden Erleben gleichnishaft klar. Stelle dir die Menschen vor in einem unterirdischen, höhlenartigen Raum, der gegen das Licht zu einen weiten Ausgang hat über die ganze Höhlenbreite; in dieser Höhle leben sie von Kindheit, gefesselt an Schenkeln und Nacken, so daß sie dort bleiben müssen und nur gegen vorwärts schauen, den Kopf aber wegen der Fesseln nicht herumdrehen können; aus weiter Ferne leuchtet von oben her hinter ihrem Rücken das Licht eines Feuers, zwischen diesem Licht und den Gefesselten führt ein Weg in der Höhe; ihm entlang stelle dir eine niedrige Wand vor, ähnlich wie bei den Gauklern ein Verschlag vor den Zuschauern errichtet ist, über dem sie ihre Künste zeigen.’ ,Ich kann mir das vorstellen.’, sagte Glaukon. ,An dieser Wand, so stell dir vor, tragen Menschen mannigfache Geräte vorbei, die über die Mauer hinausragen, dazu auch Statuen aus Holz und Stein von Menschen und anderen Lebewesen, kurz, alles mögliche, alles künstlich hergestellt, wobei die vorbeitragenden teils sprechen, teils schweigen.’ „Merkwürdig sind Gleichnis und Gefesselte, von denen du sprichst.’ ,Sie gleichen uns! Denn sie sehen zunächst von sich und den anderen nichts außer den Schatten, die von dem Feuer auf die gegenüberliegende Wand geworfen werden, verstehst du?’ ,Natürlich, wenn sie gezwungen sind, ihre Köpfe unbeweglich zu halten ihr Leben lang.’ „Dasselbe gilt auch von den vorübergetragenen Geräten, nicht?’ ,Gewiss!’ ,Wenn sie sich untereinander unterhalten könnten, da würden sie wohl glauben, die wahren Dinge zu benennen, wenn sie von den Schatten sprechen, die sie sehen.’ Notwendigerweise!’ Wenn nun weiter das Gefängnis ein Echo hätte, von der Wand gegenüber, und wenn einer der vorübergehenden etwas spräche, dann käme - so würden sie glauben - der Ton von nichts anderem als von dem vorübergehenden Schatten, nicht?’ ,Ganz so, bei Zeus!’ , Alles in allem: Diese Leute würden nichts anderes für wahr halten als die Schatten ihrer Geräte.’ Notwendigerweise!’ ,Überlege nun Lösung und Heilung aus Ketten und Unverstand, wie immer das vor sich gehen mag - ob da wohl folgendes eintritt. Wenn etwa einer gelöst und gezwungen würde, sofort aufzustehen und den Kopf umzuwenden, auszuschreiten und zum Licht zu blicken, wenn er bei alledem Schmerz empfände und wegen des Strahlenfunkelns jene Gegenstände nicht anschauen könnte, deren Schatten er vorher gesehen - was glaubst du, würde er da wohl antworten, wenn man ihm sagte, er habe vorher nur eitlen Tand gesehen, jetzt aber sehe er schon richtiger, da er näher dem Seienden sei und sich zu wirklichen Dingen hingewendet habe; wenn man ihn auf jeden der Vorbeigehenden hinwiese und zur Antwort auf die Frage zwänge, was das denn sei? Würde er da nicht in Verlegenheit sein und glauben, was er vorher erblickt, sei wirklicher als das, was man ihm jetzt zeige?’ ,Gewiß!’ ,Und wenn man ihn zwänge, ins Licht zu blicken, würden ihn seine Augen schmerzen, und fluchtartig würde er sich dem zuwenden, was er anzublicken vermag; dies würde er dann für klarer halten, als das zuletzt Gezeigte, nicht?’ ,So ist es!’ ,Wenn man ihn’, fragte ich weiter, ,von dort wegzöge, mit Gewalt, den schwierigen und steilen Anstieg hinan und nicht früher losließe, bis man ihn ans Licht der Sonne gebracht hätte, würde er da nicht voll Schmerz und Unwillen sein über die Verschleppung? Und wenn er ans Sonnenlicht käme, da könnte er wohl - die Augen voll des Glanzes - nicht ein einziges der Dinge erkennen, die man ihm nunmehr als wahr hinstellte.’ ,Nicht sofort wenigstens!’ ,Er brauchte Gewöhnung, denke ich, wenn er die Oberwelt betrachten sollte; zuerst würde er am leichtesten die Schatten erkennen, dann die Spiegelbilder der Menschen und der anderen Dinge im Wasser, später sie selbst; hierauf könnte er die Dinge am Himmel und diesen selbst leichter bei Nacht betrachten, aufblickend zum Licht der Sterne und des Mondes - als bei Tag die Sonne und ihr Licht.’ Natürlich!’ ,Zuletzt aber könnte er die Sonne, nicht ihr Abbild im Wasser oder auf einem fremden Körper, sondern sie selbst für sich an ihrem Platz anblicken und ihr Wesen erkennen.’ Notwendigerweise!’ ,Und dann würde er durch Schlußfolgerung erkennen, daß sie es ist, die die Jahreszeiten und Jahre schafft und alles der sichtbaren Welt verwaltet und irgendwie Urheberin ist an allem, was sie gesehen haben.’ ,Klar, so weit würde er allmählich kommen!’ ,Nun weiter!’ Wenn man ihn dann an seine erste Wohnung, an sein damaliges Wissen und seine Mitgefangenen erinnerte, würde er sich dann nicht glücklich preisen wegen seines Ortswechsels und die anderen Bedauern?’ ,Gar sehr!’ ,Wenn sie damals Ehrenstellen und Preise untereinander ausgesetzt haben und Auszeichnungen für den Menschen, der die vorbeiziehenden Gegenstände am Schärfsten erkannt und sich am Besten gemerkt hat, welche vorher und welche nachher und welche zugleich vorüberzogen, und daher am Besten auf das Kommende schließen könne, wird da nun dieser Mann besondere Sehnsucht nach ihnen haben und jene beneiden, die bei ihnen in Ehre und Macht sind? Oder wird es ihm gehen, wie Homer sagt, er begehre heftig / Arbeit um Lohn zu verrichten / Bei einem ärmlichen Mann auf dem Lande / und alles eher zu erdulden, als wieder nur jene bloßen Meinungen zu besitzen und auf jene Art zu leben?’ ,Lieber wird er alles über sich ergehen lassen als dort zu leben!’ ,Und dann überlege noch dies: Wenn ein solcher wieder hinabstiege und sich auf seinen Sitz setzte, hätte er da nicht die Augen voll Dunkelheit, da er soeben aus der Sonne gekommen ist?’ (PLATON 395 V.CHR/ 1982, S.327-330)
Man wird das Zitat in dieser Ausführlichkeit belassen müssen und sogar ergänzen durch eine Art von Selbstverständnis: Wer hier an ,Realität’ denkt, hat das phantomatische Spiel dieser ,realistischen’ Pädagogik schon verloren. Er endet in der seltsam verschachtelten Frage danach, wer hier am Ende was für ,wahr’ halten darf. Wer an ,Kunst’ erinnert wäre, hätte immerhin die Metaphorik der Gaukler bemerkt oder die paradoxe Virtualität jener aus der Menschheit getriebenen ,Menschen’, welche, als unsichtbare Schauspieler einer historisch frühgeborenen ,Kinematographie der Schatten’, - auf die im Übrigen sowohl im Originaltext, wie auch gegenwärtig allemal gesondert hinzuweisen bleibt - die Gegenstände an der philosophischen Wand vorübertragen. Gegen die soziale Theatralität jener verhüllten Erzieher verliert dann sogar der aus der Höhle vertriebene Weise jede Bedeutung, selbst in der spektakulären Inszenierung seiner gleichermaßen erleuchteten und geblendeten Heimkehr. Auf diesen drei verschränkten Ebenen lassen sich dem platonischen Bild hier theatrale Ebenen einzeichnen.
(1) Sokratischer Ausgang - Platonische Rückkehr
Auf der ersten, motivatorischen Ebene geht es um eine durchaus literarische Position, aus der implizit die Sokratische Forderung[9] kristallisiert: Ich weiss, dass ich nichts weiss und folglich - sei es aufgrund der Irrtumswahrscheinlichkeit bei Orakelsprüchen, sei es einfach, weil ich intensiver als andere gezweifelt habe und für jeden anderen Fall mein absolutes Scheitern koinzedieren würde - müssen alle anderen noch weniger wissen. Und dabei spielt es dann keine Rolle mehr, dass ich fürs Weitere nicht lebensfähig bleibe, weil die erkannte ,Wahrheit’ die Lebenswelt überblendet. Die Ebenenverschiebung der Realität ins Reich der Ideen hat somit die Funktion, genau und präzise Einen zu inszenieren, der mehr weiß, weil genau er der Täuschung’ nicht aufsitzen durfte. Einer darf unter der Existenz leiden, ohne sofort als Versager abgestempelt zu werden. Aber: - in dubio contra reo - nur Einer und zur Selektion des Wahnsinnigen vom Genie müsste man wenigstens noch über den delphischen Apollon[10] verfügen.
Nicht nur deshalb muss Platon entschieden daran gelegen sein, die ,Ideenträger’, jene Gaukler nämlich, die das Schattenspiel im Kern veranstalten, als Halbweltler zwischen Idee und Schatten, in seinem Gleichnis vollständiger als das Opfer des Experimentes erblinden zu lassen, so vollständig, dass er ihre Wahrnehmung, derer sie - im verwendeten Ausdruck - als ,Menschen’ zuvor immerhin fähig gewesen sein mussten, nicht einmal erwähnt. Könnten sie nämlich sehen, was würden sie den im Kerker befindlichen Artgenossen zusätzlich zu sagen haben?
Um diese ,Schauspieler’ im wahren Sinn des Wortes muss man sich kurz bekümmern: Ihre Stimmen werden die Stimmen der Dinge, ihr Abbild wirft sich auf den theatralen Verhau, der zwischen sie und die Lebenswelt gestellt ist, ihre Wahrnehmung bleibt unerwähnt und ihr Dasein fristen sie auf dem Weg zwischen Höhle und Höhlenausgang, in einer sinnbildlichen Situation von Ambivalenz. Sie zeigen, sie demonstrieren, sie sprechen in Administration des Wahren, ohne darum Sorge zu tragen, wer sie werden und bleiben können. Dass sie dabei
nicht in Gefahr geraten, sich mit den Dingen zu identifizieren, die sie ,lediglich’ präsentieren sollen, danken sie vor allem der Unmöglichkeit jeder Identifikation auf dieser Ebene. Wer sollen sie sein? Was sollen sie bedeuten? Wie sollen die Gefangenen in der Höhle sie identifizieren?
(2) Zeichendeutungen und technische Finessen
Überhaupt ist bisher zu wenig Augenmerk auf die eigentliche (und unmögliche - s.s. iof) technische Ausstattung der platonischen Höhle gerichtet worden. Die ,künstliche Herstellung’ der Gegenstände, die vorübergetragen werden, deuten auf den Weltschöpfer hin, der neben den Gegenständen, aus welchem Grunde auch immer, die Höhlenanordnung geschaffen haben müsste.
Zuzurechnen ist ihm auch die Erstellung der Höhlenfeuer und zwar, als individuelles Charakteristikum, ,Feuer’ in der Mehrzahl, was sich dem Schöpfungsprinzip, der -wie erwähnt - einzähligen ,idea’ ganz offensichtlich entgegenstellt.[11] Wenn nämlich die ,Idee’ nur in der Einzahl vorkommt, so muss die Lichtquelle vervielfacht werden, um zu einer Mehrzahl an Abbildern zu gelangen. Diese Mehrzahl aber benötigt Platon, um zu vermeiden, dass sich sein Denken wieder in jene Einzähligkeit zurückbegibt, aus der es herauszuholen Begründungszusammenhang für die Metapher bleibt. Mithin gilt es, wo nicht die Gegenstände, doch wenigstens das Medium zu pluralisieren. Aus dem Kernschatten der Idee wird gleichzeitig ein vielfacher Schlagschatten, was der platonischen Welt nur entgegenkommt, insofern es die Bilder neben der gängig implizierten Farblosigkeit, kontrastärmer werden lässt.
Damit wird die Arbeit des Vorübertragens allerdings zur Technik (technae), erfordert sie doch plötzlich bewusste Aufmerksamkeit der Träger, um Überschneidungen der einzelnen Schatten zu vermeiden, die ja in der Schnittmenge einen Gegenstand erzeugen würden, dessen Vorbild und Urbild eine Kombinatorik mehrerer Gegenstände voraussetzte. Aus der reinen Projektionsanlage wäre eine Täuschungsanlage hervorgegangen, innerhalb derer sich das Subjekt der Projektion neu organisieren und in dieser Organisation änderbar zusammenfügen ließe. Das Medium selbst wird zum Erzeuger der Botschaften.
„Der Verbreitungsprozeß ist aber nur auf Grund von Technologien möglich. Deren Arbeitsweise strukturiert und begrenzt das, was als Massenkommunikation möglich ist.“ (LUHMANN 1996, S.13)
„Noch zwingender sind wir durch Bildervorrat und Bilderwahl bestimmt, ,kanalisiert’ in dem, was überhaupt sich uns zu zeigen vermag und was wir in Erfahrung bringen können:“ (BLUMENBERG 1998, S.92)
Die, an dieser Stelle im Sinne Blumenbergs, ,absolute’ Metapher verarbeitet demnach ihren paradoxen Entstehungszusammenhang durch Überqualifizierung des Klaren und relative Unklarheit bezüglich des paradoxen Kerns.
Urplötzlich darf nicht mehr als Zufall gelten, was uns so schien, dass nämlich Platon seine gesamte kinematografische Anlage unter die Erde verfrachtet hatte. Schwerlich lässt sich indes selbst metaphorisch behaupten, Platons Höhle käme der Entdeckung des Theaterbaus gleich, zum einen weil das antike Griechenland uns handfeste Zeugnisse seiner Fähigkeit zur Kopplung von Architektur und Theater hinterlassen hat, zum anderen weil sich eine Höhle entschieden höchstens graben, nicht aber bauen lässt. Demnach sind Höhlen nur sehr eingeschränkt überhaupt als Artefakt zu verstehen. Das mag für bedeutungslos halten, wer die metaphorische Ebene übersieht, der eben eine Metapher untersuchen will, darf es indes um so weniger ignorieren, als eben die Existenz früherer Theaterbauten doch impliziert, dass Platon mit seinem Gleichnis durchaus nicht auf unterirdische Beheimatung angewiesen war. Vielmehr geht es um den Naturbezug: Die Höhle selbst entsteht als Idee, nicht als Artefakt, kann somit entweder im Originalzusammenhang oder als Spiegelung der Urform auftauchen. Und je nachdem, wie wir es verstehen wollen, ändert sich die Bedeutungslage und Relevanz der Metapher im Komplex.
(3) Sokrates sein und Glaukon werden
Die dritte Ebene theatraler Ausformung könnte man, oberflächlich betrachtet, im dialogischen Aufbau der Textpassage zu finden erwarten, solange wenigstens, bis man im Versuch begreift, auf welche Weise der Text sich seiner Inszenierung auf dem Theater völlig entzieht und verschließt. Möglicherweise wäre noch die Rolle des Sokrates ihrer Ausformung durch einen Schauspieler inhaltlich wie formal gewachsen, spätestens an der Herausforderung des Glaukon scheiterte indes jede Spielkunst und -fertigkeit. Sokrates kann man sein, Glaukon allenfalls werden. In seiner lernenden Verstärkung ist Glaukon eine rhetorische Figur, seine Existenz unvorstellbar als körperliche oder dramaturgische Positionierung. Auch als lebensweltlich Erfahrender ist er undenkbar, weil er, ebenso wie der imaginäre Leser und vielleicht - in dieser historischen Nähe zum Ursprung der beschreibenden Sprache - als sein Statthalter eingesetzt, im eigentlichen Sinne keine Rolle zu spielen hat. Glaukon weiß, was Sokrates sagt, aber niemals etwas darüber hinaus. Er ist die logisch formatierte Einschreibungsfläche für die sokratische Argumentation und zwar idealiter als zuvor Unbeschriebene menschliche Vernunft gedacht. Glaukon ist ohne Inhalte und spaltet die Denkoperation von den weltlichen Inhalten.
Insofern spiegelt er als Replikant die Sentenz, sogar die rhetorische oder offene Frage des Älteren wider, ohne sie maßgeblich zu beeinflußen, bzw. eine Antwort anzubieten. In dieser Konstellation weiß er stets weniger als sein Lehrer, weil die Quelle dessen, was er wissen kann eben nur in diesem Lehrenden insistiert: Glaukon weiß nur, was Sokrates ihm bereits gesagt hat. Mithin entwickelt Glaukon das Wissen des Sokrates gleich dem Leser, und im Gegensatz zu ihm ohne eine weitere Informationsquelle.
Man kann das provokativ noch steigern und feststellen, dass das Wissen des Sokrates selbst durch Glaukon nur hindurchgehen dürfte, als ein vorüberziehendes, klares Bild, kann er doch den Gedanken nicht behalten, insofern seine Funktion, die Weiterreichung des Gedachten an den Lesenden, eben erfordert, dass der ,reine’ Gedanke, die ,idea’ unvermittelt und unverarbeitet durch den Replikanten diffundiert.
Die Figur des Glaukon selbst avanciert damit, in ihrem vorübergehenden und analogen Wissensstand, zur theatralen Metapher für den Leser und vervollkommnet das Bild der Lesesituation im Text selbst. Der Akt des Lesens wird zur Metahandlung, die den Rezipienten in eine unausfüllbare Rolle drängt. Künftig wird das ihn zum Widerspruch reizen, die Wirkung in der antiken Gegenwart bleibt uns unzugänglich.
Die sich darin kristallisierende Überbetonung des real vorstellbaren Modellbildes gegenüber der wahrgenommenen Welt ist es schließlich, die den eigentlichen ,Sinn’ der platonischen Konstruktion erstellt. Und wäre die Metaphorik an dieser Stelle nicht vor das unlösbare Problem der Weltexistenz gestellt, leicht ließe sich abstrahieren hin zum Beweis für die Unmöglichkeit allen Seins. Umformuliert implizierte dies die Behauptung, der Philosophie wäre der globale Beweis wohl von Anbeginn leichter gefallen, wenn sie nicht als Voraussetzung der eigenen Überlegung existierte.
Idealiter ist Wolfgang Hogrebe dann noch immer zuzustimmen, wenn er schreibt:
„Die Philosophie ist bloß die methodische Institution unserer Fraglichkeitsnatur, die prinzipiell nichts Unbefragtes, nichts Unbefragbares hinter sich weiß. Die Möglichkeit der Philosophie ist so in einer absoluten Annulierung von Sinn verankert und zwar einfach dadurch, daß sie Sinnsubstanzen gleich welcher Art prinizipiell in Frage stellt, um nach ihnen als Verlorenen zu suchen.“ (HOGREBE 1992, S.9)
Faktisch bleibt der Philosophie im Zweifel am eigenen Sein jene Grenze eingeschrieben, die selbst ein platonischer Weiser nicht zu überschreiten vermöchte. Es ist ihr mithin unmöglich geblieben, von ihrer Existenz - und damit von Existenz an sich - abzusehen. Der Diskurs über die Berechtigung ihres Aufwands bliebe demnach lediglich die Operation, mit der die Philosophie das Problem dieser faktischen Undenkbarkeit internalisierte. Und in der kühnen Kehrtwende zu jener Tautologie, die besagt, dass man mit dem leben müsse, wovon sich keinesfalls absehen lasse, kristallisierte zwar die unmittelbare Enttäuschung für jenen konsequenten Idealisten, der die Neuordnung der Wahrheit auch künftig angehen wollte. Für den Alltagsgebrauch aber mag darin die durchaus amüsante Gewissheit zu neuer Bedeutung finden, dass es sich gerade und ausschließlich unter diesen Umständen immer wieder lohnen dürfte, vom Morgen selbst zu erfahren.
Realere Realitäten
Das erste Computerspiel programmierte Willy Higinbotham im Jahre 1958 unter dem Titel ,Tennis for two’. Das Spiel, das zuerst kommerziell verwertet wurde, hieß ,Space War’ und wurde durch die Firma ,Nutting Associated’ unter dem Titel ,Computer Space’ erst 1971 und damit rund acht Jahre nach seiner Entwicklung, in den entstehenden Markt für ,Computersoftware’ eingeführt. Für den Neuling in Sachen digitalen Amüsements ging es darum, ein eher symbolisches Raumgefährt durch ein ebenso symbolisches All zu manövrieren und dabei (feindliche) Flugobjekte zu zerstören und der ökonomische Fehlschlag der Konsolenanwendung hinderte die Autoren, Nolan Bushnell und Ted Dabney nicht, ein halbes Jahr später die Firma ,Atari’ zu gründen, um schließlich mit dem Ballspiel ,Pong’ den Grundstein für ein Wirtschaftsimperium professionell simulierter Welten zu legen. 1972 entstehen gerade einmal zwei Erweiterungen der Angebotspalette. 1973 sind es bereits 36 neue Vertreter, 1980 dann 105, die bis dahin nahezu alle erdenklichen Simulationsszenarien abdecken, beginnend bei verschiedenen Mondlandungen über diverse Kriegsszenarien bis hin zu Sportspielen. Endlich wurden sogar völlig erdachte Welten in den phantastischen Raum komponiert.
Man mag es anbei für bloßen Zufall halten, dass die erste vermarktete Simulation ihre Cyberpiloten ausgerechnet in die Sterne schicken musste, gerade als hätte die philosophische Tradition zwischen Ptolemäus und Kopernikus die unendliche Leere zwischen den Planeten nur als Spielplatz für menschliche Phantasien entwickelt. Phantasien im Übrigen, die eben dieses Raums gar nicht bedurften, sondern sich zu diesem Zeitpunkt bereits problemlos in ein Wohnzimmer integriert hätten. Man mag denselben Zufall gleich noch in die Welt der mythischen Symbole holen und in der schwarzen Hintergrundmaske die Metapher für die unendlichen Möglichkeiten einer neuen Technologie entdecken. Schließlich könnte man bei etwas näherer Betrachtung zu der Vermutung gelangen, die Tagesaktualität nach Sputnikschock und amerikanischem Rückschlag mittels Mondlandung habe die Phantasie der Programmierer angeregt.
Indessen kann es bei der Konzeption immerhin eine Rolle gespielt haben, dass sich das Weltall in allen Details so magisch ,naturgetreu’ auf einen Bildschirm übertragen lässt, ganz ohne dass man sich den perspektivischen Problemen zu stellen hätte, die in der Reduktion der Dreidimensionalität verborgen liegen und die nicht ausschließlich im Kunstbereich einen Jahrtausende währenden Diskurs notwendig gemacht hatten, sondern selbst noch in der modernen Astronomie Erkenntnisproblematiken etabliert. Damit wäre die Geschichte der Digitalisierung von Realität initial in ein mediales und astronomisches Problemfeld verstrickt, das zuvor keinen Tag weniger als 18 Jahrtausende überdauert hatte. Und nachgerade urplötzlich träte eine historische Differenz in den Vordergrund, die man zunächst lieber vergessen gewusst hätte: Es macht entschieden einen Unterschied aus, ob man eine Höhlenwand dekorieren oder einen Büffel zeichnen will - symbolisch, metaphysisch, technisch und ästhetisch.
Wenigstens in dieser seltsamen Konstellation bedeutender Worte wird hernach evident, dass es in der Geschichte der ,virtuellen Realität’ niemals um die Darstellung von Büffeln ging und sicherlich auch nicht direkt darum, die Realität mittels Abbild rituell zu beeinflussen. Man hat sich gegenwärtig weitgehend von Kulturtechniken verabschiedet, die auf einer transzendenten Verbindung zwischen Abbild und Vorbild beruhen und bevorzugt in technischer Hinsicht seitdem eher die Implikation, die unmittelbare Verkettung von Ursache und Wirkung. Wenn im Cyberspace, gattungsspezifisch zugespitzt, jeder zehnte Mensch bereits ein Moorhuhn geschossen hätte, so ginge es wohl nur den allerletzen Mohikanern darum, das Tier hinterher zu verspeisen, selbst wenn die Jagd als solche weiterhin Motiv und Motivation der interaktiven Darstellung geblieben wäre. Das Spezifikum, das erlaubt, über den Jagderfolg zu entscheiden, verschiebt sich tendenziell ins Innere der sogenannten Psyche.
Es mag für den einen oder anderen - nur darauf läuft es schließlich hinaus - tatsächlich eine Welt geben, die eventuell gar nicht so ist, wie sie uns erscheint. Eine solche Metaphorik zu bestreiten fehlte mir jedenfalls nicht nur die notwendige Argumentationsgrundlage, sondern gleichermaßen die moralische Berechtigung. Es interessiert mich aber auch nicht. Wesentlicher erscheint da schon die Frage, der sich jede derartige Metaphysik würde stellen müssen, wenn nämlich die Realität nicht das wäre, als was sie uns erscheine, was sie denn dann, und im Ausschluß dogmatischer Feststellung, was sie ,allgemein’ und ,populär’ sein könnte. Entschieden kann es der gegenwärtigen Mediendemokratie, so sie nicht eine Metapher bleiben will, nicht darum gehen, diese Entscheidung einem Einzelnen zu überlassen, gleich ob er in dieser Kompetenz Wissenschaftler, Künstler, Politiker oder Philosoph genannt würde.
Letztlich geht es darum, Sokrates seinen Giftbecher trinken zu lassen, wie er es selbst freimütig anbietet, insbesondere, wo es der Gesellschaft unmöglich bleiben wird, ihrerseits Fehler zu machen. Selbst im Nachhinein bleibt die Entscheidung der Mehrheit stets das Gute, insofern auch die Gesellschaft nicht in der Lage sein dürfte, von sich selbst abzusehen. Nicht einmal die Moral kann von sich absehen, obgleich, hier liegt der evidente Vorteil, der Mensch, die Vernunft und die Gesellschaft, dazu allerdings - und man darf dies für ein, das einzige Wunder der Philosophie halten - in der Lage sind.
Das alles will nicht heißen, dass man an irgendeiner Stelle aufhören müsste, zu denken oder die Welt mit der eigenen Kreativität etwas zu ergänzen. Im Gegenteil, dem Weltreduzierer ,Mensch’ steht es - in seiner Selbstbewertung - gelegentlich ganz gut an, die entstandenen Diversitätslücken durch ,Kultur’ wenigstens notdürftig zu überdecken. Überdies kann man historisch kaum leugnen, dass sich selbst die Welt der Erscheinungen philosophisch - z.B. eben durch Platon - durchaus weiterschreiben, umschreiben und restrukturieren ließ, nicht ohne dass sie dabei ganz erhebliche Änderungen erfahren hätte und daraus folgern, dass es eventuell auch gegenwärtig funktionieren würde. Indessen bedeutet es auch nicht weniger, als dass man an dieser Stelle aufhören kann und dass man es willkürlich tun kann, z.B. einfach um der Versuchung zu entgehen, immer wieder bei jenen Ideen (oder Metaideen) anzukommen, bei denen man irgendwann vor langer Zeit begonnen hat: Die virtuelle Realität bleibt ein Paradox oder eine Tautologie, je nachdem, ob man Realität platonisch oder sozial versteht. Die ,reale Realität’ aber, die auf ihrer Gegenseite in der Kommunikation unumgänglich - inzwischen oftmals sogar explizit - mitgeführt wird, bleibt jenseits ihrer Tautologie, gerade in ihrer Dopplung philosophisch allemal subversiver, als man zunächst angenommen hätte: Die Trennungslinie, der Vorhang zwischen Wahrnehmung und Realität wird in der doppelten Spiegelung nicht nur in den Blick genommen, sondern zudem, als Negation der Negation gleichsam rekursiv ausgelöscht. Und dann fragt man sich plötzlich: Ist das noch jenes (Welt-)Theater?
Von diesem Zweifel aus kann man endlich nachvollziehen, warum ich diese Zusammenhänge beschreiben mußte, ging es doch um nichts mehr oder weniger als darum, schließlich und am Ende meiner Theaterstudien zurückzugewinnen, was ich, sowohl metaphorisch als auch in Form eines realen Selbstverständnisses bereits zu Beginn der Studienzeit gehabt hatte: Meine Scheinfreiheit. Und es läßt sich auch begreifen, dass ich, im Erreichen dieser Determination über das Weitere vorerst schweigen werde.
Literatur
Blumenberg, Hans 1956/ 1996: „Nachahmung der Natur - Zur Vorgeschichte des schöpferischen Menschen" in: „Wirklichkeiten in denen wir leben" S.55-103; Stuttgart, Reclam.
Blumenberg, Hans 1997: „Ein mögliches Selbstverständnis"; Stuttgart, Reclam.
Blumenberg, Hans 1998: „Paradigmen zu einer Metaphorologie"; Frankfurt a.M., Suhrkamp.
Erasmus von Rotterdam 1511/ 1975: „Lob der Torheit" in: „Ausgewählte Schriften in 8
Bänden" Bd. 2; Darmstadt, Hrsg.: Werner Welzig.
Grotowski, Jerzy 1968/ 1994: „Akropolis: Umgang mit dem Text" in: „Für ein Armes Theater" S.65-84; Berlin, Alexander, Hrsg.: Eugenio Barba.
Heidegger, Martin 1950/ 2001a: „Der Ursprung des Kunstwerkes"; Stuttgart, Reclam, Hrsg.: Hans-Georg Gadamer.
Heidegger, Martin 1954/ 2001b: „Was heißt Denken?"; Stuttgart, Reclam, Hrsg.: Heinrich Hüni.
Hentig, Hartmut von 1996: „Bildung - ein Essay"; Weinheim/ Basel, Beltz.
Hogrebe, Wolfgang 1991: „Metaphysik und Mantik - Die Deutungsnatur des Menschen
(Systeme orphique de léna)"; Frankfurt a.M., Suhrkamp.
Foucault, Michel 1974/ 1997: „Die Ordnung der Dinge - Eine Archäologie der Humanwissenschaften"; Frankfurt a.M., Suhrkamp.
Lem, Stanislaw 1964/ 1984: „Phantastik und Futurologie" Band I; Frankfurt a.M., Suhrkamp.
Luhmann, Niklas 1996: „Die Realität der Massenmedien"; Opladen, Westdeutscher Verlag.
Luhmann, Niklas 1988/ 2001: „Erkenntnis als Konstruktion" in: „Aufsätze und Reden" S.
218-242; Stuttgart, Reclam, Hrsg.: Oliver Jahraus.
Luther, Martin 1534/ 1985: „Die Bibel - Nach Martin Luthers Übersetzung neu bearbeitet“; Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft.
Macrone, Michael 1998: „Heureka - Das Archimedische Prinzip und 80 weitere Versuche, die Welt zu erklären“; München, DTV.
Münz, Rudolf 1998: „Theater und Theatralität der französischen Revolution“ in: „Theatralität und Theater - Zur Historiographie von Theatralitätsgefügen“; Berlin, Schwarzkopf&Schwarzkopf, Hrsg.: Gisbert Amm.
Pascal, Blaise 1687/ 1987: „Gedanken - Pensées“; Leipzig, Reclam, Hrsg.: JeanRobert Armogathe.
Platon ca. 400 v.Chr/ 1979: „Phaidros - oder Vom Schönen” S.59-93; Stuttgart, Reclam, Hrsg.: Kurt Hildebrandt.
Platon ca. 380. v.Chr/ 1987: „Apologie des Sokrates/ Kriton”; Stuttgart, Reclam, Hrsg.: Manfred Fuhrmann.
Platon ca. 390 v.Chr/ 2001a: „Der Staat - (Politeia)” 7. Buch/ S. 327-363; Stuttgart, Reclam, Hrsg.: Karl Vretska.
Platon ca. 390 v.Chr/ 2001b: „Der Staat - (Politeia)” 10. Buch/ S. 431-467; Stuttgart, Reclam, Hrsg.: Karl Vretska.
Schopenhauer, Arthur 1859/ 1988: „Die Welt als Wille und Vorstellung“ in: „Arthur Schopenhauer - Werke in fünf Bänden“ Band I; Zürich, Haffmanns, Hrsg.: Ludger Lütkehaus.
Schramm, Helmar 1996: „Karneval des Denkens - Theatralität im Spiegel philosophischer Texte des 16. und 17. Jahrhunderts“; Akademie, Berlin, Hrsg.: Eberhard Lämmert.
Weischedel, Wilhelm 1975: „Die philosophische Hintertreppe - 34 große Philosophen in Alltag und Denken“; München, DTV.
[...]
[1] Der Gedanke von der Unwirklichkeit der Wirklichkeit scheint sich stufenweise zu verschärfen, findet sich als solcher bereits bei Parmenides, jedoch nicht in sokratischer Prägnanz eines Höhlengleichnisses. (VGL. MACRONE 1998, S.38)
[2] Der Begriff der Phantomatik bezeichnet hier etwas, das heute gängig mit ,virtual reality’ umschrieben wird: „Lassen wir in einer Welt, die für ihre Bewohner die einzige Wirklichkeit ist, eine Technik entstehen, die es ermöglicht, diese Wirklichkeit durch eine völlige Illusion zu ersetzen. Prototyp könnte z.B. eine Maschine sein, die mit einem individuellen Gehirn rückgekoppelt ist. Das Gehirn ist ausschließlich auf die Impulse angewiesen, die die Maschine ihm zuleitet. Diese gestalten das Bild der äußeren Welt so, wie es im Gedächtnis der Maschine gespeichert wurde. Eine solche Technik nennen wir Phantomatik. Der wichtigste Unterschied zwischen der Phantomatik und den anderen, uns bekannten Formen der Illusion liegt in dem Feedback zwischen dem Gehirn und der Informationsquelle, d.h. der Kreis der fiktiven Realität ist nicht zu unterbrechen. Diese Fiktion ist eine von der ,wahren Wirklichkeit der Existenz’ trennende und nicht abreißbare Maske - zumindest könnte sie eine solche Maske sein. (...) Die Phantomatik stellt ein metatechnisches und sogar metakulturelles Problem dar: (...) Es geht um die subversive Tätigkeit, durch die die Phantomatik unsere Beziehung zur Welt pervertiert. Die Phantomatik schließt nämlich die Existenz eines Testes aus, der die Wirklichkeit von der Illusion unterscheiden könnte.“ (LEM 1984, S.185) Nun hat Platons Verhältnis zur Kunst, wie viele wissenschaftliche Entscheidungen, seine eigene und zutiefst theatrale Ursprungsmythologie: „Als der junge Adelige dem Handwerker Sokrates begegnet und daraufhin, wie berichtet wird, seine Tragödien verbrennt (...)“ (WEISCHEDEL 1975, S.45) Da trifft einer, der schon aus finanziellen Gründen keine Tragödien besitzt, auf einen, der sie seinetwegen verbrennen wird, was der allerdings lediglich tut, um künftig die ,wahre’ Tragödie des Sokrates niederzuschreiben. Deutlicher könnte das Verhältnis von Schreiber und Beschriebenem nicht formuliert werden: Da schafft einer durch Bücherverbrennung Platz für seine eigene Geschichte. Und so bleibt Sokrates denn auch jener, der sogar das Trägermedium seiner ,Ideen’, die Schrift mit ihrem zugehörigen Zweifel ausstatten kann, (vgl. Platon 1979, S.86) freilich wissen wir davon, weil er seinen Platon bereits gefunden und okkupiert hat. Seine Skepsis im Bezug auf die Rhetorik hat Sokrates an derselben Stelle, im Phaidros-Dialog, verdeutlicht. „’Wer dagegen nichts Wertvolleres hat, als was er nach dauerndem Hin- und Her-Wenden, bald zusammenleimend, bald wieder auflösend verfaßt und geschrieben hat, nennst Du wohl nicht mit Recht einen Dichter oder Redenverfasser oder Gesetzesschreiber?’ ,Nicht anders.’“ (PLATON 1979, S.92)
[3] Zum ,Spiel’ der Rhetorik als Schrift- und Sprachspiel äußert sich Platon selbst im Phaidros (PLATON 1979, S.89FF).
[4] Das wird deutlich, wenn man sich vor Augen hält, welch ,abgehobene’ Szenerie im wörtlichsten Sinne nötig ist, um die ,Ideen’ als Vorbilder des Wiedererinnerns in die Seelen der Menschen einzuschreiben, müssen diese doch von den Göttern selbst im Wagen vor die Originale gezerrt und dort für ihre Existenz ,geeicht’ werden. (VGL. WEISCHEDEL 1975, S.47/ PLATON 1979, S.44F/ SIEHE UNTEN)
[5] Im Neuen Testament finden sich bei Johannes einige weitere Stellen, vor allem als ,Gottes Wahrheit’ im Sinne von „Ehrlichkeit’ und ,Offenheit’ bzw. ,Vertrauenswürdigkeit/ Verlässlichkeit’ Gottes, dessen Allwissenheit das Wort wiederum, quasi durch die Hintertüre, in die Nähe unseres Gebrauchs rückt. (JOHANNES 1,14/ 4,23F/ 8,32FF/ 14,6/ 14,17/ 17,17FF/ 18,37F SOWIE IN DEN PAULUSBRIEFEN EPHESER 4,25/ RÖMER 1,25/ 3,7/ 15,8/ 1. TIMOTHEUS 2,4/ 3,15/ 2. TIMOTHEUS 3,7/ 1. JOHANNES 1,8/ 2,4/ 2,20/ 4,6). In den Römerbriefen wird es gewöhnlich mit „Bundestreue’ übersetzt. Im Timotheus 3,15 wird die Wahrheit sogar von der direkten Zuschreibung auf Personen (oder Gott) getrennt, die Briefe datieren jedoch aus den Jahren 50-67 n.Chr. Im Alten Testament ist mir kein Fall einer Trennung von der personalen Zuschreibung bekannt.
[6] Es bedarf schon eines Schopenhauer, um hier kompetent einzufügen: „Klemens kommt oft darauf zurück, daß Plato den Moses gekannt und benutzt habe“ (SCHOPENHAUER 1859/1988, S.619)
[7] Von dieser Stelle an lässt sich die Metapher vom ,Welttheater’ weiterschreiben, wobei die Blickrichtung der Götter, vom irdischen Scheinbild weg, in die Transzendenz der ,Schau des Wahren’, noch annähernd zwei Jahrtausende Bestand haben wird, ehe das ,Theater der menschlichen Irrungen’ beispielsweise bei Erasmus von Rotterdam, ihnen mehr Unterhaltung zu versprechen scheint. Die Perspektivumkehr wird sich dabei gemeinsam mit einer Veränderung des Fokus vom Wahren hin zum Spektakulären vollziehen, von der unangetasteten Harmonie des Himmels zur gebrochenen Dissonnanz auf der Erde: „Einfach unglaublich ist es, wieviel Spaß und Vergnügen die Menschlein tagtäglich den Himmlischen machen. Die Götter verwenden nämlich nur ihre nüchternen Stunden, den Vormittag, auf ihre Beratungen und das Anhören der Wünsche. Sind sie erst einmal angeheitert vom Nektar und haben sie keine Lust zu ernsten Dingen mehr, dann setzen sie sich auf die äußerste Fluh des Himmels, lehnen sich vor und gucken hinunter, zu sehen, was die Menschen treiben; kein Schauspeil ist ihnen lieber.“ (ERMASMUS VON ROTTERDAM 151 1/ 1975, S.113 ZIT. NACH SCHRAMM 1996, S.62)
[8] Diese ,Wahrheit’ hat, wie viele große Erfindungen, in ihrer Verselbstverständlichung schließlich den Aussagewert soweit verloren, dass es der Aufklärung notwendig erscheinen konnte, sie in der Tautologie der ,nackten’ oder ,unverhüllten’ Wahrheit wiederzuentdecken, bzw. bloßzustellen. Diese Doppplung des metaphorischen Bildes beschreibt beispielsweise Blumenberg (VGL. BLUMENBERG 1998, S.60FF). Gleichermaßen selbstständig emanzipiert sie die Kunst von der Welt, indem sie zunächst als Ablehnung der Ver- oder Bekleidung - beispielsweise während der französischen Revolution (VGL. MÜNZ 1998, S.169F)- negiert, später als ,Ins Werk setzen der Wahrheit’ etwa im Sinne Heideggers eben durch ihre kausale Differenz zur Wahrheit und als ihre ,Vorstellung’ wieder integrative Bedeutung zu erlangen. Die Wahrheit ist damit nurmehr in künstlicher/ künstlerischer Ausformung oder als Asbgrenzung zu dieser sichtbar. Dann erst macht es Sinn, sie nach ihrer wesentlichen Existenz zu befragen: „Welchen Wesens ist die Wahrheit, daß sie ins Werk gesetzt werden kann oder unter bestimmten Bedingungen sogar ins Werk gesetzt werden muß, um als Wahrheit zu sein?“ (HEIDEGGER 1950, S.56)
[9] VGL. PLATON 1987, S.9
[10] Nach griechischer Sage bleibt der Orakelgott in Funktionsmehrheit immerhin gleichermaßen zuständig für die schönen Künste, was im Hinblick auf die explizierte sokratische Abneigung doch ein gewisses Interesse gewinnt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus des Textes?
Der Text untersucht die Metaphorik als Erkenntnisprinzip und analysiert Platons Höhlengleichnis, um die Beziehung zwischen Kunst, Welt und menschlicher Wahrnehmung zu beleuchten.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt Themen wie die Natur der Metapher, die Ideenlehre Platons, die Rolle der Kunst, die Grenzen der menschlichen Erkenntnis, die Beziehung zwischen Vernunft und Welt, sowie die Bedeutung von Wahrheit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft.
Was ist Platons Ideenlehre und wie wird sie im Text diskutiert?
Die Ideenlehre ist ein Kernstück der platonischen Philosophie, in der die Wahrheit von der Wahrnehmung getrennt wird. Der Text diskutiert, wie Platon die Welt der Ideen als unabhängig von der Sinneserfahrung betrachtet und wie diese Ideen als Urbilder für alles Irdische dienen.
Wie wird die Rolle der Kunst im Text bewertet?
Platon lehnt Kunst als eine bloße Nachahmung der Realität ab und kritisiert insbesondere Malerei, Tragödie, Dichtung und Komödie. Allerdings wird die Musik in Form des Flötenspielers als Handwerk toleriert, weil sie, anders als andere Künste, eine eigene ,Idee’ verkörpert.
Was ist das platonische Höhlengleichnis und wie wird es im Text analysiert?
Das Höhlengleichnis beschreibt Menschen, die in einer Höhle gefesselt sind und nur die Schatten von Gegenständen wahrnehmen. Der Text analysiert dieses Gleichnis, um die Trennung zwischen der erfahrbaren Welt und der wahren Realität zu veranschaulichen, und hinterfragt die Rolle des Betrachters und die Legitimation von Wissen.
Welche Rolle spielt Sokrates in dem Text?
Sokrates wird als Figur präsentiert, die die sokratische Forderung (Ich weiss, dass ich nichts weiss) verkörpert und als jemand, der aufgrund seiner Erkenntnisse von der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Seine Hinrichtung wird als Beispiel für die Unfähigkeit der Demokratie gesehen, wahre Gerechtigkeit zu erreichen.
Wie wird die Metapher im Text definiert und welche Funktion hat sie?
Die Metapher wird als ein Mittel zur Vermittlung zwischen der Welt der Ideen und der Lebenswelt des Volkes verstanden. Sie dient dazu, die konkreten Ideen zu vertreten, die dem Autor selbst zunächst unerreichbar bleiben, und gleichzeitig die sokratische Position an das Volk zu vermitteln.
Welche Bedeutung hat die virtuelle Realität im Kontext des Textes?
Die virtuelle Realität wird als ein Paradox oder eine Tautologie betrachtet, je nachdem, ob Realität platonisch oder sozial verstanden wird. Sie stellt eine Herausforderung für die traditionelle Trennung zwischen Wahrnehmung und Realität dar und wirft die Frage auf, ob es sich dabei noch um ein (Welt-)Theater handelt.
Welche Autoren werden im Text zitiert und welche Positionen vertreten sie?
Der Text zitiert verschiedene Autoren, darunter Grotowski, Heidegger, Blumenberg, Luhmann, Foucault, Pascal, Schopenhauer, Erasmus von Rotterdam und Platon selbst. Diese Zitate dienen dazu, verschiedene Perspektiven auf die Themen des Textes zu präsentieren und die Argumentation zu untermauern.
Was ist das Ziel des Autors mit diesem Text?
Das Ziel des Autors ist es, durch die Analyse der platonischen Philosophie und des Höhlengleichnisses zu einem tieferen Verständnis der Beziehung zwischen Kunst, Welt und menschlicher Erkenntnis zu gelangen und die eigenen theaterwissenschaftlichen Erkenntnisse zu reflektieren.
- Quote paper
- Gerald Reuther (Author), 2002, Realere Realitäten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108481