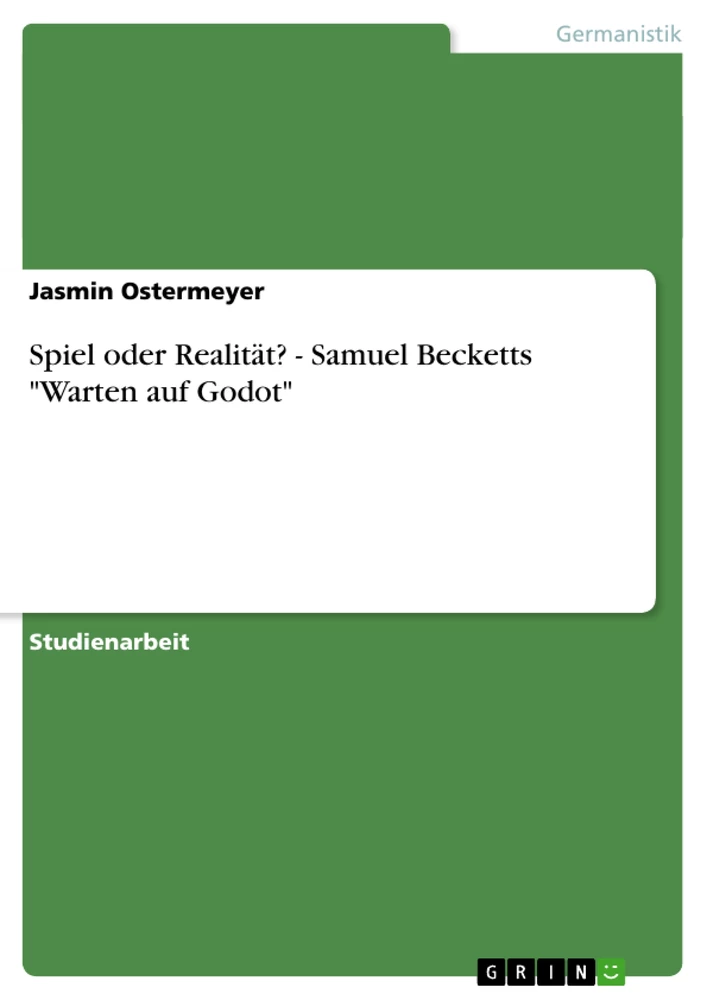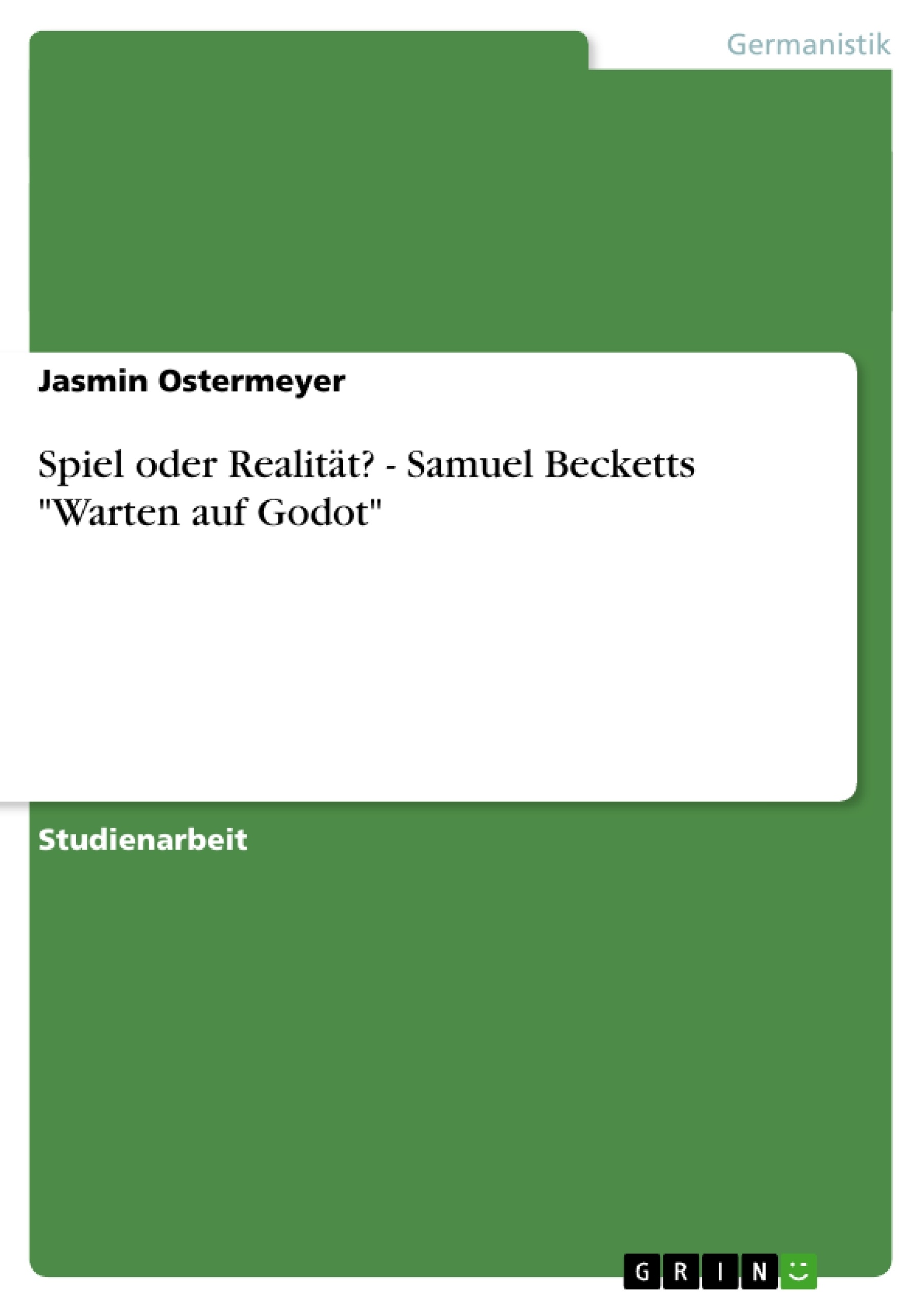Was bedeutet es, auf etwas oder jemanden zu warten, der vielleicht nie kommt? Tauchen Sie ein in Samuel Becketts bahnbrechendes Werk „Warten auf Godot“, ein Stück, das die Theaterwelt revolutionierte und bis heute fasziniert und polarisiert. Diese tiefgründige Analyse entschlüsselt die rätselhafte Struktur des Dramas, indem sie die vielschichtigen Charaktere Wladimir und Estragon, das ungleiche Paar Pozzo und Lucky, und die geheimnisumwitterte Figur Godot selbst ins Zentrum rückt. Erforschen Sie die Auflösung traditioneller theatralischer Konventionen von Ort, Zeit und Handlung, die Becketts Werk so einzigartig macht. Die ungewöhnliche Sprache des Stücks, geprägt von Wiederholungen, Pausen und dem Verlust ihrer kommunikativen Funktion, wird ebenso beleuchtet wie das zentrale Motiv des Spiels, das die Absurdität der menschlichen Existenz widerspiegelt. Entdecken Sie, wie Beckett durch Verfremdung eine Welt erschafft, die weniger die Realität abbildet als vielmehr den inneren Zustand des Menschen in seiner Suche nach Sinn und Identität. Diese Arbeit bietet eine detaillierte Interpretation, die sowohl Theaterliebhaber als auch Studierende der Literaturwissenschaft begeistern wird. Sie analysiert die stilistischen Mittel, die Beckett einsetzt, um eine unvergessliche und zum Nachdenken anregende Erfahrung zu schaffen. Untersuchen Sie die parallelen zum christlichen Erlösungsgedanken und die Hoffnungslosigkeit des endlosen Wartens. Ergründen Sie die philosophischen Dimensionen von Becketts Werk und seine Relevanz für das Verständnis der menschlichen Verfassung. Lassen Sie sich von dieser fesselnden Analyse dazu anregen, die zeitlose Bedeutung von „Warten auf Godot“ neu zu entdecken. Erfahren Sie mehr über die Entstehung des Werkes und seine Wirkungsgeschichte. Diese umfassende Untersuchung bietet neue Einblicke in eines der bedeutendsten Theaterstücke des 20. Jahrhunderts.
Inhalt
1. Einleitung
2. Inhaltsangabe
3. „Sicher ist nichts“ – Zur Unbestimmtheit in „Warten auf Godot“
3.1. Die Personen
3.1.1. Wladimir und Estragon
3.1.2. Pozzo und Lucky .
3.1.3. Godot
3.2. Die Aufhebung der Einheit von Ort, Zeit und Handlung....
3.3. Die Sprache.
4. Das Motiv des Spiels.
5. Schlussbemerkung..
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Kaum ein Theaterstück hat in den fünfziger und sechziger Jahren für so viel Aufsehen gesorgt wie Samuel Becketts „Warten auf Godot“. Von einigen Zuschauern als langweilig und sinnlos empfunden[1], stellt es für andere ein geniales Werk mit tiefschürfender Aussage dar: „Audiences do not leave the theatre, after seeing [the] play, feeling that life has been deprived of meaning. They feel rather that a new light has been cast on life’s meaning, at several deep levels“.[2] Doch was löst so unterschiedliche Reaktionen auf Becketts Werk aus? Was lässt den Zweiakter auf den ersten Blick sinnfrei und langweilig wirken?
Diese Arbeit soll versuchen die Ursachen dafür aufzuzeigen. Nach einer kurzen Beschreibung des Inhalts soll die Unbestimmtheit in dem Werk beleuchtet werden, die die traditionelle Einheit von Ort, Zeit und Handlung aufhebt. Der Zusammenhang zwischen äußerer Form und Inhalt des Stücks soll herausgestellt werden. Darauf aufbauend wird das Motiv des Spiels in „Warten auf Godot“ erläutert und die Frage gestellt, inwiefern das Werk selbst als Spiel zu sehen ist.
2. Inhaltsangabe
Bereits der Versuch, den Inhalt von „Warten auf Godot“ wiederzugeben, macht die Besonderheit des Werkes deutlich. Es ist schwierig, ein Stück zusammenzufassen, in dem fast nichts passiert und kaum das Fortschreiten einer Handlung auszumachen ist. Trotzdem soll der Analyse zum besseren Verständnis ein kurzer Abriss der Geschehnisse auf der Bühne vorangestellt werden.
Zu Beginn des ersten Aktes sind zwei Personen in zerlumpter Kleidung auf einer Landstraße, an deren Rand ein kahler Baum steht, zu sehen. Beide sind augenscheinlich ohne Obdach; einer der beiden namens Estragon berichtet seinem Gefährten Wladimir davon, die Nacht in einem Graben verbracht zu haben und verprügelt worden zu sein. In ihrem Gespräch wird deutlich, dass sie glauben, an dieser Stelle mit einem gewissen Godot verabredet zu sein. Sicher sind sie sich jedoch nicht. Estragon schlägt vor, sich an dem Baum aufzuhängen. Lange diskutiert er mit Wladimir darüber, doch sie können sich nicht zu dem Schritt entschließen. In der Zwischenzeit nähern sich ihnen zwei andere Gestalten. Der Tonangebende, Pozzo, führt seinen Diener Lucky an einer Leine und lässt ihn all sein Gepäck tragen. Pozzo kommt mit Estragon und Wladimir ins Gespräch und lässt seinen Diener zu deren Belustigung tanzen und denken. Anschließend zieht er mit Lucky weiter und Estragon und Wladimir bleiben zurück, immer noch auf Godot wartend. Ein Junge tritt auf und teilt den beiden mit, dass Godot an diesem Abend nicht kommen werde, sicher aber am nächsten. Wladimir und Estragon beschließen zu gehen, da es bereits Nacht ist. Sie bleiben jedoch stehen.
Im zweiten Akt ist der Baum leicht belaubt. Wladimir erscheint und singt ein Lied von einem Hund. Auch Estragon tritt auf; wieder warten sie auf Godot. Als sie sich über Vergangenes austauschen, sind ihre Erinnerungen sehr lückenhaft. Zum Zeitvertreib denken sie sich Spiele aus. Wieder kommen Pozzo und Lucky an dem Baum vorbei, doch Pozzo ist blind und sein Diener stumm geworden. Estragon und Wladimir erklären Pozzo, dass sie noch immer auf Godot warten. Daraufhin ziehen Pozzo und Lucky weiter und lassen die Wartenden zurück. Auch jetzt erscheint der Junge, um ihnen mitzuteilen, dass Godot an diesem Abend nicht kommen werde, gewiss aber am nächsten. Wiederum beschließen Wladimir und Estragon zu gehen, doch sie bleiben auch diesmal stehen.
3. „Sicher ist nichts“ – Zur Unbestimmtheit in „Warten auf Godot“
Nicht nur die auf der Stelle tretende, als „dramatic vacuum“[3] bezeichnete Handlung macht es schwer, sich über den Inhalt des „Godots“ klar zu werden. Eine Aussage über die Personen, Ort und Zeit zu treffen, erscheint fast unmöglich. Alles ist ungewiss, mit Sicherheit ausgesagt werden kann fast nichts.[4] Was das Verständnis für den Zuschauer und Leser so schwierig macht, gilt als wesentliches Merkmal der Beckettschen Literatur: die Unbestimmtheit.[5] Für Fletcher macht genau das die Brillanz Becketts aus: „[his] originality as a dramatist lies […] in his methods“.[6] Im Folgenden soll die Unbestimmtheit in „Warten auf Godot“ betrachtet werden. Dazu werden die Personen, Zeit, Ort und die von Beckett verwandte Sprache untersucht.
3.1. Die Personen
3.1.1. Wladimir und Estragon
Über die Charaktere im „Godot“ kann fast nichts mit Sicherheit ausgesagt werden. Woher sie kommen, ob sie Familie haben, ihre Ziele und Interessen – darüber kann nur spekuliert werden. „[Their] origins […] are shrouded in mystery“, sagt Fletcher. Eine Definition über Beruf oder Stand findet nicht statt[7], obgleich der Schluss nahe liegt, dass es sich bei Wladimir und Estragon um Landstreicher handelt. Sie tragen Lumpen und nächtigen unter freiem Himmel. Sie haben sich zusammengeschlossen, jedoch nicht aus Zuneigung, sondern aus rein praktischen Gründen. Beide sind so schwach, dass sie sich in Paaren zusammen finden.[8] Aus Angst vor Prügeln klammert sich Estragon an Wladimir. Ihr Zusammensein ist „verzweifelt eng“[9], das gemeinsame Warten auf Godot hält sie beieinander. Dabei ist ihre Abneigung gegenüber dem anderen offensichtlich: Zwar reden Sie sich mit Kosenamen („Didi“ und „Gogo“) an und umarmen sich, jedoch nur um sich gleich darauf zu versichern, welch schlechten Atem der andere habe und wie unerträglich seine Gesellschaft sei.[10] Immer wieder reden sie davon, einander zu verlassen. Das Interesse am jeweils anderen ist nicht vorhanden, sowohl Didi als auch Gogo sind isolierte Figuren, die sich aufgrund ihrer Hilflosigkeit und ihres Unvermögens allein zu bestehen notgedrungen zusammengefunden haben.[11] Eindringlingen in ihre Welt wird enormes Misstrauen entgegengebracht, so auch Pozzo und Lucky, dem zweiten auftretenden Paar.
Wladimir und Estragon sind Figuren ohne Identität[12], die sich durch völlige Orientierungslosigkeit in ihrer Welt[13] auszeichnen. Sie haben keine Vergangenheit oder können sich nur lückenhaft an sie erinnern (vgl. Kap. 3.2.). Es ist unklar, ob sie überhaupt die sind, die sie zu sein scheinen. So reagiert Wladimir auch auf den Namen „Herr Albert“[14], mit dem ihn der Bote Godots anspricht. Estragon selbst nennt sich „Catull“.[15] Beide Figuren entfremden sich so voneinander, der Welt, in der sie leben, und nicht zuletzt von sich selbst.[16]
3.1.2. Pozzo und Lucky
Zwischen dem Herrn und dem Diener besteht ein ähnliches Zwangsverhältnis wie zwischen Estragon und Wladimir. Die Kluft zwischen ihnen ist überdeutlich. Pozzo erweist sich als wahrer Tyrann[17], der Lucky wie ein Tier hält und ihn demütigt und misshandelt. Er beschimpft seinen Diener als „Schwein“ und „Scheißkerl“.[18] Und doch besteht ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwischen ihnen.[19] Lucky wird von seinem Herrn mit Nahrung versorgt, und Pozzo ist in seiner Blindheit (2.Akt) auf die Führung seines Dieners angewiesen. Pozzo liebt es, seine Macht über den gebrochenen Lucky zu demonstrieren und lässt ihn wie ein Zirkustier zur Belustigung von Estragon und Wladimir tanzen und „denken“. Auch Pozzo nimmt weitere Identitäten an wie Wladimir. Nicht nur wird er zuerst für Godot selbst gehalten, sondern wird sowohl „Kain“ als auch „Abel“ genannt.[20] Sein auf allen Vieren kriechender Diener Lucky erinnert stark an ein Tier. Der „Denkmonolog“ Luckys zeigt die verkümmerten Reste seines Menschseins. Die Bruchstücke einer umfassenden Bildung sind in ihm zu erkennen, und der Niedergang eines intellektuellen Menschen, der schließlich verstummt, wird an ihm deutlich.[21] Wie die anderen Figuren ist er nur noch das, was Drechsler als „Rudimente des Daseins“[22] bezeichnet.
3.1.3. Godot
Am wenigsten bekannt ist über die Titelfigur Godot. Welchen Beruf er ausübt, wo er lebt, ob er überhaupt existiert – all das ist nicht sicher. „Godot, das ist die Person, auf die zwei Landstreicher an einem Straßenrand warten und nie kommt“[23], bemerkt Poppe über die Figur Godots. Alles Weitere sei Spekulation. Doch der Unbekannte hat eine zentrale Funktion für Wladimir und Estragon. In ihrer Ziellosigkeit und Orientierungslosigkeit ist das Warten auf seine Ankunft ihre einzige zielgerichtete Handlung. Was sie konkret von ihm erwarten, bleibt nebulös. Doch scheinen sie sich eine Verbesserung ihrer Umstände zu erhoffen: „Heute abend schlafen wir vielleicht bei Ihm, im Warmen, im Trockenen, mit vollem Bauch, auf Stroh. Dann lohnt es sich zu warten. Nicht?“[24] In ihrem Leben, das jeden Sinn entbehrt[25], ist Godot ihre Hoffnung[26] und das endlose Warten mit ungewissem Erfolg Grundlage ihrer Existenz[27] geworden:
ESTRAGON Wir finden doch immer was, um uns einzureden, dass wir existieren, nicht wahr, Didi?
WLADIMIR ungeduldig Ja, ja, wir sind Zauberer.[28]
Auch wenn sie über Selbstmord reden[29], können sie sich nicht dazu entschließen, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Sie leben weiter und hoffen auf die Ankunft Godots. Darin lässt sich eine Parallele zum christlichen Erlösungsgedanken erkennen.[30] Wladimir erzählt Estragon die Geschichte von der Kreuzigung Jesu und zweier Diebe, die auf ihre Erlösung warten.[31] Anschließend daran machen sie sich erneut klar, weshalb sie unter dem Baum ausharren:
ESTRAGON Komm, wir gehen.
WLADIMIR Wir können nicht.
ESTRAGON Warum nicht?
WLADIMIR Wir warten auf Godot.[32]
Ebenso wie die Gekreuzigten auf Gott hoffen, setzen Wladimir und Estragon ihre Hoffnung in Godot, der sie aus dem Nichts erlösen soll, in dem sie vor sich hin vegetieren.[33] So sagt Estragon: „Ich bin mein Leben lang in der Sandwüste herumgezogen. […] Schau dir doch den Dreck an. Ich bin hier nie rausgekommen.“[34] Aus dieser Existenz von Godot befreit zu werden, ist seine einzige Perspektive:
WLADIMIR Morgen hängen wir uns auf. Pause. Es sei denn, dass Godot käme.
ESTRAGON Und wenn er kommt?
WLADIMIR Sind wir gerettet. [35]
3.2. Die Aufhebung der Einheit von Ort, Zeit und Handlung
Auch in der Analyse von Ort, Zeit und Handlung ist eine durchgängige Unbestimmtheit zu finden. Der Ort der Handlung ist nur ungenau definiert. Alles, was nach dem Öffnen des Vorhangs zu sehen ist, ist laut Regieanweisung „ Landstraße. Ein Baum. “[36] Das Bühnenbild ist auf ein Minimum reduziert.[37] Wo sich diese Landstraße befindet, ist nicht näher bestimmt. Konzentrationspunkt ist der Baum, der angebliche Treffpunkt mit Godot:
ESTRAGON 2Bist du sicher, daß es hier ist?
WLADIMIR Was?
ESTRAGON Wo wir warten sollen.
WLADIMIR Er sagte, vor dem Baum.
Sie betrachten den Baum.[38]
Die Leere, die Wladimir und Estragon umgibt, bietet ihnen weder Schutz noch Geborgenheit.[39]
Die Umgebung hat nichts Freundliches, sondern wirkt kalt und feindlich. Estragon lebt in ständiger Angst, wieder von den Unbekannten verprügelt zu werden und kann in dem räumlichen Nichts auch keinen Schutz vor ihnen finden. Die einzige Veränderung des Ortes, von dem niemand weiß, wo genau er sich befindet, besteht in einem Lichtwechsel, der die Un-terschiede der Tageszeiten anzeigt und der plötzlichen leichten Belaubung des Baumes.
Auch Zeitpunkt der Geschehnisse und der Verlauf der Zeit sind unklar. Wie lange Didi und Gogo bzw. Pozzo und Lucky schon zusammen sind, wann die Verabredung mit Godot getroffen wurde, wie lange man schon auf Godot wartet und noch auf ihn warten wird, kann nicht aus dem Bühnengeschehen geschlossen werden.[40] Auch die Frage, wie viel Zeit zwischen den beiden Akten vergeht, ist ungewiss. Zwar lautet die Regieanweisung: „ Am nächsten Tag, um dieselbe Zeit, an derselben Stelle. “[41] Doch gibt es Indizien, die dagegen sprechen, dass nur eine Nacht zwischen dem ersten und zweiten Akt vergangen sein soll. Zum einen trägt der Baum nun Blätter. Die Belaubung eines Baumes über Nacht erscheint jedoch unwahrscheinlich. Ebenso sprechen die plötzliche Erblindung Pozzos und die Verstummung Luckys gegen den nur kurzen Zeitraum, der zwischen den Akten vergangen sein soll. Dem Zuschauer widerfährt somit dasselbe wie den Figuren im Stück: Eine zeitliche Einordnung der Geschehnisse wird unmöglich.[42]
WLADIMIR Er sagte am Samstag. Pause. Meine ich jedenfalls. […]
ESTRAGON Aber an welchem Samstag? Ist denn heute Samstag? Kann nicht auch Sonntag sein? Oder Montag? Oder Freitag? […] Oder Donnerstag? [43]
Doch nicht nur die gegenwärtige Bestimmung der Zeit ist Wladimir und Estragon unmöglich. Auch die Erinnerung an ihr eigenes Leben und Vergangenes ist kaum vorhanden, und wenn doch, dann nur lückenhaft.[44] So fehlt Estragon jegliche Erinnerung an das Geschehen im ersten Akt:
Estragon schaut den Baum an.
ESTRAGON Stand er gestern nicht da?
WLADIMIR Na klar! Erinnerst du dich nicht? Um ein Haar hätten wir uns an ihm aufgehängt. […] Aber du wolltest nicht. Erinnerst du dich nicht daran?
ESTRAGON Das hast du geträumt.
[…]
WLADIMIR Und Pozzo und Lucky, hast du die auch vergessen?
ESTRAGON Pozzo und Lucky?
WLADIMIR Er hat alles vergessen! [45]
Dass Estragon all das vergessen haben soll, scheint für den Zuschauer schwer nachvollziehbar, erweckt doch die starke Ähnlichkeit der Akte den Eindruck, dass sich das Minimum an Handlung unaufhaltsam immer wiederholt.[46] Ständig kehren alle Episoden, die auf der Bühne geschehen, wieder: Sei es die Planung des Selbstmords durch Erhängen, das Treffen mit Pozzo und Lucky oder das leitmotivartige Warten auf Godot.[47] Ein Tag im Leben von Didi und Gogo scheint wie der andere, und „everything begins all over again; waiting, hope, disappointment.“[48] Die Figuren sind gefangen in einem Kreisschluss, einer „Endlosschleife“[49], ausgelöst durch die ewige Monotonie, die Routine und die Langeweile.[50] Jeder Versuch, aus dem Kreis auszubrechen, scheitert schon bei der Planung:
ESTRAGON Ich gehe.
WLADIMIR Ich auch.
Schweigen. […]
ESTRAGON Wohin gehen wir?
WLADIMIR Nicht weit.
ESTRAGON Doch, doch, laß uns weit weggehen von hier!
WLADIMIR Wir können nicht.
ESTRAGON Warum nicht?
WLADIMIR Wir müssen morgen wiederkommen.
ESTRAGON Um was zu machen?
WLADIMIR Um auf Godot zu warten.
ESTRAGON Ach ja. Pause. [51]
Dem Zuschauer offenbart sich Hoffnungs- und Trostlosigkeit ihres Wartens. Jede Aktion der Figuren ist der bloße Versuch, mit der Zeit fertig zu werden.[52] Scheinbar ist das einzige, was sie zu tun vermögen um der ewigen Gleichförmigkeit zu entgehen, mit ihren Scheinaktivitäten wie Reden und Spielen die Zeit zu überbrücken (vgl. Kap. 4) und zu Normalität zu gelangen.[53] Und doch wird unweigerlich klar, dass Zeit vergeht, auch wenn die Größenordnung nicht bestimmt werden kann. Denn im zweiten Akt befinden sich alle Figuren einem Ende näher als im ersten Akt, ihr Zustand ist schlechter. Auszumachen ist dies an ihrem körperlichen Verfall.[54] Am offensichtlichsten ist dies bei Pozzo und Lucky, die blind bzw. taub geworden sind. Doch auch bei Wladimir und Estragon wird das deutlich: Das Aufstehen fällt ihnen schwerer, Estragon schläft immer wieder ein. In einem erneuten Moment der Hoffnungslosig-keit bemerkt Wladimir schlicht: „Nur der Baum lebt.“[55] und beschreibt damit seinen eigenen Verfall.
3.3. Die Sprache
Auch die Sprache, die Beckett in seinem „Godot“ verwendet, unterliegt der Neigung zu Unklarheit und Doppeldeutigkeit, der ständigen Reduktion auf ein absolutes Minimum und der Enthebung der eigentlichen Funktion.[56] Die Sätze sind kurz und der Text ist häufig unabgeschlossen. Die Äußerungen sind extrem verknappt und wie die Handlungen der Charaktere von ständigen Wiederholungen geprägt:
Schweigen.
ESTRAGON Du sagtest, dass wir morgen wieder-kommen müssen.
WLADIMIR Ja.
ESTRAGON Dann bringen wir einen guten Strick mit.
WLADIMIR Ja. Schweigen.
ESTRAGON Didi.
WLADIMIR Ja. [57]
Der Informationsgehalt des Gesagten ist dabei gering, die Sprache verliert ihre ursprüngliche Funktion: die Kommunikation.[58] Dialoge sind nur Schein, Wortspielerei, „richtungsloser Schlagabtausch“.[59] Der Bezug zum Geschehen fehlt dabei häufig, die Worte sind so leer wie der Raum und die Zeit. Ihre Bewegung ist ebenso kreisförmig, da ein Dialog in sich zusammenbricht, wenn einem der Gesprächspartner nichts Neues einfällt, das er noch sagen können und er sich wiederholt:
WLADIMIR Es ist bestimmt eine Ablenkung.
ESTRAGON Eine Entspannung.
WLADIMIR Eine Zerstreuung.
ESTRAGON Eine Entspannung. [60]
Die Isolation der Charaktere wird so noch unterstrichen, sie sind mit ihrer reduzierten Sprache gar nicht in der Lage, wirklich miteinander in Kontakt zu treten.[61] Die Struktur dieser Pseudo-
Kommunikation unterstützt also das ewige „Auf-der-Stelle-treten“ und die Gleichförmigkeit des Wartens, die Estragon und Wladimir durchleben: „Language gives the impression of waiting and boredom, which is the theme of the play.”[62]
Wie in der Entwicklung der Charaktere ist auch auf der sprachlichen Ebene der Verfall zu spüren. Der Monolog Luckys, eine Aneinanderreihung von Wörtern ohne syntaktischen Zusammenhang, symbolisiert den Verfall des Menschen und ist dabei auch der Niedergang der Sprache[63] – dem entscheidenden Merkmal des Menschen. Das ist auch bei den anderen Figuren zu beobachten: Mit ihren immer langsameren Bewegungen werden ihre Redebeiträge kürzer und die Pausen zwischen ihnen länger. Schlussendlich nimmt das Schweigen beinahe überhand.[64] Die sprachliche Darstellung ist daher kongruent zu der Gesamtsituation.
Die Sprache, die ihrer eigentlichen Funktion enthoben ist, ist wie die Unbestimmtheit von Raum, Zeit, Handlung und Charakteren ein stilistisches Mittel, das systematisch verfremdet[65] und das Absurde in „Warten auf Godot“ ausmacht.
4. Das Motiv des Spiels
Um der Monotonie ihres sinnentleerten Zustandes zu entgehen, erfinden Wladimir und Estragon immer neue Spiele. Sie denken sich die unterschiedlichsten Arten von Spielen aus, zum Beispiel das immer wiederkehrende Spiel um Nahrung:
WLADIMIR Willst du ein Radieschen?
ESTRAGON Ist das alles, was da ist?
WLADIMIR Es gibt Radieschen und weiße Rüben.
ESTRAGON Sind keine gelben mehr da?
WLADIMIR Nein. Du übertreibst es mit den gelben.
ESTRAGON Dann gib mir ein Radieschen.
Wladimir sucht in seinen Taschen, findet nur weiße Rüben. Er kramt endlich ein Radieschen hervor, das er Estragon gibt, der es untersucht und beschnuppert.
ESTRAGON Es ist schwarz!
WLADIMIR Es ist ein Radieschen.
ESTRAGON Ich mag nur die roten, das weißt du doch.
WLADIMIR Du willst es also nicht.
ESTRAGON Ich mag nur die roten.
WLADIMIR Dann gib es zurück.
Estragon gibt es zurück.[66]
Didi und Gogo haben Spiele wie dieses derart mechanisiert, dass sie einem Ritual gleichkommen[67] und ausschließlich dazu dienen, die Zeit des Wartens zu überbrücken. Die Handlung wird hier durch das Spiel ersetzt[68], das wie so oft das einzige Geschehen auf der Bühne darstellt. Im gesamten „Godot“ sind zahlreiche Beispiele für solche Spiele zu finden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern das Stück selbst ein Spiel ist. Die Antwort geben Wladimir und Estragon selbst:
WLADIMIR Reizender Abend.
ESTRAGON Unvergeßlich..
WLADIMIR Und noch nicht vorbei.
ESTRAGON Es sieht so aus.
WLADIMIR Es fängt erst an.
ESTRAGON Es ist schrecklich.
WLADIMIR Wie im Theater.
ESTRAGON Im Zirkus.
WLADIMIR Im Varieté.
ESTRAGON Im Zirkus. [69]
Tatsächlich entsteht der Eindruck, das Bühnengeschehen sei einer Zirkusvorstellung ähnlich. Estragon zieht immer wieder seinen Schuh an und aus und wechselt die Hüte. Die so entstehende Komik ist derart übertrieben, das sie an die Vorstellung eines Zirkusclowns erinnert.[70] Selbst in einem Moment der Verzweiflung, als Wladimir und Estragon erneut über Selbstmord nachdenken, wirken sie nahezu lächerlich:
ESTRAGON Sollen wir uns aufhängen?
WLADIMIR Womit?
ESTRAGON Hast du gar keinen Strick?
WLADIMIR Nein.
ESTRAGON Dann können wir es nicht. […] Wart mal, hier ist mein Gürtel. […]
WLADIMIR Laß doch mal sehen.
Estragon löst den Knoten der Kordel, die seine Hose hält. Die viel zu weite Hose rutscht bis auf die Fußknöchel. Sie schauen die Kordel an.
WLADIMIR Zur Not könnte es gehen. Ist die denn stark genug?
ESTRAGON Das werden wir sehen. Nimm.
Sie nehmen jeder ein Ende der Kordel und ziehen. Die Kordel reißt. Sie fallen beinahe hin. […] Schweigen.
[…]
WLADIMIR Zieh deine Hose rauf.
ESTRAGON Wie bitte?
WLADIMIR Zieh deine Hose rauf.
ESTRAGON Meine Hose ausziehen?
WLADIMIR Zieh deine Hose h e r a u f
ESTRAGON Ach ja. Er zieht seine Hose herauf. [71]
Pozzo, der seinen Diener an der Leine führt, hat eine ähnliche Funktion wie ein Dompteur. Es hat den Anschein, als habe er Lucky so dressiert, dass dieser Tanzvorstellungen mechanisch wie ein Zirkustier darbietet.[72]
Auch das Motiv des Spiels hat eine verfremdende Funktion und lässt das Bühnenstück selbst als ein Spiel erscheinen. Somit wird beim Zuschauer eine Distanz zum Bühnengeschehen erzeugt.
5. Schlussbemerkung
Es hat sich gezeigt, wie stark die auf den ersten Blick ungewöhnliche Form des Stückes mit seinem Inhalt – dem Menschen auf der Suche nach Lebenssinn und Identität – korrespondiert. Die verzerrt dargestellte Welt ist daher kein Zufall, sondern ein systematisch erarbeitetes Produkt stilistischer Mittel, die einen Verfremdungseffekt erzeugen. „Warten auf Godot“ zeigt nicht die Realität, sondern den seelischen Innenraum von Menschen[73], die sich in ihrer Welt nicht zurechtfinden. Die Verfremdung verhindert eine Identifikation des Zuschauers mit den Charakteren und der Situation, bietet aber einen Anstoß zur Selbstreflexion. Und so hat der wohl bekannteste Vertreter des Absurden Theaters, der in den vergangenen 50 Jahren viele Zuschauer schockierte, langweilte oder aber begeisterte, ein so gar nicht absurdes Ziel: „[A]nstoßen, wachrütteln, um des Menschen willen.“[74]
Literaturverzeichnis
I. Primärliteratur
Beckett, Samuel: Warten auf Godot. En attendant Godot. Waiting for Godot. 30. Aufl. Franfurt am Main: Suhrkamp 2003.
II. Sekundärliteratur
Bechert, Frank: Keine Versöhnung mit dem Nichts. Zur Rezeption von Samuel Beckett in der DDR. Frankfurt am Main, Berlin u.a.: Lang 1997.
Drechsler, Ute: Die “absurde Farce” bei Beckett, Pinter und Ionesco. Tübingen: Narr 1988.
Fletcher, John: Samuel Beckett’s Art. 2. Aufl. London: Chatto & Windus 1971.
Poppe, Reiner: Absurdes Theater. Beispiele und Perspektiven. Arrabal, Beckett, Ionesco und Tardieu. Hollfeld: Beyer 1979.
Samuel Beckett. The Critical Heritage. Herausgegeben von Lawrence Graver und Raymond Federman. London, New York: Routledge 1979. Nachdruck London u. New York: Routledge 1997.
Schmeling, Manfred: Die Parodie der Unbestimmtheit. Zur literarischen Wirkungsgeschichte von „Warten auf Godot“. In: Beckett und die Literatur der Gegenwart. Herausgegeben von Martin Brunkhorst, Gerd Rohmann und Konrad Schoell. Heidelberg: Winter 1988. S. 203-217.
[...]
[1] Vgl. Samuel Beckett. The Critical Heritage. Herausgegebenvon Lawrence Graver and Raymond Federman. London, New York: Routlegde 1979. Nachdruck London, New York: Routledge 1997. S. 98.
[2] ebenda
[3] The Critical Heritage 1997. S. 95.
[4] Vgl. Schmeling, Manfred: Die Parodie der Unbestimmtheit. Zur literarischen Wirkungsgeschichte von „Warten auf Godot“. In: Beckett und die Literatur der Gegenwart. Herausgegeben von Martin Brunkhorst, Gerd Rohmann und Konrad Schoell. Heidelberg: Winter 1988. S.205.
[5] Vgl. Bechert, Frank: Keine Versöhnung mit dem Nichts. Zur Rezeption von Samuel Beckett in der DDR. Franfurt am Main, Berlin u.a.: Lang 1997. S.46.
[6] Fletcher, John: Samuel Beckett’s Art. 2. Aufl. London: Chatto & Windus 1971. S. 41.
[7] Drechsler, Ute: Die „absurde Farce“ bei Beckett, Pinter und Ionesco“. Tübingen: Narr 1988. S. 116.
[8] Vgl. Drechsler 1988. S. 140.
[9] Poppe, Reiner: Absurdes Theater. Beispiele und Perspektiven. Arrabal, Beckett, Ionesco und Tardieu. Hollfeld: Beyer 1979. S. 41.
[10] Vgl. Beckett, Samuel: Warten auf Godot. En attendant Godot. Waiting for Godot. 30. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003. S. 47.
[11] Vgl. Drechsler 1988. S. 107.
[12] Bechert 1997. S. 49.
[13] Vgl. Drechsler 1988. S. 106.
[14] Godot. S. 225.
[15] Godot. S. 97.
[16] Vgl. Schmeling S. 206.
[17] Vgl. Fletcher 1971. S. 52.
[18] Godot. S. 117.
[19] Vgl. Drechsler 1988. S. 131.
[20] Godot. S. 207.
[21] Poppe 1979. S. 51.
[22] Drechsler 1988. S. 106.
[23] Poppe 1979. S. 49.
[24] Godot. S. 55.
[25] Vgl. Poppe 1979. S. 46.
[26] Bechert 1997. S. 327.
[27] Vgl. Poppe 1979. S. 52/53.
[28] Godot. S. 171.
[29] Godot. S. 47.
[30] Vgl. Poppe 1979. S. 49.
[31] Godot. S. 35/37.
[32] Godot. S. 39.
[33] Vgl. Poppe 1979. S. 52/53.
[34] Godot. S. 153.
[35] Godot. S. 233.
[36] Godot. S. 27.
[37] Vgl. Fletcher 1971. S. 48.
[38] Godot. S. 39.
[39] Vgl. Drechsler 1988. S. 119.
[40] Vgl. Poppe 1979. S. 40.
[41] Godot. S. 143.
[42] Vgl. Schmeling 1988. S. 210.
[43] Godot. S. 43.
[44] Vgl. Poppe 1979. S. 41.
[45] Godot. S. 153.
[46] Vgl. Schemling 1988. S. 213.
[47] Drechsler 1988. S. 114.
[48] The Critical Heritage. S. 90.
[49] Bechert 1997. S. 48.
[50] Vgl. Drechsler 1988. S. 154.
[51] Godot. S. 229.
[52] Vgl. Poppe 1979. S. 40.
[53] Vgl. Drechsler 1988. S. 152.
[54] Vgl. Drechsler 1988. S. 158.
[55] Godot. S. 229.
[56] Vgl. Drechsler 1988. S. 164.
[57] Godot. S. 231.
[58] Poppe 1979. S. 42.
[59] Poppe 1979. S. 43.
[60] Godot. S. 171.
[61] Vgl. Drechsler 1988. S. 164.
[62] Fletcher 1971. S. 68.
[63] Vgl. Poppe 1979. S. 51.
[64] Vgl. Drechsler 1988. S. 196.
[65] Bechert 1997. S. 47.
[66] Godot. S. 169.
[67] Vgl. Poppe 1979. S. 44.
[68] Vgl. Poppe 1979. S. 43.
[69] Godot. S. 91.
[70] Vgl. Fletcher 1971. S. 58.
[71] Godot. S. 231/233.
[72] Vgl. Fletcher 1971. S. 58/59.
[73] Vgl. Poppe 1979. S. 22.
Häufig gestellte Fragen zu "Warten auf Godot"
Was ist "Warten auf Godot" und worum geht es in dieser Analyse?
Diese Analyse befasst sich mit Samuel Becketts Theaterstück "Warten auf Godot", einem Werk, das in den 1950er und 1960er Jahren für viel Aufsehen sorgte. Die Analyse untersucht die Ursachen für die unterschiedlichen Reaktionen auf das Stück, beleuchtet die Unbestimmtheit, die die traditionelle Einheit von Ort, Zeit und Handlung aufhebt, und erörtert das Motiv des Spiels in dem Werk.
Was sind die zentralen Themen und Schwerpunkte der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf:
- Die Unbestimmtheit in "Warten auf Godot" bezüglich Personen, Ort, Zeit und Sprache.
- Die Aufhebung der Einheit von Ort, Zeit und Handlung.
- Das Motiv des Spiels und die Frage, inwiefern das Werk selbst als Spiel zu sehen ist.
Wer sind die Hauptfiguren in "Warten auf Godot" und was zeichnet sie aus?
Die Hauptfiguren sind:
- Wladimir und Estragon: Zwei Landstreicher, die auf Godot warten. Sie sind durch ihre Orientierungslosigkeit, mangelnde Identität und gegenseitige Abhängigkeit gekennzeichnet.
- Pozzo und Lucky: Ein Herr und sein Diener, deren Beziehung von Tyrannei und Abhängigkeit geprägt ist.
- Godot: Die Titelfigur, auf die Wladimir und Estragon warten. Über ihn ist fast nichts bekannt, aber er stellt für die beiden eine Hoffnung auf Erlösung dar.
Was bedeutet die Unbestimmtheit in Bezug auf Ort, Zeit und Handlung?
Der Ort der Handlung ist ungenau definiert ("Landstraße. Ein Baum."). Der Zeitpunkt der Geschehnisse und der Verlauf der Zeit sind ebenfalls unklar. Die Figuren haben keine klare Erinnerung an ihre Vergangenheit, und die Handlung wiederholt sich ständig, was zu einer "Endlosschleife" führt.
Welche Rolle spielt die Sprache in "Warten auf Godot"?
Die Sprache ist geprägt von Unklarheit, Doppeldeutigkeit, Reduktion auf ein Minimum und der Enthebung ihrer eigentlichen Funktion. Die Sätze sind kurz, der Text ist häufig unabgeschlossen, und es gibt viele Wiederholungen. Die Sprache verliert ihre ursprüngliche Funktion der Kommunikation und dient oft nur als "richtungsloser Schlagabtausch".
Was ist das Motiv des Spiels und inwiefern ist das Stück selbst ein Spiel?
Um der Monotonie ihres sinnentleerten Zustands zu entgehen, erfinden Wladimir und Estragon immer neue Spiele. Das Bühnengeschehen ähnelt einer Zirkusvorstellung, und das Motiv des Spiels hat eine verfremdende Funktion, die beim Zuschauer eine Distanz zum Bühnengeschehen erzeugt.
Was ist die Schlussfolgerung der Analyse?
Die Analyse zeigt, dass die ungewöhnliche Form des Stückes eng mit seinem Inhalt – dem Menschen auf der Suche nach Lebenssinn und Identität – korrespondiert. Die verzerrt dargestellte Welt ist kein Zufall, sondern ein systematisch erarbeitetes Produkt stilistischer Mittel, die einen Verfremdungseffekt erzeugen. "Warten auf Godot" bietet einen Anstoß zur Selbstreflexion.
- Quote paper
- Jasmin Ostermeyer (Author), 2003, Spiel oder Realität? - Samuel Becketts "Warten auf Godot", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108478