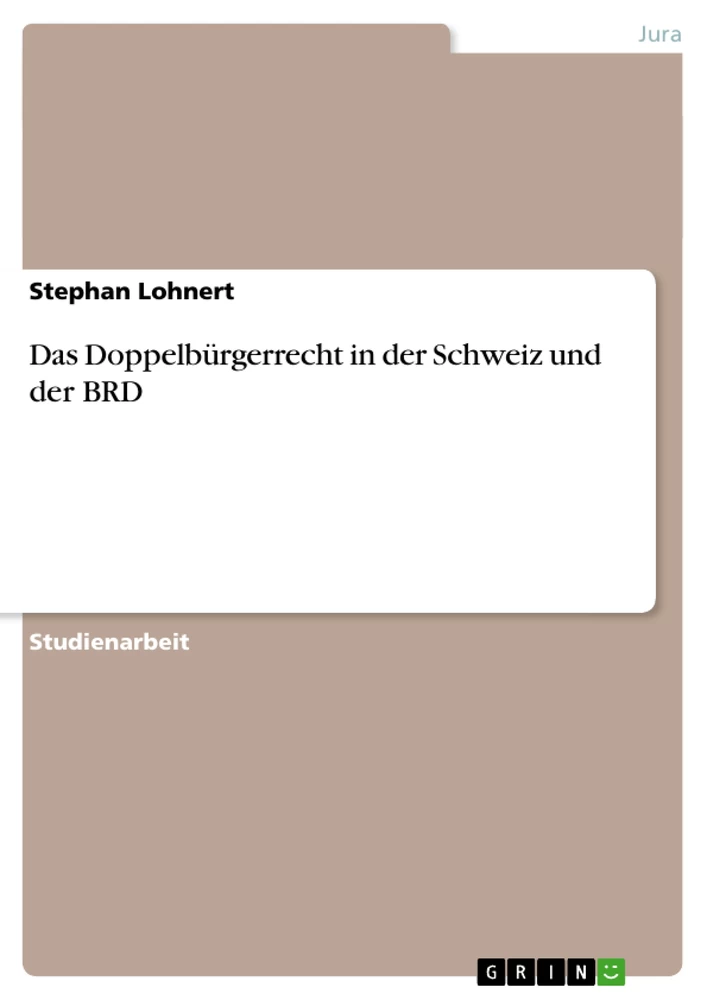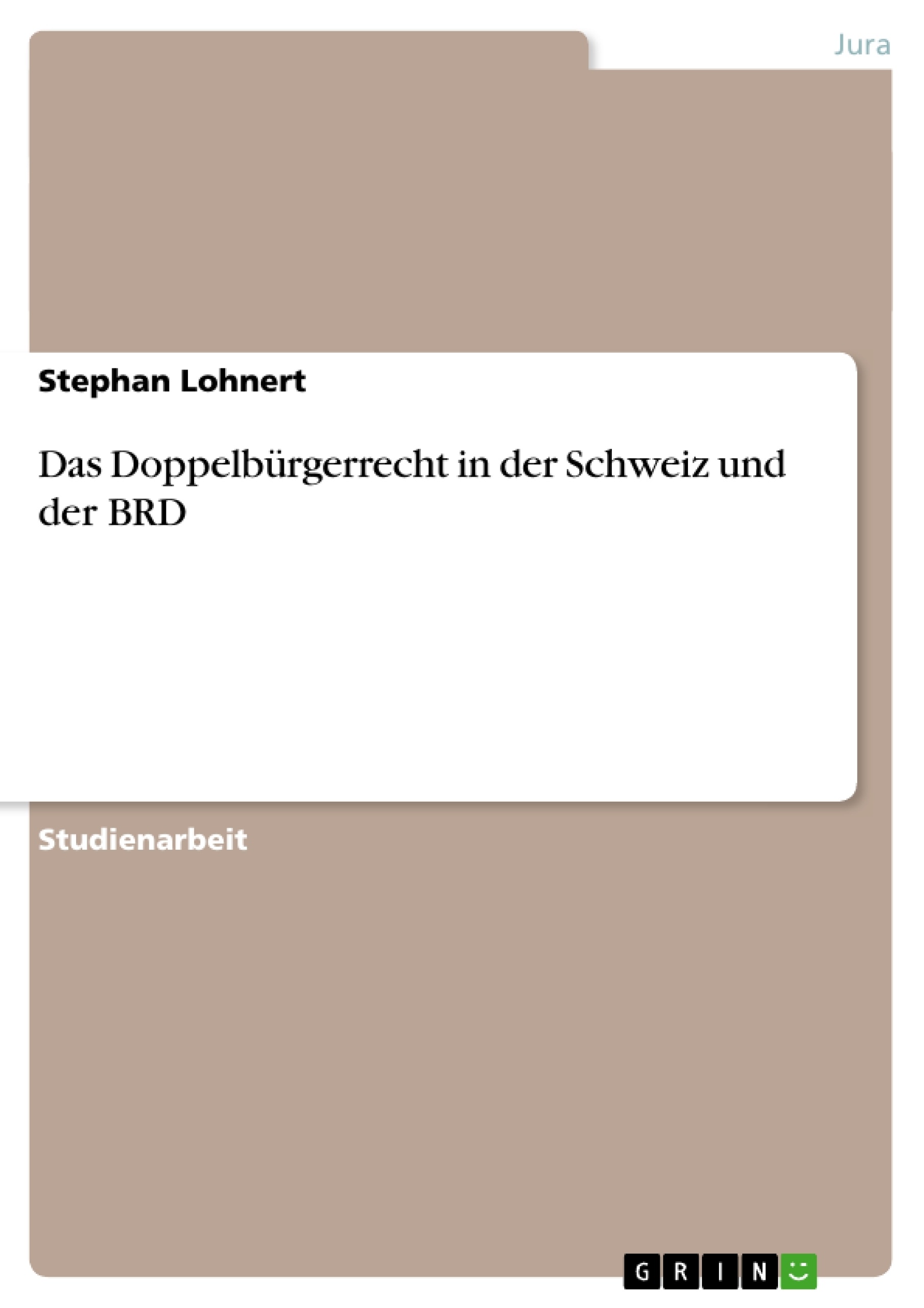Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Das Schweizer Bürgerrecht
2.1 Erwerb und der Verlust des Bürgerrechts von Gesetzes wegen
2.2 Der Erwerb des Bürgerrechts durch Einbürgerung
2.2.1 Die ordentliche Einbürgerung
2.2.2 Die erleichterte Einbürgerung
2.3 Entzug des Bürgerrechts durch behördlichen Beschluss
3 Die doppelte Staatsbürgerschaft
3.1 Die doppelte Staatsbürgerschaft in der Schweiz
3.2 Die doppelte Staatsbürgerschaft in der Bundesrepublik Deutschland
3.3 Probleme der Doppelbürgerschaft auf der Ebene des öffentlichen Rechts
3.3.1 Die Regelung der Wehrpflicht bei doppelter Staatsangehörigkeit
3.3.2 Die Problematik des diplomatischen Schutzes bei Doppelbürgern
3.4 Probleme der Doppelbürgerschaft auf der Ebene des internationalen Privatrechts
3.4.1 Das Personenrecht bei Doppelbürgern
3.4.2 Das Eherecht bei Doppelbürgern
3.4.3 Das Erbrecht
3.5 Tendenzen zur Hinnahme der doppelten Staatsbürgerschaft
3.6 Politische Argumentation zur doppelten Staatsbürgerschaft
3.6.1 Gegner der doppelten Staatsbürgerschaft
3.6.2 Befürworter der doppelten Staatsbürgerschaft
4 Persönliche Würdigung der doppelten Staatsbürgerschaft
1 Einleitung
In der aktuellen Diskussion über die Revision der Einbürgerungsmöglichkeiten von Ausländern der zweiten und dritten Generation in der Schweiz wurde nach dem Austausch der unterschiedlichen Positionen einem weiteren Thema kaum Beachtung geschenkt, das in vielen anderen Staaten, vor kurzem oder immer noch, heftig umstritten war bzw. ist: Die doppelte Staatsbürgerschaft.
Bei diesem Thema ruft bei einem großen Teil der Bevölkerung eine große emotionale Beteiligung hervor, so dass man fast sagen kann, dass es sich um Thema handelt, zu dem jeder eine persönliche Einstellung besitzt. Neben der psychologischen Problematik der doppelten Staatsbürgerschaft existieren auch noch juristische Probleme, da in vielen Rechtsgebieten die Staatsangehörigkeit unter anderem in der Zuständigkeit und der Anwendung des Rechts eine große Rolle spielt.
Im nun folgenden Text soll auf die Möglichkeiten und Folgen der doppelten Staatsbürgerschaft im Schweizer Recht eingegangen werden, insbesondere der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts, um die Entstehung des Doppelbürgerrechts nachzuvollziehen.
Des weiteren erfolgt ein Vergleich des Schweizer mit dem Deutschen Staatsangehörigkeitsrechts, um zu zeigen, wie andere Staaten mit der doppelten Staatsbürgerschaft umgehen, um schließlich auf die öffentlich- und privatrechtlichen Probleme sowie deren partielle Lösung einzugehen.
Den Abschluss dieser Arbeit bildet die Darstellung möglicher Argumente der Politik pro und contra der Mehrstaatigkeit, bevor der Autor eine eigene Würdigung des Themas vornimmt.
Zunächst soll nun der Erwerb und der Verlust des Schweizer Bürgerrechts als Voraussetzung für eine doppelte Staatsbürgerschaft beschrieben werden.
2 Das Schweizer Bürgerrecht
Das Bürgerrecht in der Schweiz besteht bei genauer Betrachtung aus drei Einheiten, die jedoch nach Art. 37 Abs. 1 BV untrennbar sind: Das Gemeinde-, das Kantonsbürger- sowie das Schweizer Bürgerrecht; folglich besitzt jeder Schweizer bzw. jede Schweizerin 3 miteinander verknüpfte Bürgerrechte. Nach herrschender Lehre verkörpert das Schweizer Bürgerrecht die Zugehörigkeit zum schweizerischen Staatenverband, d.h. es kann als „schweizerische Staatsangehörigkeit“ betrachtet werden (Häfelin & Haller, 2001, S.370).
Verbunden mit der Staatsangehörigkeit sind verschiedene Rechte der Bürger, aber auch Pflichten.
Der Inhaber des Bürgerrechts hat nach Art. 136 BV politische Mitwirkungsrechte im Bund, er genießt im Ausland diplomatischen Schutz und darf an ausländische Staaten nur mit seiner Einwilligung ausgeliefert werden bzw. darf nicht ausgewiesen werden (Art. 25 Abs. 1 BV).
Des Weiteren besteht für alle Schweizer Bürger die Niederlassungsfreiheit nach Art. 24 BV.
Die Pflichten der Bürger bestehen im Militärdienst für Männer (Art. 59 Abs. 1 BV) bzw. dem Verbot, in einer fremden Armee Dienst zu leisten und weiteren Pflichten, wie die in einigen Kantonen obligatorische Stimmpflicht (Thürer, Aubert & Müller, 2001, S. 328-329).
Nach Art. 38 Abs. 1 BV ist der Bund zur Regelung des Erwerbs und des Verlustes des Bürgerrechts durch Abstammung, Heirat oder Adoption sowie der erleichterten Einbürgerung bzw. Wiedereinbürgerung ermächtigt. Der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts durch die ordentliche Einbürgung unterliegt nach Art. 38 Abs. 2 BV gewissen Mindestvorschriften des Bundes, die die Kantone beachten müssen (Häfelin & Haller, 2001, S. 373).
Der Vollzug erfolgt durch das Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (Bürgerrechtsgesetz [BüG]) vom 29. September 1952.
Häfelin und Haller (2001, S. 375) unterscheiden hierbei im Bürgerrechtsgesetz den Erwerb und den Verlust von Gesetzes wegen, Erwerb durch Einbürgung sowie Verlust des Bürgerrechts durch behördlichen Beschluss.
2.1 Erwerb und der Verlust des Bürgerrechts von Gesetzes wegen
Grundsätzlich geht das Bürgerrechtsgesetz nach Art. 1 BüG vom Grundsatz des ius sanguinis aus. Das Kind zweier verheirateter Eltern erhält das Schweizer Bürgerrecht, wenn einer der beiden Elternteile ebenfalls Schweizer ist. Bei unverheirateten Eltern mit Schweizer Mutter oder der späteren Heirat des Schweizer Vaters mit der (ausländischen) Mutter wird das Kind ebenso Schweizer Bürger. Nach Art. 7 BüG gilt gleiches sinngemäß auch für adoptierte Kinder. Nach Art. 161 ZGB erhält die Ehefrau durch Heirat das Bürgerrecht des Mannes (Häfelin & Haller, 2001, S. 374)
Der Verlust des Schweizer Bürgerrechts kraft Gesetz erfolgt durch die Adoption seitens ausländischer Eltern (Art. 8 a BüG) oder unter bestimmten Bedingungen bei Auslandsschweizern, die bereits im Ausland geboren wurden, daneben eine weitere Staatsbürgerschaft besitzen und nicht bis zum 22.Lebensjahr die Beibehaltung des Schweizer Bürgerrechts erklärt haben (Häfelin & Haller, 2001, S. 380).
2.2 Der Erwerb des Bürgerrechts durch Einbürgerung
Im Bereich der Einbürgerung von Ausländern finden 2 Verfahren durch die Behörden Anwendung: die sog. ordentliche und die erleichterte Einbürgerung.
2.2.1 Die ordentliche Einbürgerung
Für eine ordentliche Einbürgung kommen Ausländer in Frage, die bereits seit 12 Jahren in der Schweiz leben. Die Eignung zur ordentlichen Einbürgerung wird in einem dreistufigen Verfahren zunächst durch den Bund, gefolgt durch den Kanton sowie die Gemeinde am Wohnsitz geprüft. Nach Art. 12 Abs.2 BüG ist eine Einbürgerung nur möglich, wenn eine Einbürgerungsbewilligung des Bundes vorliegt, jedoch begründet eine Einbürgerungsbewilligung noch keinen Anspruch auf Einbürgerung der Person seitens der Kantone und der Gemeinden (Häfelin & Haller, 2001, S.377). Prüfungskriterien für die Erteilung einer Bewilligung seitens des Bundes sind neben der bereits erwähnten Aufenthaltsdauer die Eingliederung in die einheimische Gesellschaft und das Vertrautsein der betroffenen Person mit den Schweizer Sitten und Gebräuchen. Darüber hinaus darf von der Person auch keine Gefährdung der inneren und äußeren Sicherheit ausgehen und sie muss auch die Schweizer Rechtsordnung beachten. Daraufhin prüfen die Kantone und Gemeinden die Wohnsitzvorausetzungen sowie weitere kantonal bzw. gemeindlich unterschiedliche Eignungsvorrausetzungen (Bundesamt für Ausländerfragen [BFA], 2001a). Die kantonale bzw. gemeindliche Praxis zur Prüfung dieser Eignungsvoraussetzungen (z.B. durch obligatorisches Referendum) wird in der Literatur heftig kritisiert[1]. Die Kantone können ebenso in freiem Ermessen von dem einbürgerungswilligen Bürger eine Einbürgerungstaxe erheben.
2.2.2 Die erleichterte Einbürgerung
Im Gegensatz zur ordentlichen Einbürgerung ist die Mitwirkung der Gemeinden und Kantone bei der erleichterten Einbürgerung auf ein Anhörungs- und Beschwerderecht begrenzt. Die erleichterte Einbürgerung richtet sich vorrangig an die Ehepartner eines Schweizer Bürgers sowie an ausländische Kinder eines Schweizer Elternteils, die nicht bereits aufgrund von Gesetz das Bürgerrecht besitzen. Die Eignung der Person wird anhand derselben Kriterien (Ausnahme: Aufenthaltsdauer) wie bei der ordentlichen Einbürgerung durch den Bund geprüft (BFA, 2001a). Die Einbürgerung wird direkt vom EJPD (Eidgenössisches Department für Polizei und Justiz) vorgenommen; ein Rechtsanspruch auf Einbürgerung im einfachen Verfahren besteht jedoch nicht. Ebenso wird keine Einbürgerungstaxe, sondern nur eine Kanzleigebühr erhoben. (Häfelin & Haller, 2001, S.378).
Die Wiedereinbürgerung ehemaliger Schweizer, die ihr Bürgerrecht verloren haben, erfolgt analog zum Verfahren der erleichterten Einbürgerung.
2.3 Entzug des Bürgerrechts durch behördlichen Beschluss
Nach Art. 48 BüG kann das EJPD im Zusammenarbeit mit dem Heimatkanton einem Schweizer Bürger das Bürgerrecht entziehen, sofern sein Verhalten das Ansehen der Schweiz negativ beeinflusst oder gegen das Interesse der Schweiz ist. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass er keinen Wohnsitz in der Schweiz hat und durch die Maßnahme nicht staatenlos wird (Thürer et al., 2001, S. 327).
Daneben kann unter den gleichen Voraussetzungen ein Schweizer Bürger sowie dessen Kinder auf eigenes Verlangen aus dem Bürgerrecht entlassen werden (Art. 42, 44 BüG).
Prinzipiell macht die Bundesverfassung keinen Unterschied zwischen Schweizern in Bezug auf den Erwerb des Bürgerrechts. Unabhängig vom Erwerbsgrund des Bürgerrechts haben die Bürger die gleichen, bereits vorhin aufgelisteten Rechte und Pflichten.
Nachdem nun die Möglichkeiten zum Erwerb bzw. Verlust des Bürgerrechts dargestellt wurde, soll nun auf den Spezialfall der doppelten Staatsbürgerschaft eingegangen werden.
3 Die doppelte Staatsbürgerschaft
3.1 Die doppelte Staatsbürgerschaft in der Schweiz
Zuvor wurde bereits beschrieben, wie das Schweizer Bürgerrecht erworben bzw. unter welchen Umständen es zwangsweise aberkannt werden kann. Besitzt nun ein Schweizer neben dem Schweizer Bürgerrecht noch eine weitere Staatsangehörigkeit, so spricht man vom Doppelbürgerrecht. Grundsätzlich gilt, dass seit der Revision des BüG von 1.Januar 1992 das Schweizer Bürgerrecht zusammen mit einer anderen Staatsbürgerschaft aus Schweizer Sicht möglich ist; allerdings ist zu beachten, dass einige andere Staaten ihrerseits als Voraussetzung für den Erwerb ihrer Staatsbürgerschaft die Ablegung des Schweizer Bürgerrechts verlangen, um so mehrfache Staatsbürgerschaften zu vermeiden.
Hailbronner (2001, S. 107) definiert das Vorliegen einer mehrfachen Staatsbürgerschaft eines Individuums, wenn dieses mehr als eine Staatsangehörigkeit besitzt, davon ist jedoch die unechte Mehrstaatigkeit zu unterscheiden, die durch die Zugehörigkeit zu einem Gliedstaat eines Bundesstaats entsteht.
Das Völkerrecht verbietet keine doppelte oder mehrfache Staatsangehörigkeit und überlässt es den einzelnen Staaten selbst im Rahmen ihrer eigenen Rechte zur Regelung der Staatsangehörigkeit zu handeln.
Beispiele für Staaten, die eine doppelte Staatsbürgerschaft nicht tolerieren, sind Luxemburg sowie in der Regel Deutschland und Österreich, währenddessen Liechtenstein, Frankreich, Italien keine Probleme mit dem Doppelbürgerrecht haben[2] (BFA, 2001b).
Generell lassen sich mehrere Möglichkeiten denken, wie es zu einem Doppelbürgerrecht kommt:
Zu einem erhalten Kinder mit Eltern unterschiedlicher Staatsangehörigkeiten oftmals die Nationalität beider Elternteile, allerdings ist auch denkbar, dass das Kind Schweizer Eltern im Ausland geboren wurde. In den USA beispielsweise richtet sich die Staatsangehörigkeit nach dem ius soli-Prinzip, d.h. nach dem Geburtsort. Wird nun das Kind während einer Reise in die USA geboren, so besitzt es kraft dem ius sanguinis-Prinzip das Schweizer Bürgerrecht kraft Gesetz nach Art. 1 BüG, anderseits aber auch die amerikanische Staatsbürgerschaft (Thürer et al., 2001, S. 330).
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass Ausländer in der Schweiz im Rahmen der beschriebenen Einbürgerungsverfahren das Schweizer Bürgerrecht erhalten ohne gleichzeitig ihre bisherige Nationalität aufgeben. Der gleiche Fall kann auch auf Auslandsschweizer zutreffen, die zusätzlich die Nationalität ihres Wohnlandes annehmen. So sind nach einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung vom 12.8.2000 mehr als 70 % der 580.000 Auslandsschweizer Doppelbürger, während in der Schweiz selbst 381.056 Bürger mit Doppelbürgerrecht leben (Deutsches Lehrmittel- und Kulturzentrum Kirov, 2002).
Bevor nun die Probleme für das Doppelbürgerrecht sowie wie die verschiedenen Positionen dazu betrachtet werden, ist es sicherlich interessant, die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft aus einem anderen Blickwinkel, nämlich aus der Sicht eines Staates, der eine einzige Staatsbürgerschaft fordert, zu betrachten.
Als Beispiel hierfür soll nun das Staatsangehörigkeitsrecht der Bundesrepublik Deutschland dargestellt werden, das – wie bereits erwähnt – in der Regel keine doppelte Staatsbürgerschaft zulässt.
3.2 Die doppelte Staatsbürgerschaft in der Bundesrepublik Deutschland
Ebenfalls wie in der Schweiz herrschte in Deutschland grundsätzlich das Prinzip des ius sanguinis – Prinzip vor, d.h. die Staatsangehörigkeit ergab sich aus der Abstammung des Kindes und nicht aus dem Geburtsort. Ausländer konnten nur im Rahmen eines langwierigen Einbürgerungsverfahrens Deutsche Staatsbürger werden. Durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts zum 1.1.2000 erfolgte nun eine Aufweichung des Prinzips, es sieht nunmehr vor, das die Kinder dauerhaft in Deutschland lebender Ausländer von Geburt an Deutsche sind. Ein Elternteil dieser Kinder muss sich bereits 8 Jahre dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland aufhalten und seit 3 Jahren eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzen. Sollte das Kind nach der Geburt durch die Abstammung zusätzlich noch die Staatsangehörigkeit der Eltern erhalten, muss es sich bei Erreichen der Volljährigkeit bis zum 23. Lebensjahr für eine Staatsbürgerschaft entscheiden; erfolgt bis dahin keine Erklärung des Kindes, welche Staatsbürgerschaft es besitzen will, so verliert es automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft.
Diese Optionslösung ermöglicht nun eine temporäre doppelte Staatsbürgerschaft; der ursprüngliche Vorschlag einer vorbehaltlosen und dauerhaften Duldung eines sog. „Doppelpasses“ wurde relativ schnell aufgrund der mangelnden politischen Durchsetzbarkeit verworfen. Prinzipiell sieht die deutsche Gesetzeslage ab dem 23. Lebensjahr somit nur eine Staatsbürgerschaft vor; Ausnahmen von diesem Prinzip sind nur vorgesehen, wenn die ausländische Staatsangehörigkeit nicht oder nur mit Schwierigkeiten aufgegeben werden kann. So können ältere Personen, für die die Entlassung aus der ausländischen Staatsangehörigkeit mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist oder anerkannte Flüchtlinge die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen. Dies trifft ebenfalls zu, wenn die Entlassung aus der alten Staatsangehörigkeit nur unter unzumutbaren Bedingungen wie entwürdigende Entlassungsverfahren möglich oder mit erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen verbunden ist (Bundesbeauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen / Bundesinnenministerium [BMI], 1999).
Im nächsten Teil der Arbeit soll nun auf die Probleme der doppelten Staatsbürgerschaft sowie den Umgang damit im öffentlichen Recht eingegangen werden.
3.3 Probleme der Doppelbürgerschaft auf der Ebene des öffentlichen Rechts
Die Vermeidung von Mehrstaatigkeit, wie sie von der Bundesrepublik Deutschland angestrebt wird, ist meist begründet durch das Pflichten- und Treueverhältnis zwischen Staat und Bürger. Da durch die mehrfache Staatsbürgerschaft Konflikte zwischen Staaten in Bezug auf die Personalhoheit, insbesondere in den Bereichen Wehrpflicht und diplomatischen Schutz entstehen können, wird versucht durch bi- oder multilaterale Verträge die doppelte Staatsbürgerschaft zu verhindern bzw. die damit verbundenen Probleme zu lindern.
Als mulilaterale Regelungen wurde bereits 1930 die Haager Konvention vom 30.4.1930 sowie dem Europäischen Übereinkommen über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern vom 6.5.1963 abgeschlossen. Die Bundesrepublik Deutschland ist – im Gegensatz zur Schweiz[3] – beiden obigen Abkommen beigetreten.
Art. 3 der Haager Konvention enthält den völkerrechtlich anerkannten Grundsatz, dass der Heimatstaat eine zweite Staatsangehörigkeit nicht beachten muss, dementsprechend betrachtet der deutsche Staat einen Doppelbürger grundsätzlich als Deutschen (Hailbronner, 2001, S.108 -112). Aufgrund der völkerrechtlichen Anerkennung dieses Prinzips gilt für die Schweizer Eidgenossenschaft analog der gleiche Sachverhalt.
3.3.1 Die Regelung der Wehrpflicht bei doppelter Staatsangehörigkeit
Aufgrund der Problematik, dass die Staaten bei der Behandlung der Doppelbürger auf deren zweite Staatsbürgerschaft nicht Rücksicht zu nehmen brauchen, ergibt sich eine zweifache Pflicht des Bürgers in Hinblick auf seine abzuleistende Wehrpflicht. Dies ist insofern problematisch, da der Betroffene neben der eventuellen Verletzung der Gleichbehandlung gegenüber Bürgern mit „einfacher“ Staatsangehörigkeit in Gefahr läuft, sich – insbesondere in Kriegszeiten – sich durch die Ableistung der Wehrpflicht des Landes- und Hochverrats gegenüber seinem zweiten Heimatstaat schuldig machen könnte. Vor diesem Hintergrund regelt die Haager Konvention, dass die Wehrpflicht nur dort abgeleistet werden muss, wo der Doppelbürger seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat (Hailbronner, 2001, S. 112). In der Schweiz bestehen hingegen einzelvertragliche Regelungen mit wenigen Staaten, so der Vertrag vom 11. November 1937 mit den Vereinigten Staaten, das Abkommen mit Frankreich vom 1. August 1958 und das Abkommen vom 15. Januar 1959 mit Kolumbien, die die Wehrpflicht im Falle von Doppelbürgern behandeln.
Durch die Bundesbeschlüsse vom 8.Dezember 1961 (SR-519-3) sowie vom 17. November 1971 (SR-511-13) über den Militärdienst der Auslandsschweizer und der Doppelbürger sind diese in Friedenszeiten vom Instruktionsdienst und der Erfüllung der Schiesspflicht befreit; dies ist jedoch nicht mit einer allgemeinen Befreiung von der Wehrpflicht gleichzusetzen, so dass Auslandsschweizer bei Rückkehr in die Schweiz wieder wehrpflichtig sind (zit. in BGE 122-II-59). Nach der Ableistung der Wehrpflicht im Ausland werden Schweizer Bürger nicht mehr in der Schweiz aufgeboten (BFA, 2001c), allerdings haben sie dann in der Regel einen Wehrpflichtersatz in Form einer Abgabe zu leisten. Analog zur Haager Konvention ist auch für die Schweiz der Wohnort zur Zeit der Aushebung für die Ableistung der Wehrpflicht maßgeblich (BFA, 2001c).
Eine Ausnahme zuungunsten eines Deutsch-Schweizer Doppelbürgers besteht jedoch, falls dieser in Deutschland wohnt und als Grenzgänger in der Schweiz arbeitet, so dass dieser in beiden Staaten wehrpflichtig ist (Hailbronner, 2001, S.115). Die Ausnahme wird durch den Bundesbeschluss vom 8.Dezember 1961 (SR-519-3) begründet, eine weitergehende Erläuterung erfolgt in der Literatur leider nicht. Nach meiner persönlichen Ansicht könnte in diesem Sonderfall die Problematik in der Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthaltsorts liegen, so dass beide Staaten von der Wehrpflicht für ihr Land ausgehen. Diese für den Betroffenen als ungerechtfertigt betrachtete Lösung könnte in der Realität insofern etwas gelindert werden, dass die Schweiz im Gegensatz zu Deutschland einen finanziellen Wehrpflichtersatz vorsieht.
3.3.2 Die Problematik des diplomatischen Schutzes bei Doppelbürgern
Der diplomatische Schutz von Doppelbürgern ist insofern problematisch, da hierbei Kompetenzkonflikte zwischen den beiden Heimatstaaten auftreten können. Hierbei lassen sich grundsätzlich 2 Fälle vorstellen: Zu einem der diplomatische Schutz eines Doppelbürgers in einem Land, dessen Staatsangehörigkeit er ebenfalls besitzt und der Aufenthalt in einem dritten Land mit Frage des zuständigen Heimatstaates.
Die Haager Konvention schließt in Art. 4 den diplomatischen Schutz eines Bürgers in einem Land, dessen Nationalität er zusätzlich besitzt aus (Prinzip der Staatengleichheit). Zur Regelung der Probleme in Hinblick auf die Staatsangehörigkeit im Verhältnis zu dritten Staaten stellt Art. 5 der Haager Konvention von 1930 auf die „effektive“ Staatsangehörigkeit ab, d.h. entscheidend hierfür ist für den Drittstaat der gewöhnliche Aufenthaltsort oder die Staatsangehörigkeit des Landes, mit dem der Bürger tatsächlich am meisten verbunden ist. Inzwischen geht die herrschende Lehre davon aus, dass vor dem Hintergrund zunehmender Globalisierung das Prinzip der „effektiven“ Staatsbürgerschaft auch in Konflikten zwischen den Heimatstaaten eines Doppelbürgers anzuwenden ist. Das Prinzip der „effektiven“ Staatsbürgerschaft gilt ebenfalls nach herrschender Lehre als allgemein anerkannte Regel des Völkerrechts (Hailbronner, 2001, S. 119) und somit auch für die Schweiz maßgeblich. Dies ist insofern für viele Doppelbürger eine Erleichterung, wenn der Verzicht auf eine Staatsbürgerschaft aufgrund von nationalen Gesetzen nicht möglich ist.
3.4 Probleme der Doppelbürgerschaft auf der Ebene des internationalen Privatrechts
Das Schweizer Internationale Privatrecht (IRPG) macht keinen Unterschied in Hinblick auf Schweizer oder ausländische Mehrstaater. Die direkte Zuständigkeit Schweizer Gerichte ergibt sich aus dem Besitz des Schweizer Bürgerrechts eines Auslandschweizers, dem es unmöglich oder unzumutbar ist, in seinem Aufenthaltsland gerichtlich vorzugehen. Das Schweizer IRPG geht - wie im Bereich des Völkerrechts – in diesem Fall nur von dem Schweizer Bürgerrecht aus, eine zweite Nationalität ist nicht maßgebend (sog. Ferrari-Prinzip).
Die „effektive“ Staatsbürgerschaft ist in diesem Fall nicht entscheidend; dies ist vor allem verständlich, da der Auslandschweizer seinen Aufenthaltsort außerhalb der Schweiz besitzt und so keine Möglichkeit auf Wahrnehmung des Schweizer Rechtsweges hätte (Westenberg, 1992, S.131).
Im Bereich des Internationalen Privatrechts gibt es einige Bereiche, für die die Staatsangehörigkeit der Betroffenen von Belang ist.
3.4.1 Das Personenrecht bei Doppelbürgern
Im Personenrecht ist die Staatsbürgerschaft nur im Namensrecht von Belang, da alle anderen das Personenrecht betreffenden Gebiete den Wohnsitz der betroffenen Person als Zuständigkeitsgrundlage nehmen. Grundsätzlich wird der Name einer in der Schweiz lebenden Person durch Schweizerisches Recht bestimmt; allerdings haben Ausländer gemäß Art. 37 IRPG das Recht, ihren Namen dem Heimatrecht zu unterstellen. Da hierbei ein Konfliktfall vorliegt, geht die herrschende Lehre davon aus, dass sich die Regelung nach dem effektiven Heimatrecht bemisst. Im Falle einer Namensänderung vor den Schweizer Behörden ist die Regelung ausschließlich dem Schweizer Recht unterworfen (Westenberg, 1992, S.133 -135).
3.4.2 Das Eherecht bei Doppelbürgern
Bei der Eheschließung eines Schweizers mit einem Doppelbürger ist zur Bestimmung des maßgeblichen Rechts eine Effektivitätsprüfung (siehe 3.3.2) vorzunehmen. Im Rahmen des Ehegüterrechts steht es den Ehegatten die Wahl frei, nach welchem Heimatrecht sich der Güterstand ergibt. Ist kein Recht gewählt worden, so wird das zuständige Recht abermals nach dem Effektivitätsgrundsatz ermittelt. Ebenso ist bei der Ehescheidung vorzugehen; ermöglicht das effektive, ausländische Heimatrecht der beiden Ehepartner keine Scheidung, so ist das Schweizer Recht entscheidend (Westenberg, 1992, S. 135 – 139).
3.4.3 Das Erbrecht
Handelt es sich um einen Doppelbürger mit Schweizer Bürgerrecht und Wohnsitz in der Schweiz, so kann er seinen Nachlass nach BGE 102 II 136 (zit. in Westenberg, 1992, S. 142) nach freier Wahl einem seiner Heimatrechte unterstellen. Dieser Entscheid wird von der herrschenden Meinung kritisiert, da hierbei die nach Schweizer Recht vorgesehenen Pflichteile je nach Ausgestaltung des anzuwendenden Heimatrechts umgangen werden können, so dass vielmehr ausschließlich Schweizer Recht verbindlich sein sollte. Der Nachlass eines Schweizer Doppelbürgers mit Wohnsitz im Ausland unterliegt dagegen ausschließlich Schweizer Recht (Westenberg, 1992, S.141-144).
3.5 Tendenzen zur Hinnahme der doppelten Staatsbürgerschaft
Die Entwicklung in der Schweiz und auch die temporäre Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft in der Bundesrepublik Deutschland zeigen eine Wandelung in der Einstellung zum Doppelbürgerrecht. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Migration und Globalisierung leben viele Personen nicht in dem Land, dessen Nationalität sie besitzen und haben ihren beruflichen und persönlichen Lebensmittelpunkt im Ausland. In der Schweiz und vielen anderen demokratischen Staaten sind Ausländer bis auf die politischen Rechte den Staatsbürgern gleichgestellt. In der Schweiz führte dies dazu, dass seit der Revision des Bürgerrechts von 1992 die Zahl der Einbürgerungen sich mehr als verdreifacht hat (Hailbronner, 2001, S. 135).
Interessant ist ebenfalls, dass Spanien ein ähnliches Modell der doppelten Staatsbürgerschaft mit Lateinamerikanischen Staaten wie Chile durch Staatsverträge geschaffen hat. Ausgehend von gemeinsamen historischen Wurzeln, die sich in gleicher Sprache, Tradition und Kultur zeigen und dazu führen, dass sich Spanier in Chile nicht als Ausländer fühlen, sehen die Verträge eine „herrschende“ und eine „ruhende“ Staatsbürgerschaft vor, die der herrschenden nachgeordnet ist (Hailbronner, 2001, S.137).
Unter der Berücksichtigung, dass die Schweizer Eidgenossenschaft kein einheitliches Staatsvolk im Sinne einer einheitlichen Sprache und Kultur – Stichwort Röstigraben -, sondern verschiedene historische Abstammungen besitzt, sind die Parallelen zu Spanien erkennbar. Im Falle der Deutschschweizer Bevölkerung sind solche Anknüpfungspunkte traditioneller, sprachlicher und kultureller Art in Hinblick auf Österreich und Deutschland denkbar.
3.6 Politische Argumentation zur doppelten Staatsbürgerschaft
3.6.1 Gegner der doppelten Staatsbürgerschaft
Im Rahmen der Diskussionen in Deutschland über die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts war zunächst die Möglichkeit des Besitzes zweier Staatsbürgerschaften von Seiten der Bundesregierung erwogen worden; infolge der Diskussion wurde von Seiten der konservativen Parteien mit Unterschriftsaktionen gegen die doppelte Staatsbürgerschaft gedroht, da eine große Mehrheit der Bevölkerung dagegen schien. Die damals in Deutschland vorgebrachten Argumente lassen sich auch analog auf die Schweizer Verhältnisse anwenden.
Kritiker damals wie heute argumentieren mit einer demokratietheoretisch problematischen Entwicklung, da Doppelbürger in zwei Staaten das Wahlrecht besitzen und so auch über politische Themen mitbestimmen können, die sie aufgrund ihrer örtlichen Abwesenheit nicht betreffen (Hangartner, 2001, S. 964). Auch das von Befürwortern der doppelten Staatsbürgerschaft verwendete Argument der besseren Integration durch die Verleihung der einheimischen Staatsbürgerschaft, ohne hierbei die bisherige Staatsbürgerschaft aufgeben zu müssen, entpuppt sich nach Ansicht der Gegner nur als Schein, da Integrationsprobleme und innere Zugehörigkeit zum Staat nur scheinbar gelöst würden und die betroffenen Personen auch nicht mehr in den Ausländerstatistiken erscheinen. Aus der Sicht der einheimischen Bevölkerung besteht auch die Gefahr der mangelnden Loyalität des Doppelbürgers mit dem Staat, ein Faktum, was die Integration von Ausländern mittels doppelter Staatsbürgerschaft eher erschweren als erleichtern könnte. Der von Teilen der Bevölkerung psychologisch wahrgenommene Zustand der Privilegierung von Mehrstaatern hat sich insbesondere in Deutschland als besonders verbreitet erwiesen.
Auch die Notwendigkeit der Effektivitätsprüfung, die sich – wie bereits zuvor beschrieben – im Internationalen Privatrecht in vielen Rechtsgebieten notwendig ist, birgt die Gefahr der Ungleichbehandlung und lang anhaltender Rechtskonflikte, da es sich hierbei um eine Ermessensentscheidung der Gerichte handeln kann. Ebenso problematisch wurde in Deutschland die Einführung der Optionslösung gesehen; hierbei könnten Klagen Betroffener gegen ihre Entscheidungspflicht für eine Staatsangehörigkeit ein langwieriges juristisches Streiten erzeugen, da viele Fragen bisher nicht eindeutig geklärt sind. So ist beispielsweise unklar, welche Nationalität das Kind eines Doppelbürgers, der noch nicht 23 Jahre ist und sich dementsprechend noch nicht erklären muss, haben kann. In dem Fall ist es unklar, ob das Kind kraft ius soli - Prinzip (der Elternteil ist ja zum Zeitpunkt der Geburt Deutscher) die Deutsche Staatsbürgerschaft erwirbt, oder – wie der Elternteil – die Deutsche Staatsangehörigkeit mangels Erklärung vor seinem 23. Lebensjahr wieder verliert.
3.6.2 Befürworter der doppelten Staatsbürgerschaft
Für die Befürworter einer „schrankenlosen“ doppelten Staatsbürgerschaft sind Modelle wie die Deutsche Optionslösung zur Vermeidung der Mehrstaatigkeit oder gar das Verbot derselben mit einem hohen Verwaltungs- und Kontrollaufwand verbunden oder lassen sich gar nicht von Seiten des Staates effektiv unterbinden, womit die Tolerierung bzw. Legalisierung einer doppelten Staatsbürgerschaft eine effektive und gerechte Lösung gegenüber allen Bürgern wäre. Die Möglichkeit, zwei Staatangehörigkeiten offiziell zuzulassen, wäre nur eine Legalisierung der bisher schon vorherrschenden Realität, da bereits viele Personen eine zweite Nationalität ohne das Wissen ihres Heimatlandes besitzen.
Als gewichtiges Argument werfen die Befürworter in die Schale, dass Ausländer in ihrem Aufenthaltsland, in dem sie in die Gesellschaft eingegliedert sind und auch Steuern zu zahlen haben, nicht von der politischen Mitbestimmung, verkörpert durch das Wahlrecht ausgeschlossen werden dürfen. Ebenso würde durch die Beibehaltung ihrer bisherigen (ausländischen) Staatsangehörigkeit die kulturellen und familiären Bindungen zur Heimat nicht gekappt und dennoch eine bessere Integration im Aufenthaltsland erreicht.
4 Persönliche Würdigung der doppelten Staatsbürgerschaft
Zum Abschluss des Themas „doppelte Staatsbürgerschaft“ möchte ich noch einige persönliche Gedanken darlegen. Bei der Position des Einzelnen für oder gegen die doppelte Staatsbürgerschaft sind die Ansichten der Befürworter und der Gegner sicherlich ganz oder teilweise beinhaltet. Für mich persönlich, der nur eine Staatsbürgerschaft besitzt, ist das Unverständnis von großen Teilen der Bevölkerung zur Notwendigkeit einer zweiten Staatsbürgerschaft nachvollziehbar, vor allem, wenn man bedenkt, dass damit eine Verdopplung der staatsbürgerlichen Rechte (Wahlrecht), aber nur einmalige Pflichten (Wehrdienst, Steuerpflicht) verbunden ist. Ebenfalls ist von einem Bürger, der die Staatsangehörigkeit eines Landes besitzt, volle Loyalität gegenüber diesem Staat zu verlangen; der Bürger selbst jedoch steht vor dem Problem, dass er „nicht zwei Herren gleichzeitig dienen kann“. Eine Lösung des Problems könnte in meinen Augen sein, das Wahlrecht nicht mehr von der Nationalität, sondern vom Aufenthaltsort des Wahlberechtigten abhängig zu machen, ähnlich der Kommunalwahlen innerhalb der EU.
Betrachtet man nun die Bestrebungen der EU, ein Unionsbürgerrecht einzuführen, um das Zusammenwachsen Europas zu dokumentieren, so erscheint es nicht nachvollziehbar, dass ein EU-Bürger seine bisherige Staatsangehörigkeit zu Gunsten der deutschen Staatsangehörigkeit aufzugeben hat; anderseits besitzt er als EU-Bürger in einem anderen EU-Staat das Wahlrecht auf kommunaler Ebene, so dass sich die Frage stellt, in wieweit er überhaupt noch das Bedürfnis am Erwerb des Wahlrechts auf Länder- und Bundesebene aufgrund einer zweiten Staatsbürgerschaft besitzt.
Vor diesem Hintergrund wird im Bereich der EU im Laufe der Zeit die Nationalität des einzelnen Bürgers wohl nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, so dass auch das Bedürfnis nach einer doppelten Staatsbürgerschaft zurückgehen wird.
Für die Schweiz hingegen ist, solange sie der EU (noch) nicht beitritt, die Ermöglichung der doppelten Staatsbürgerschaft durchaus vor dem Hintergrund der drei großen Sprachgruppen und deren Bindungen zum Ausland nachvollziehbar. Ebenso kann sie für die Schweiz als Ausdruck der Tradition einer „Konsensdemokratie“ gesehen werden, die sich tolerant und pluralistisch gegenüber seinen Bürgern zeigt. Durch die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft haben sich die Einbürgerungszahlen in der Schweiz vervielfacht, so dass eine bedeutende Anzahl an Ausländern endgültig in die Schweizer Gesellschaft integriert werden konnte. Es bleibt abzuwarten, ob ein ähnlicher Erfolg der neuen Initiative zur Erleichterung der Einbürgerung von Ausländern gelingt.
Literaturverzeichnis:
Beauftragte der Bundesregierung, Bundesministerium des Inneren [BMI]. (1999). Das neue
Staatsangehörigkeitsrecht. Gefunden am 12.4.02 unter http://www.einbuergerung.de/download/staatsangehoerigkeit.pdf
Bundesamt für Ausländerfragen [BFA]. (2001a). Übersicht über die Einbürgerungsarten in der Schweiz. Gefunden am 10.5.02 unter http://www.auslaender.ch/einbuergerung/informationen/uebersicht_d.asp
Bundesamt für Ausländerfragen [BFA]. (2001b). Fragen zum Doppelbürgerrecht. Gefunden am 12.4.02 unter http://www.auslaender.ch/einbuergerung/informationen/doppelbuergerrecht_d.asp
Bundesamt für Ausländerfragen [BFA].(2001c). Internationale Rechtsquellen. Gefunden am 12.4.02 unter http://www.auslaender.ch/rechtsgrundlagen/rechtsquellen/internationale/index_d.asp
Deutsches Lehrmittel- und Kulturzentrum Kirov.(2001). Die Schweiz. Gefunden am 13.5.03 unter http://home.arcor.de/dz-kirov/dzk09_01.shtml
Häfelin, U. & Haller, W. (2001). Schweizer Bundesstaatsrecht.(5.Aufl.). Zürich: Schulthess
Hailbronner, K. & Renner, G. (2001). Staatsangehörigkeitsrecht. (3.Aufl.).München: Beck
Hangartner, Y.(2001). Grundsätzliche Fragen zum Einbürgerungsrecht. AJP-PJA, 2001, S. 949-967. Gefunden am 13.5.2002 unter http:www.swisslex.ch,
Dokument AJP-PJA-2001-949_967
Neue Zürcher Zeitung. (2000, 12.August). 580 000 Auslandsschweizer – 70 Prozent mit Doppelbürgerrecht, S. 14
Thürer, D., Aubert, J.-F., Müller, J.P.(Hrsg).(2001). Verfassungsrecht der Schweiz.. Zürich: Schulthess
Westenberg, C. (1992). Staatsangehörigkeit im schweizerischen IRPG. In Schweizer Vereinigung für Internationales Recht (Hrsg.), Schweizer Studien zum Internationalen Recht. Bd.74. Zürich: Schulthess
Staaten, deren Bürger durch Einbürgerung in der Schweiz ihre Staatsangehörigkeit automatisch verlieren:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: BFA (2001b)
[...]
[1] Häfelin und Haller (2001, S. 377) sehen im obligatorischen Referendum die Gefahr des Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot aufgrund der Herkunft des Betroffenen; Hangartner (2001, S 966) bemängelt die Wahrung der Grundrechte (Willkür- und Diskriminierungsverbot).
[2] Im Anhang findet sich eine detaillierte Liste des BFA mit der Unterscheidung der Staaten
Häufig gestellte Fragen zum Thema Staatsbürgerschaft
Was ist das Schweizer Bürgerrecht?
Das Schweizer Bürgerrecht besteht aus drei untrennbaren Einheiten: dem Gemeinde-, Kantons-, und Schweizer Bürgerrecht. Das Schweizer Bürgerrecht verkörpert die Zugehörigkeit zum schweizerischen Staatenverband und kann als "schweizerische Staatsangehörigkeit" betrachtet werden.
Welche Rechte und Pflichten sind mit dem Schweizer Bürgerrecht verbunden?
Bürger haben politische Mitwirkungsrechte, diplomatischen Schutz im Ausland, Niederlassungsfreiheit, und dürfen nicht ohne Einwilligung ausgeliefert oder ausgewiesen werden. Pflichten beinhalten Militärdienst für Männer und das Verbot, in einer fremden Armee Dienst zu leisten.
Wie erwirbt man das Schweizer Bürgerrecht?
Das Schweizer Bürgerrecht kann durch Abstammung (ius sanguinis), Heirat, Adoption oder Einbürgerung (ordentlich oder erleichtert) erworben werden.
Was ist die ordentliche Einbürgerung?
Die ordentliche Einbürgerung steht Ausländern offen, die seit mindestens 12 Jahren in der Schweiz leben und in einem dreistufigen Verfahren durch Bund, Kanton und Gemeinde geprüft werden.
Was ist die erleichterte Einbürgerung?
Die erleichterte Einbürgerung richtet sich vorrangig an Ehepartner von Schweizern und ausländische Kinder eines Schweizer Elternteils, die nicht bereits von Gesetzes wegen das Bürgerrecht besitzen.
Kann das Schweizer Bürgerrecht entzogen werden?
Ja, das EJPD kann in Zusammenarbeit mit dem Heimatkanton einem Schweizer Bürger das Bürgerrecht entziehen, wenn sein Verhalten das Ansehen der Schweiz negativ beeinflusst oder gegen das Interesse der Schweiz ist, vorausgesetzt er hat keinen Wohnsitz in der Schweiz und wird dadurch nicht staatenlos.
Was ist die doppelte Staatsbürgerschaft?
Die doppelte Staatsbürgerschaft liegt vor, wenn eine Person neben dem Schweizer Bürgerrecht noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzt. Seit 1992 ist die doppelte Staatsbürgerschaft aus Schweizer Sicht grundsätzlich möglich.
Wie kommt es zu einer doppelten Staatsbürgerschaft?
Kinder mit Eltern unterschiedlicher Staatsangehörigkeiten, Geburt im Ausland (ius soli-Prinzip), Einbürgerung in der Schweiz ohne Aufgabe der bisherigen Nationalität, oder Annahme der Nationalität des Wohnlandes als Auslandsschweizer können zu einer doppelten Staatsbürgerschaft führen.
Wie geht Deutschland mit der doppelten Staatsbürgerschaft um?
Deutschland lässt in der Regel keine doppelte Staatsbürgerschaft zu. Es gibt jedoch Ausnahmen für Personen, denen die Aufgabe ihrer ausländischen Staatsangehörigkeit unzumutbar ist (z.B. anerkannte Flüchtlinge).
Welche Probleme können durch die doppelte Staatsbürgerschaft entstehen (öffentliches Recht)?
Konflikte können in Bezug auf Wehrpflicht und diplomatischen Schutz entstehen. Die Haager Konvention regelt, dass die Wehrpflicht in der Regel dort abgeleistet werden muss, wo der Doppelbürger seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat.
Wie wird der diplomatische Schutz bei Doppelbürgern geregelt?
Die Haager Konvention schließt den diplomatischen Schutz eines Bürgers in einem Land, dessen Nationalität er zusätzlich besitzt, aus. Im Verhältnis zu dritten Staaten stellt die Konvention auf die "effektive" Staatsangehörigkeit ab.
Welche Rolle spielt die Staatsangehörigkeit im internationalen Privatrecht?
Die Staatsangehörigkeit spielt eine Rolle im Namensrecht, Eherecht und Erbrecht, wobei oft auf die "effektive" Staatsangehörigkeit abgestellt wird.
Gibt es Tendenzen zur Hinnahme der doppelten Staatsbürgerschaft?
Ja, die zunehmende Migration und Globalisierung führen zu einer Wandelung in der Einstellung zum Doppelbürgerrecht. In der Schweiz hat die Revision des Bürgerrechts von 1992 zu einer Verdreifachung der Einbürgerungen geführt.
Welche Argumente werden gegen die doppelte Staatsbürgerschaft vorgebracht?
Kritiker argumentieren mit einer demokratietheoretisch problematischen Entwicklung, da Doppelbürger in zwei Staaten das Wahlrecht besitzen, und mit der Gefahr mangelnder Loyalität gegenüber dem Staat.
Welche Argumente werden für die doppelte Staatsbürgerschaft vorgebracht?
Befürworter argumentieren, dass die Tolerierung einer doppelten Staatsbürgerschaft eine effektive und gerechte Lösung wäre, und dass Ausländer, die in die Gesellschaft eingegliedert sind und Steuern zahlen, nicht von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen werden dürfen.
- Quote paper
- Stephan Lohnert (Author), 2002, Das Doppelbürgerrecht in der Schweiz und der BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108471