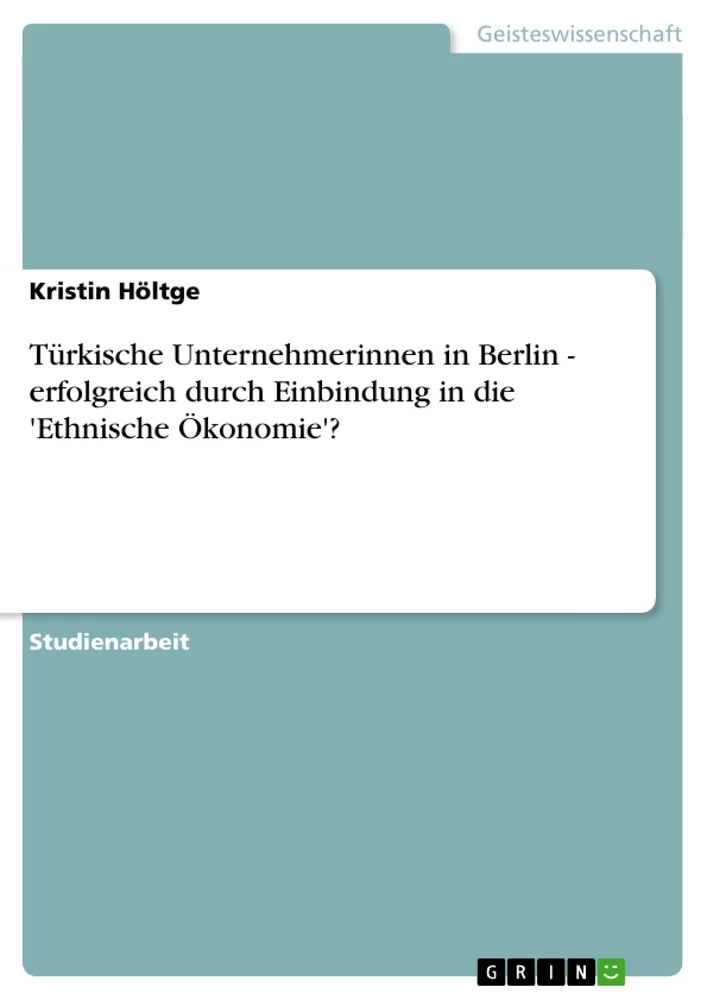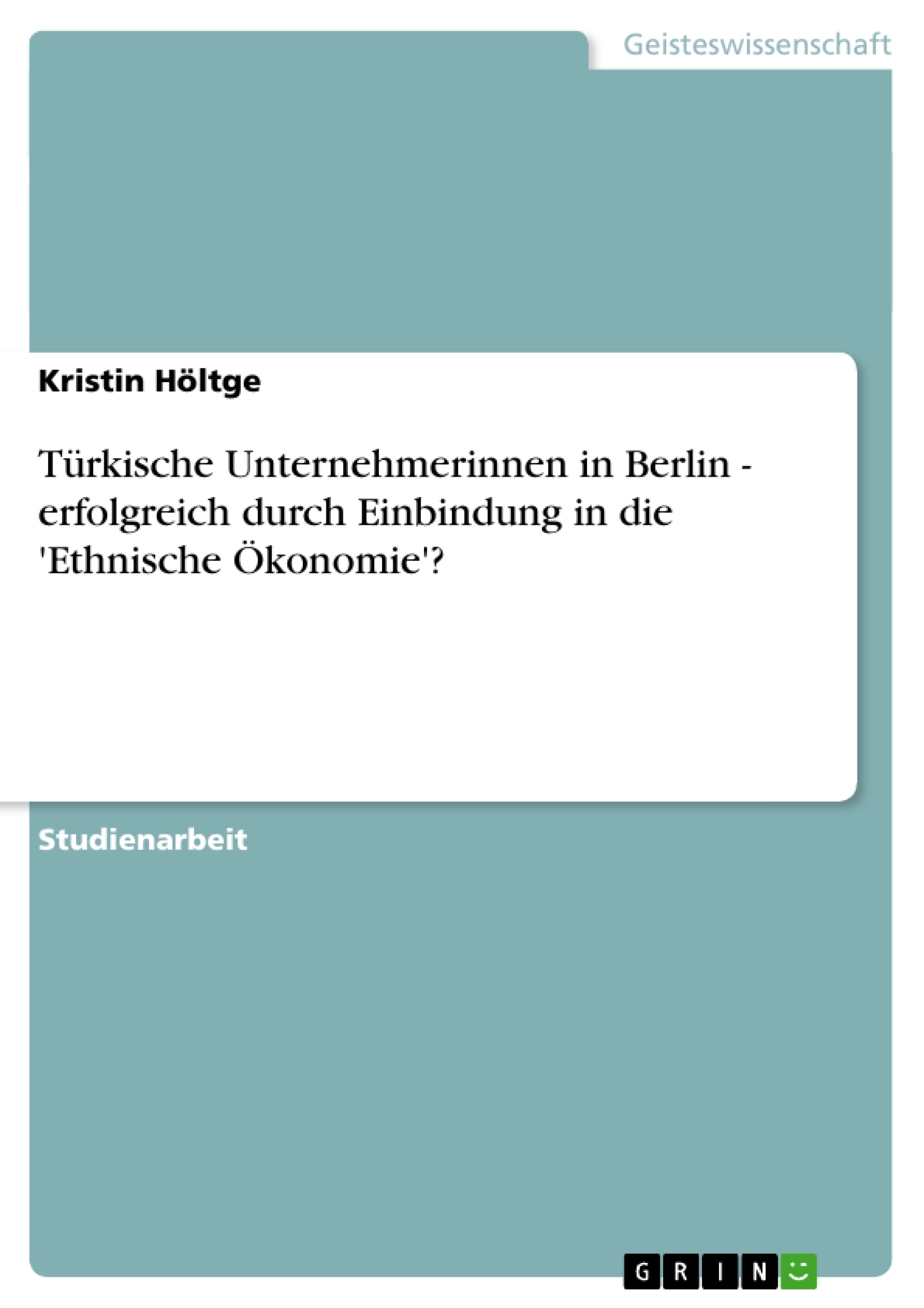Vergessen Sie alles, was Sie über die "Ethnische Ökonomie" zu wissen glauben! Tauchen Sie ein in eine faszinierende Analyse, die gängige Vorstellungen über türkische Unternehmerinnen in Berlin auf den Kopf stellt. Entgegen der landläufigen Meinung, dass der Erfolg türkischer Unternehmen auf ethnischer Solidarität und engen Beziehungen innerhalb der Community beruht, enthüllt diese Studie eine überraschende Realität. Basierend auf Interviews mit türkischen Geschäftsfrauen in verschiedenen Branchen – von der Lebensmittelindustrie über Textilgeschäfte bis hin zu Reisebüros – widerlegt diese Arbeit die Annahme, dass "ethnische" Merkmale der Schlüssel zum Erfolg sind. Stattdessen zeigt sich, dass diese Frauen sich zunehmend von traditionellen Strukturen abwenden und sich auf dem deutschen Markt etablieren. Die Analyse beleuchtet die demografische Entwicklung der türkischen Bevölkerung in Deutschland, die Arbeitsmarktsituation und die spezifischen Herausforderungen, mit denen türkische Unternehmerinnen konfrontiert sind. Untersucht werden die ethnische Zusammensetzung der Belegschaft, der Kundenkreis, die Lieferantenbeziehungen, die Vernetzung innerhalb der Community und die Finanzierungsquellen. Die Ergebnisse zeigen, dass türkische Unternehmerinnen oft weniger von ethnischer Unterstützung profitieren als ihre männlichen Kollegen. Sie sind häufiger mit Schwierigkeiten bei der Einstellung türkischer Mitarbeiter konfrontiert und erhalten seltener finanzielle Unterstützung aus der Familie. Diese Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf die Rolle von Frauen in der Migrationsforschung und fordern eine differenziertere Betrachtung der "Ethnischen Ökonomie". Ein Muss für alle, die sich für Migrationsforschung, Gender Studies, Unternehmertum und die deutsche Wirtschaft interessieren. Entdecken Sie die verborgenen Erfolgsfaktoren dieser innovativen und unabhängigen Unternehmerinnen, die ihren eigenen Weg gehen und die deutsche Wirtschaft bereichern. Erfahren Sie, wie sie sich in einem sich wandelnden Arbeitsmarkt behaupten und welche Rolle Bildung, Integration und soziale Netzwerke dabei spielen. Lassen Sie sich von den Geschichten dieser starken Frauen inspirieren und gewinnen Sie neue Einblicke in die komplexen Dynamiken der modernen Einwanderungsgesellschaft. Eine essenzielle Lektüre, die zum Umdenken anregt und neue Perspektiven eröffnet!
Inhalt
0 Einleitung: Wahrnehmungen hinterfragen
1 Begriffserklärung: „Ethnische Ökonomie“
2 Überblick über die Zuwanderung nach und die Arbeitsmarktsituation in Deutschland
3 Charakteristik der Wirtschaftsaktivitäten türkischer Unternehmerinnen in Berlin
3.1 Ethnische Struktur der Arbeitskräfte
3.2 Kundenkreis
3.3 Lieferanten
3.4 Vertikale und horizontale Vernetzung
3.5 Finanzierung
4 Zusammenfassung und Fazit
Literatur
0 Einleitung: Wahrnehmungen hinterfragen
Ein Spaziergang durch Kreuzberg 36 bestätigt schnell die Erwartungen auswärtiger Besucherinnen und Besucher bezüglich der türkischen community: Ein Obst- und Gemüse-Stand übertrifft den nächsten an Farbenprächtigkeit und Auswahl, Verkäufer Murat aus der Oranienstraße weiß, dass sein Kollege zwei Häuserblocks weiter die bei ihm nicht vorrätigen Datteln im Angebot hat, ein Dritter bekommt gerade frische Ware, und zwar von Achmed, dessen Neffe gewöhnlich beim Döner Kebab um die Ecke aushilft. Türkisches Business - erfolgreich (nur) aufgrund enger ethnischer Beziehungen?
Dieser Aufsatz will hinter die Kulissen schauen und das Konzept der „Ethnischen Ökonomie“ (EÖ) auf seine flächendeckende Anwendbarkeit zur Erklärung des unternehmerischen Erfolges in der türkischen community überprüfen. Geht die gängige Literatur zur Migrationsforschung davon aus, dass der Erfolg türkischer Gewerbetreibender auf der Nutzung komparativer Vorteile, wie intra-familiäre Arbeitsteilung beruht,[1] so wird der vorliegende Aufsatz diese These zumindest bezüglich der türkischen Geschäftsfrauen widerlegen.
Kapitel 1 wird einführend den Begriff der EÖ definieren, Kapitel 2 skizziert kurz die Chronologie türkischer Einwanderung unter demografischen Gesichtspunkten sowie die parallelen Entwicklungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. In Kapitel 3 werden detailliert empirische Ergebnisse über die Wirtschaftsaktivitäten türkischer Unternehmerinnen in Berlin unter dem Blickwinkel ihrer Einbindung in die EÖ präsentiert. Insbesondere sollen die ethnische Struktur der Arbeitskräfte, Kunden- und Lieferantenkreis sowie Kreditbeziehungen näher beleuchtet werden. Grundlage hierfür ist eine vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) herausgegebenen Studie, die auf Interviews mit 50 im türkischen Gewerbe arbeitenden Frauen beruht.[2] Dieser qualitative Ansatz ermöglicht einen direkten Zugang zu subjektiven Erfahrungen und Wahrnehmungen aus der Perspektive der Türkinnen und füllt somit ein bisheriges Forschungsdesiderat. Das abschließende Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen und liefert einen Ausblick.
1 Begriffserklärung: „Ethnische Ökonomie“
In der gängigen Literatur[3] wird unter EÖ das cluster [4] von ethnisch organisierten Unternehmen verstanden, welche von einer nicht-einheimischen Bevölkerungsgruppe betrieben wird. Konkret müssen vier Bedingungen erfüllt sein:
- Die Unternehmen der EÖ sind horizontal, d. h. auf gleicher Produktionsebene, sowie vertikal, als zwischen vor- und nachgelagerten Produktionsebenen, vernetzt.
- Es werden hauptsächlich „ethnische“ Arbeitskräfte eingestellt.
- Den Kundenkreis für die angebotenen Güter und Dienstleistungen bildet mehrheitlich dieselbe ethnische community.
- Ebenso dominieren ethnische Unternehmen den Kreis der Lieferanten.
Als maßgebliche Ressource wird außerdem ethnische Solidarität angesehen.
Die Rolle der Frauen wurde bisher in der Migrationsforschung vernachlässigt oder auf Aspekte der Familienverpflichtungen und der damit einhergehenden Arbeitsteilung reduziert. Feministische Ansätze vermuten, dass die Beschäftigung weiblicher Familienmitglieder in der EÖ stark von patriarchalen Kontrollstrategien geprägt ist. Floya Anthias geht davon aus, dass die Nutzung der weiblichen Arbeitskraft jedoch notwendig ist, damit sich eine EÖ überhaupt erst herausbilden kann.[5] Daher wird die Frau im folgenden als Akteurin innerhalb der EÖ betrachtet.
2 Überblick über die Zuwanderung nach und die Arbeitsmarktsituation in Deutschland
Zur konkreten Erfassung der aktuellen Situation der Türkinnen und Türken empfiehlt sich zunächst ein Rückblick auf die demografische Entwicklung in der Bundesrepublik sowie auf die Arbeitsmarktsituation der 90er Jahre:
Seit dem Anwerbeabkommen 1961 ist die Zahl türkischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland stetig gestiegen und erreichte bereits 1975 die Millionengrenze. Mit Erlass des Gesetzes über den Anwerbestopp im Jahre 1973 jedoch änderte sich die Struktur der türkischen Bevölkerung in Deutschland. Durch Familienzuzug wuchs der Anteil der Frauen stark an, er betrug im Jahre 2000 45,8 %.[6]
Die sich mit der deutschen Wiedervereinigung weiter zuspitzende Lage auf dem Arbeitsmarkt wirkte sich besonders auf die Beschäftigung der ausländischen Bevölkerung negativ aus: Der Anteil dieser an der Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Berlin sank von 11,6 % 1991 auf 7,2 % im Jahr 1997.[7] Die Arbeitslosenquote bestätigt diese Entwicklung: Im Februar 2002 betrug sie insgesamt in Berlin 17,0 %, unter den Ausländern jedoch 39,1 %.[8] Besonders betroffen sind ausländische Frauen. Während die Anzahl der deutschen beschäftigten Frauen zwischen 1996 und 2000 nahezu konstant blieb[9], sank die Zahl ausländischer beschäftigter Frauen im gleichen Zeitraum um etwa 16 %.[10] Bezüglich der türkischen Bevölkerung ist festzustellen, dass die Anzahl registrierter Arbeitsloser von 6 230 im Jahre 1990 in den folgenden sechs Jahren auf 17 464 gestiegen ist.[11]
Wenig überraschend ist daher der verstärkte Trend zur Selbständigkeit als Alternative zur drohenden bzw. eingetretenen Arbeitslosigkeit. Das Zentrum für Türkeistudien spricht von einem "Gründerboom unter den Türken" in den 90er Jahren und verweist auf eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Zahl türkischer Selbständiger in den Jahren 1985 bis 2000 von 11 %.[12] Der Anteil weiblicher Selbständiger nimmt im Zuge des steigenden Bildungs- und Qualifikationsniveaus zu und erreichte im Jahr 2000 20,3 % der türkischen Gewerbetreibenden.[13]
3 Charakteristik der Wirtschaftsaktivitäten türkischer Unternehmerinnen in Berlin
Interessant ist nun, die Erfolgsfaktoren türkischer Unternehmerinnen zu analysieren, um zu prüfen, inwieweit das Konzept der EÖ auf sie anwendbar ist und damit "ethnische" Merkmale die Quelle des Unternehmenserfolges bilden.
Die nachfolgenden Ergebnisse basieren auf der bereits erwähnten von Felicitas Hillmann am WZB verfassten Studie „Türkische Unternehmerinnen und Beschäftigte im Berliner ethnischen Gewerbe“. Zwei Drittel der befragten Frauen arbeiten selbständig, ein Drittel als abhängig Beschäftigte, und zwar in folgenden Branchen: Nahrungsmittelsektor, Textilbranche, Reisebüros, Kosmetik und Schönheitspflege, Kioske, Reinigungsdienste.
Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Mehrheit der selbständigen Frauen der zweiten Generation türkischer Einwanderinnen zuzurechnen ist, in Deutschland ihren Schulabschluss erlangt hat und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt bzw. beantragt hat, also dadurch und durch die Entscheidung zur Eröffnung eines Gewerbes ein gewisses Integrationsbestreben zeigt.[14] Eine junge türkische Kioskbesitzerin beschreibt ihre Situation folgendermaßen:
„Ja, das ist typisch für die 2. Generation. Wir haben sehr lange gebraucht, um uns zu qualifizieren, aber der Einstieg in den Arbeitsmarkt hat nicht so geklappt. Es bleibt dann nur Arbeitslosigkeit oder Selbständigkeit.“[15]
Die Ergebnisse der mit den Türkinnen geführten Interviews wurden mit Blick auf die in Kapitel 1 dargestellte Charakteristik der EÖ ausgewertet. Als weiterer Indikator für die Beurteilung der Zugehörigkeit zu dieser wurde die Art der Startfinanzierung hinzugefügt.
3.1 Ethnische Struktur der Arbeitskräfte
Die Beschäftigung „ethnischer“ Arbeitskräfte ist nicht die Regel. Lediglich die Kioske stellen ausschließlich türkische Mitarbeitende ein. In anderen Branchen dagegen, wie Reisebüros und Reinigungsdienste, beläuft sich der Anteil türkischer Beschäftigter auf lediglich ein Drittel, im Kosmetik- und Schönheitspflegebereich sind es je nach Betriebsgröße 40 - 60 %. Auffallend in der Reisebranche ist, dass kein Büro Familienmitglieder einstellt, bei den Befragten der meisten anderen Branchen werden "gelegentlich" Familienmitglieder beschäftigt, lediglich in Kiosken arbeiten 100 % Familienmitglieder.[16]
3.2 Kundenkreis
Bei der Wahl des Standortes war für die Mehrzahl der Selbständigen die Nähe zu Freundeskreis, Familie und türkischer community von geringer Bedeutung.[17],[18] Dahingegen wählten immerhin 14 % der Selbständigen bewusst den Ort ihres Geschäfts in von Deutschen dominierten Stadtteilen, u. a. wegen deren höherer Kaufkraft. Bei 38 % hatte sich der Standort allerdings "so ergeben".
Auch bezüglich der Platzierung von Werbung lässt sich ein Trend hin zu deutscher Kundschaft feststellen. Drei Unternehmerinnen planen Anzeigen in türkischen Publikationen, neun dagegen in deutschen Medien. 62 % der Unternehmerinnen hoffen auf türkische wie auf deutsche Kundschaft, nur eine einzige möchte insbesondere türkische Kundinnen und Kunden anziehen.
3.3 Lieferanten
Die Beziehungen zu Lieferanten bestätigen die zuvor genannte Orientierung türkischer Unternehmerinnen: 24 Frauen kooperieren hauptsächlich mit deutschen Firmen, 16 hauptsächlich mit türkischen. In der Branche Körperpflege war kein einziger Lieferant türkischer Herkunft.
3.4 Vertikale und horizontale Vernetzung
Aus der Studie sind keine Erkenntnisse bezüglich der Vernetzung türkischer Unternehmen zu entnehmen. Sogenannte linkages,[19] wie sie aus dem industriellen Sektor bekannt sind, treten im Diensleistungsbereich, zu dem fast alle befragten Unternehmen gehören, generell seltener auf.
Die Autorin vermutet, dass Verflechtungen zwischen den türkischen Unternehmen der Fallstudie gelegentlich anzutreffen sind, jedoch keineswegs den betrieblichen Arbeitsprozess bestimmen.
Das Zentrum für Türkeistudien betont die Verflechtung zwischen türkischer und deutscher Wirtschaft, vor allem in der Lebensmittelbranche. Schlussfolgerungen über eine eher geringe Verflechtung innerhalb der community weiblicher türkischer Unternehmerinnen sind daraus sicher nicht abzuleiten, werden von der Autorin aber aus o. g. Gründen vermutet.
3.5 Finanzierung
Entgegen den Erwartungen, dass Familienmitglieder als hauptsächliche Kreditgeber agieren, ist festzustellen, dass das Verhältnis der Finanzierungsquellen ausgewogen ist: 39 % der Unternehmerinnen wurde für die Unternehmensgründung ein Bankkredit gewährt, 41 % erhielten Finanzmittel von Familienangehörigen, 31 % nutzten ihr Sparguthaben.[20]
4 Zusammenfassung und Fazit
Die anfangs vermutete These konnten bestätigt werden:
Türkische Frauen sind überdurchschnittlich hoch von Arbeitslosigkeit betroffen und suchen vermehrt seit den 90er Jahren einen Ausweg in der Selbständigkeit.
Das vielzitierte auf ethnische Solidarität beruhende und auch von männlichen Kollegen betonte Erfolgspotential für türkische Selbständige scheint jedoch auf die männlichen türkischen Gewerbetreibende beschränkt. Türkische Unternehmerinnen können weder personell (bezüglich der Beschäftigten, Kunden und Lieferanten), finanziell (durch günstige Kredite aus der Familie) noch realwirtschaftlich (güterbezogen) von der türkischen community besonders profitieren.
Im Gegenteil, die Beschäftigung türkischer Mitarbeiter, v. a. türkischer Männer, erweist sich zum Teil als problematisch, einerseits aufgrund fehlender Fachkenntnisse, andererseits aufgrund Hierarchie- und damit Kompetenz-Schwierigkeiten.[21] Eine Entlastung türkischer Frauen von Haushalts- oder Kinderbetreuungspflichten wegen ihrer Aufgaben als Unternehmerinnen stellt die Ausnahme dar. Unterstützung erfahren die Frauen lediglich in der Anfangsphase der Unternehmensgründung, meist von Freundinnen.[22]
Damit sei erneut vor einer genderblinden Betrachtung sozialer Phänomene gewarnt. Geschlechtsspezifische Untersuchungen können, wie dieser Aufsatz zu zeigen versucht hat, zu erheblich von mainstream -Wahrnehmungen abweichenden Ergebnissen führen, die in Sozial- und kommunaler Wirtschaftspolitik Berücksichtigung finden sollten.
Die naheliegende Vermutung, dass sich türkische Unternehmerinnen schon vor Geschäftseröffnung vom türkischen Umfeld distanziert haben, um überhaupt den Weg in die Selbständigkeit gehen zu können, wirft weiterführende wissenschaftliche Fragestellungen auf, die hier nicht beantwortet werden konnten. Konzentriert sich dieser Aufsatz auf die Erkenntnis, dass die Wirtschaftsaktivitäten türkischer Unternehmerinnen kaum von der Vorteilen der EÖ profitieren und dieser auch nicht zuzurechnen sind, bleibt außerdem Forschungsbedarf zur Beantwortung der Frage, welche Faktoren denn dann erfolgsdeterminierend für Ayşe und Esra sind.
Literatur
Backs, Lilian u. a. (1990): Die räumliche Ausbreitung türkischer Wirtschaftsaktivitäten in Berlin
(West). Schnellimbisse, Restaurants, Gemüseläden. Eine empirische Studie zur Frage nach den Integrationsmöglichkeiten türkischer Selbständiger, Occasional Paper, FB Geographie, FU Berlin.
Hillmann, Felicitas (1998): Türkische Unternehmerinnen und Beschäftigte im Berliner
ethnischen Gewerbe, WZB Berlin.
Hirschman, Albert O. (1981): A generalized linkage approach to development, with special
reference to staples, In: Essays in Trespassing. Economics to politics and beyond, Cambridge.
Portes, Alexandro and Robert L. Bach (1985): Latin Jouney: Cuban and Mexican Immigrants in
the U. S., Berkeley.
Scholz, Fred und Matthias Leier (1987): Überlegungen zur Integrationsfrage ausländischer/
türkischer Bevölkerungsgruppen in Berlin, Occasional Paper, FB Geographie, FU Berlin.
Spies, Ulrike B. (1988): Der „Türkenmarkt“ am Maybachufer (Kreuzberg/Neukölln), Occasional
Paper, FB Geographie, FU Berlin.
Zentrum für Türkeistudien (Hrsg.) (2001): Die ökonomischen Dimensionen der türkischen
Selbständigen in Deutschland und in der Europäischen Union, Universität GH Essen.
URL: http://www.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/berlin/index.html, 07.04.02
URL: http://www.bundesauslaenderbeauftragte.de/daten/index.stm, 07.04.02
URL: http://www.statistik-berlin.de/framesets/berl.htm, 07.04.02
[...]
[1] vgl. Scholz, S. 24
[2] Felicitas Hillmann (1998): Türkische Unternehmerinnen und Beschäftigte im Berliner ethnischen Gewerbe, Berlin
[3] vgl. z. B. Portes and Bach
[4] (engl.) Bündel
[5] vgl. Hillmann, S. 4 f.
[6] http://www.bundesauslaenderbeauftragte.de/daten/index.stm, Tabelle 3
[7] Hillmann, S. 10
[8] http://www.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/berlin/index.html, Gesamtübersicht
[9] Sie sank um 3 %, vgl. http://www.statistik-berlin.de/framesets/berl.htm
[10] http://www.statistik-berlin.de/framesets/berl.htm
[11] Hillmann, S. 12
[12] Zentrum für Türkeistudien, S. 7
[13] dto. S. 9
[14] vgl. Scholz, S. 19 ff.
[15] Hillmann, S. 41
[16] Dort ist der Anteil der beschäftigen Männer mit 80 % vergleichsweise hoch.
[17] Noch 1988 bildete die türkische Bevölkerung auf dem Türkenmarkt am Maybachufer 70 - 75 % der Kundschaft, vgl. Spies, S. 14
[18] Dahingegen wird Morokvasic’s These bestätigt, dass sich selbständige Frauen häufiger nicht-ethnischen Kunden zuwenden, bestätigt. vgl. Hillmann, S. 6
[19] vgl. Hirschman
[20] Es waren Mehrfachnennungen möglich.
[21] Hillmann, S. 34 ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Inhalt"?
Der Text untersucht die Wirtschaftsaktivitäten türkischer Unternehmerinnen in Berlin und prüft, inwieweit das Konzept der "Ethnischen Ökonomie" (EÖ) auf sie anwendbar ist. Dabei wird untersucht, ob ethnische Merkmale die Quelle des Unternehmenserfolges darstellen.
Was versteht man unter "Ethnische Ökonomie" (EÖ) im Kontext des Textes?
EÖ wird als ein Cluster von ethnisch organisierten Unternehmen verstanden, die von einer nicht-einheimischen Bevölkerungsgruppe betrieben werden. Es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, wie horizontale und vertikale Vernetzung, die Beschäftigung ethnischer Arbeitskräfte, ein Kundenkreis aus derselben ethnischen Community und die Dominanz ethnischer Unternehmen im Kreis der Lieferanten.
Welche Rolle spielen Frauen in der Ethnischen Ökonomie gemäß dem Text?
Die Rolle der Frauen wurde in der Migrationsforschung oft vernachlässigt. Der Text betrachtet die Frau als Akteurin innerhalb der EÖ und betont, dass ihre Beschäftigung notwendig sein kann, damit sich eine EÖ überhaupt erst herausbilden kann.
Wie hat sich die Zuwanderung türkischer Arbeitnehmer und die Arbeitsmarktsituation in Deutschland entwickelt?
Seit dem Anwerbeabkommen 1961 stieg die Zahl türkischer Arbeitnehmer stetig an. Mit dem Anwerbestopp 1973 änderte sich die Struktur, und der Anteil der Frauen wuchs durch Familienzuzug. Die Arbeitsmarktsituation in den 90er Jahren wirkte sich negativ auf die Beschäftigung ausländischer Bevölkerung aus, insbesondere auf ausländische Frauen.
Welche Branchen sind für türkische Unternehmerinnen in Berlin typisch?
Die befragten Frauen arbeiten selbständig oder als abhängig Beschäftigte in Branchen wie dem Nahrungsmittelsektor, der Textilbranche, Reisebüros, Kosmetik und Schönheitspflege, Kioske und Reinigungsdienste.
Spielt die Nähe zur türkischen Community eine wichtige Rolle bei der Standortwahl türkischer Unternehmerinnen in Berlin?
Für die Mehrzahl der Selbständigen war die Nähe zu Freundeskreis, Familie und türkischer Community von geringer Bedeutung. Einige wählten bewusst Standorte in von Deutschen dominierten Stadtteilen.
Inwieweit profitieren türkische Unternehmerinnen von ethnischen Netzwerken und der türkischen Community?
Die Analyse zeigt, dass türkische Unternehmerinnen weder personell, finanziell noch realwirtschaftlich besonders von der türkischen Community profitieren. Im Gegenteil, die Beschäftigung türkischer Mitarbeiter kann sich aufgrund fehlender Fachkenntnisse oder Hierarchie-Schwierigkeiten als problematisch erweisen.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text bezüglich des Erfolgs türkischer Unternehmerinnen in Berlin?
Das Erfolgspotenzial, das auf ethnischer Solidarität beruht, scheint auf männliche türkische Gewerbetreibende beschränkt zu sein. Der Text warnt vor einer genderblinden Betrachtung sozialer Phänomene und betont, dass geschlechtsspezifische Untersuchungen zu erheblich von Mainstream-Wahrnehmungen abweichenden Ergebnissen führen können.
Welche Finanzierungsquellen nutzen türkische Unternehmerinnen zur Unternehmensgründung?
Das Verhältnis der Finanzierungsquellen ist ausgewogen: Bankkredite, Finanzmittel von Familienangehörigen und Sparguthaben werden gleichermaßen genutzt.
- Quote paper
- Kristin Höltge (Author), 2002, Türkische Unternehmerinnen in Berlin - erfolgreich durch Einbindung in die 'Ethnische Ökonomie'?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108431