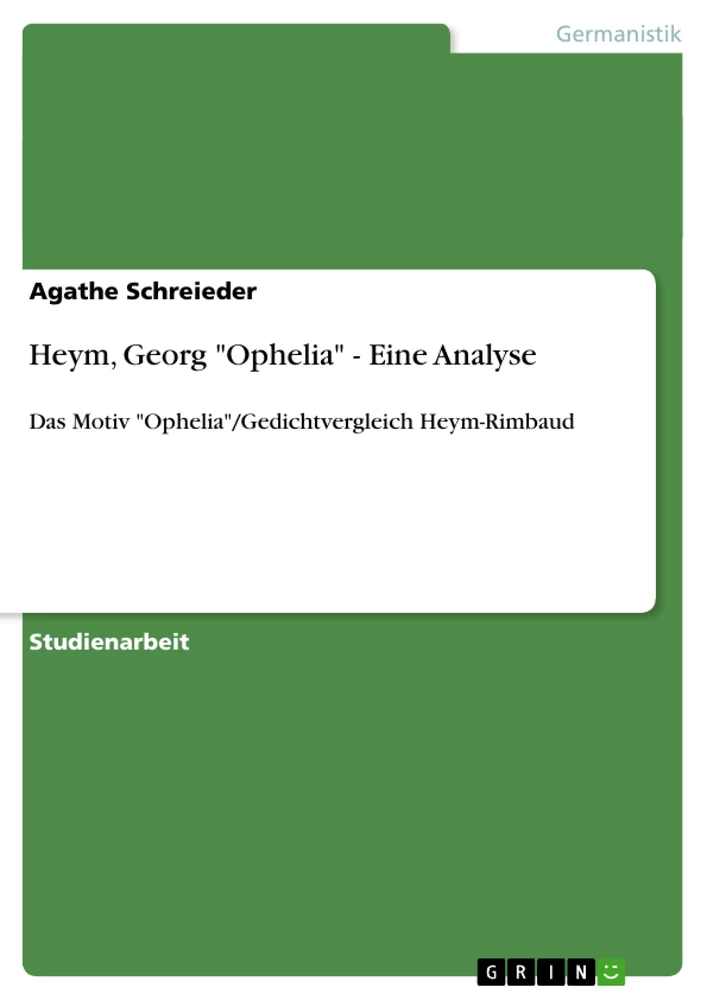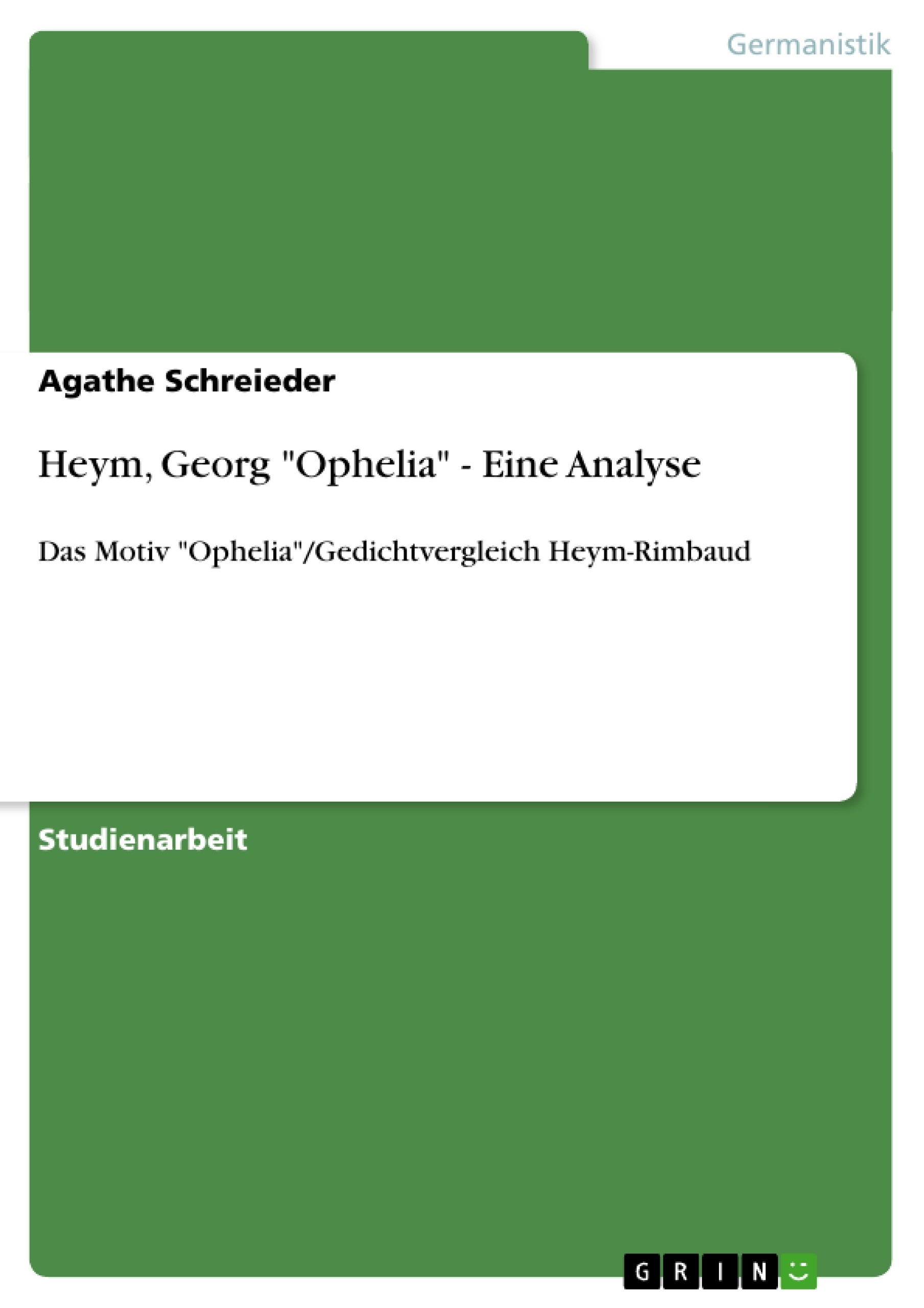Georg Heyms "Ophelia" gehört zu den Standardwerken der deutschen Lyrik. Die vorliegende Arbeit begibt sich auf die Spur des Ophelia-Stoffes: Shakespeares "Hamlet" und Arthur Rimbauds "Ophélie" sind wohl die bekanntesten Vorgänger und Vorbilder für Heyms Verarbeitung des Motivs der unglücklichen Wasserleiche.
Neben einer ausführlichen Untersuchung der äußeren Form (Aufbau, Metrum, Reimschema) sowie der zentralen Motive des Gedichts bietet die Arbeit einen direkten Vergleich der Gestaltung des Ophelia-Stoffes in zwei verschiedenen Epochen: von Rimbaud (ca. 1870) einerseits und Heym (1911) andererseits.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Traum und Wirklichkeit
- 2. Leben Georg Heyms
- 3. Das Motiv „Ophelia“
- 3.1 Die Ophelia Shakespeares
- 3.2 Ophelia: Aussagekraft im Laufe der Zeiten
- 3.3 Arthur Rimbaud: Ophélie
- 4. Georg Heym: Ophelia
- 4.1 Äußere Form: Aufbau, Metrum, Reimschema
- 4.2 Gliederung des Gedichts
- 4.2.1 Teil I: Urwaldähnliche Natur
- 4.2.2 Strophen 5 und 6: Ländliche Gegend
- 4.2.3 Strophe 7 bis 10: Die Stadt
- 4.2.4 Strophen 11 und 12: Friedliche Abendstimmung, visionäres Ende
- 5. Vergleich: Rimbaud – Heym
- 6. Die entgöttlichte Welt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Georg Heyms Gedicht „Ophelia“ im Kontext der literarischen Tradition des Ophelia-Motivs. Ziel ist es, die poetische Gestaltung des Gedichts zu untersuchen und dessen Bedeutung im Rahmen von Heyms Leben und Werk zu beleuchten.
- Das Motiv der Ophelia in der Literaturgeschichte
- Heyms Leben und seine Einflüsse auf sein Werk
- Formale Analyse von Heyms „Ophelia“
- Vergleich mit anderen Interpretationen des Ophelia-Motivs (z.B. Rimbaud)
- Die Darstellung von Natur und Stadt in Heyms Gedicht
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beschreibt einen visionären Traum Heyms, der sein späteres, tatsächlich im Wasser erlittenes, tragisches Ende vorwegnimmt. Kapitel 2 skizziert Heyms Biografie, seinen Widerstand gegen das bürgerliche Milieu und seinen Weg zum erfolgreichen expressionistischen Dichter. Kapitel 3 führt in die literarische Tradition des Ophelia-Motivs ein, beginnend mit Shakespeares Hamlet. Kapitel 4 analysiert die äußere Form und die Gliederung von Heyms Gedicht „Ophelia“, wobei verschiedene Abschnitte des Gedichts und deren Bedeutung herausgearbeitet werden.
Schlüsselwörter
Georg Heym, Ophelia, Expressionismus, Traum und Wirklichkeit, Natur, Stadt, Tod, Wasser, literarische Tradition, Gedichtanalyse, Formale Analyse.
- Citation du texte
- Agathe Schreieder (Auteur), 2004, Heym, Georg "Ophelia" - Eine Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108429