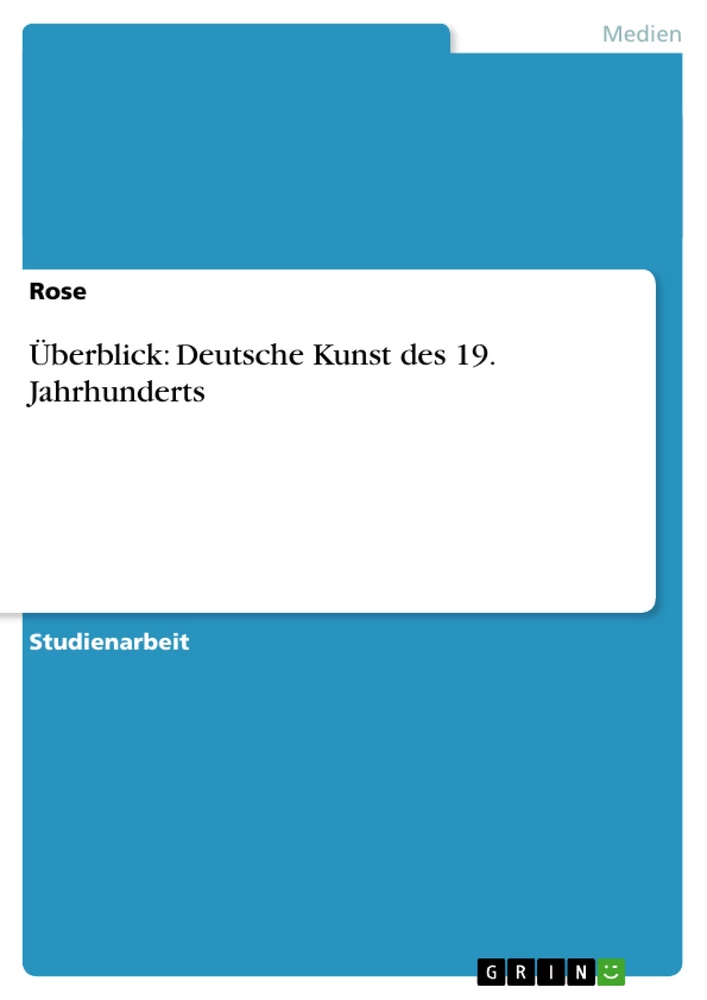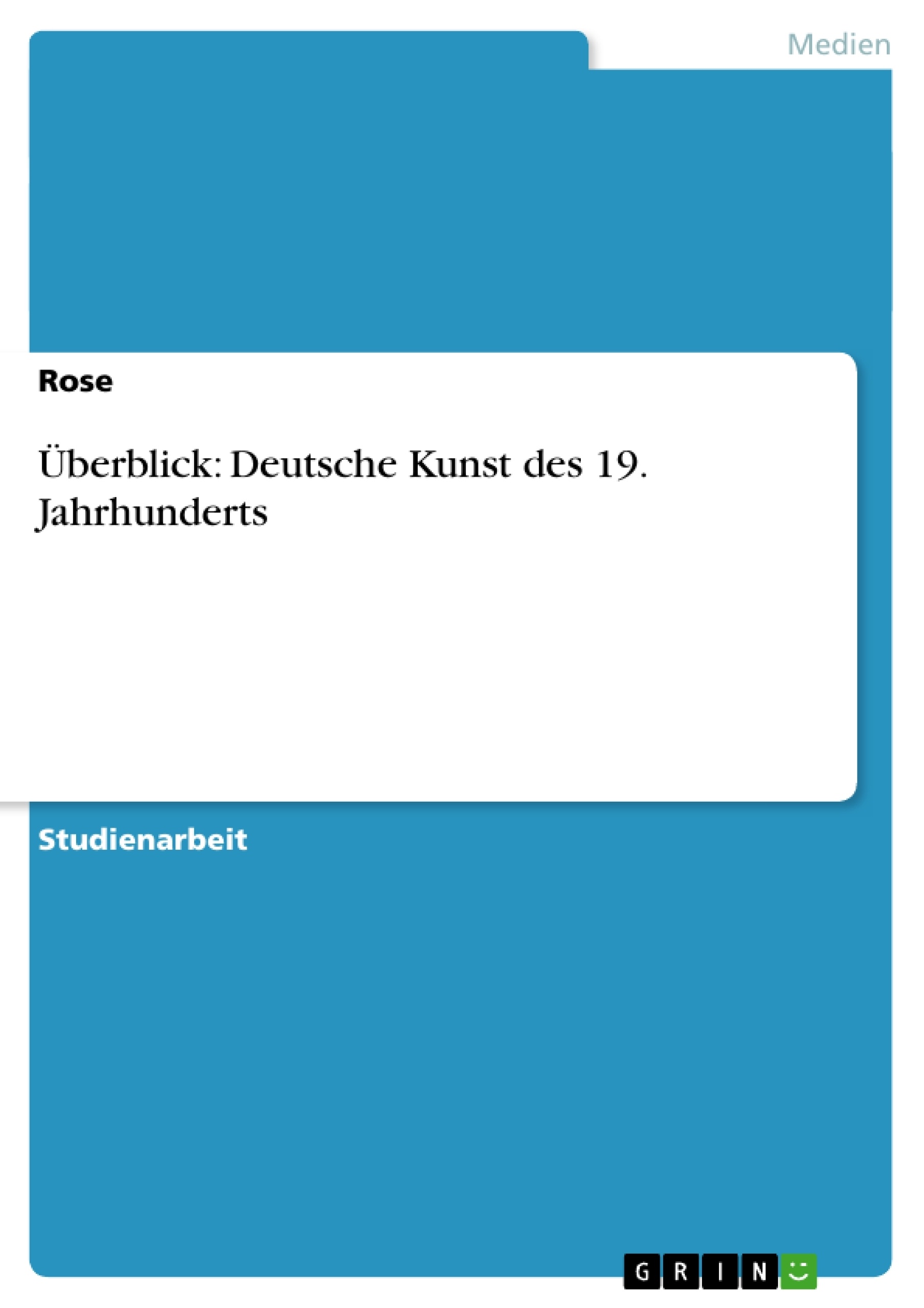Was verraten uns die Pinselstriche über ein Jahrhundert des Umbruchs? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts, eine Epoche, die von revolutionären Veränderungen und künstlerischer Vielfalt geprägt war. Von den klaren Linien des Klassizismus, der sich an der Antike orientierte und in Werken von Schinkel und Tischbein manifestierte, bis hin zur sehnsuchtsvollen Tiefe der Romantik, die in den Landschaften Caspar David Friedrichs und den religiösen Visionen der Nazarener ihren Ausdruck fand, entfaltet sich ein Panorama künstlerischer Strömungen. Entdecken Sie die intimen Genreszenen des Biedermeier, die uns in die Wohnstuben von Waldmüller und Spitzweg entführen, und erleben Sie den aufkommenden Realismus, der mit Menzel und Leibl die soziale Wirklichkeit unverfälscht abbildete. Lassen Sie sich von den idealistischen Träumen des Historismus mitreißen, verkörpert durch die Werke von Böcklin und Feuerbach, bevor der deutsche Impressionismus mit Liebermann und Corinth das Licht und die Atmosphäre in den Fokus rückt. Dieses Buch bietet einen umfassenden Überblick über die Stile, Künstler und gesellschaftlichen Einflüsse, die die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts formten. Es beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen Kunst, Politik und Industrialisierung, die das kulturelle Leben in Deutschland revolutionierten. Erfahren Sie, wie die Künstler auf die Umwälzungen ihrer Zeit reagierten und welche bleibenden Meisterwerke sie schufen. Eine intrigue Reise durch die deutsche Kunstgeschichte, die Ihnen neue Perspektiven auf eine bewegte Epoche eröffnet und die Meisterwerke des Klassizismus, der Romantik, des Biedermeier, des Realismus, des Historismus und des deutschen Impressionismus in einem neuen Licht erscheinen lässt. Ideal für Kunstliebhaber, Studierende und alle, die sich für die kulturelle Entwicklung Deutschlands im 19. Jahrhundert interessieren. Begleiten Sie uns auf einer fesselnden Erkundungstour durch die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts, die von den erhabenen Idealen des Klassizismus bis zu den subtilen Lichtspielen des Impressionismus reicht und die Vielfalt und den Reichtum dieser außergewöhnlichen Epoche enthüllt. Tauchen Sie ein in die Welt von Caspar David Friedrich, Karl Friedrich Schinkel, Adolph Menzel und vieler anderer und erleben Sie die deutsche Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts in all ihren Facetten.
Ein Überblick über die deutsche Kunst des 19ten Jahrhunderts
Die Entwicklung der Kunst kann nie unabhängig zur politischen, ökonomischen und sozialen Situation des Landes gesehen werden. Das gilt auch und ganz besonders für das 19. Jahrhundert. Es ist geprägt von Umstürzen, in jeder Hinsicht. Ich möchte nur kurz auf die zeitlichen Umstände hinweisen, um mein Referat in den richtigen Rahmen zu setzen.
- 2. Hälfte des 18. Jh. Industrielle Revolution von England ausgehend
- 1769 Erfindung der Dampfmaschine, 1787 mechanischer Webstuhl,
- 1789 – 95 Französische Revolution, 1848/49 bürgerlich-demokratische Revolution in Deutschland
- 1871 Gründung des Deutschen Reiches
Das 19. Jh. ist so kunstreich wie kein anderes. „Was jetzt auf allen Gebieten produziert wird, übertrifft an Masse sämtliche früheren Jahrhunderte“ 1.Dies wird durch einen Übergang von Manufaktur- zu einem Industriebetrieb ermöglicht 2.
Klassizismus:
Klassizismus ist die Stilepoche zw. 1750 und 1830, man unterteilt sie in die Stile Directoire, Empire, Louis-seize und Biedermeier 3 (Verweis auf Romantik).
Eingeleitet wird die Epoche u. a. durch Johann Joachim Winckelmann (1717 – 1768), Altertumsforscher. Er beschäftigt sich in seinen Büchern „Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Wercke in der Malerey und Bildhauer-Kunst“ (1755) u. a. mit der Ästhetik der Antike und beeinflusst so maßgeblich das Ideal des Klassizismus.
Die Themen der klassizistischen Malerei sind also überwiegend der Antike oder der Mythologie entnommen. Vertreter: Johann Conrad Tischbein (1712-1778), Goethe in der Campagna; Anton Raphael Mengs (1728 – 1779).
Vorherrschende Gattungen sind aber die Architektur und die Plastik.
Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), Neue Wache (1816 – 18), Altes Museum (1822 – 30); Carl Gotthart Langhans (1732-1808), Brandenburger Tor (1788 – 91)
Johann Gottfried Schadow ( 1764-1850), Kronprinzessin Luise von Preußen und ihre Schwester Friederike (1797) und Christian Daniel Rauch (1777 – 1857), Reiterstandbild Friedrich II (UL)
Romantik:
Die Romantik tritt ab dem Ende des 18. Jh. in Erscheinung. Man unterscheidet
- die Frühromantik mit den Zentren Jena und Berlin
- die Hochromantik mit Heidelberg und Berlin und
- die Spätromantik, bei der sich der Schwerpunkt auf Süddeutschland verlagert (Dresden, Schwaben, München, Wien) 4.
In der Romantik wird die Malerei wieder zur führenden Kunstgattung, die Plastik und die Architektur bleiben überwiegend klassizistisch geprägt 5.
Die Themen der Romantik sind Menschen in inniger Verbindung mit der Natur, stimmungsvolle Landschaften, nachgestaltete Märchen und Sagen 6, Tod, Nacht, Traum und Freundschaft. Die Romantik zeichnet sich durch Volks- und Naturverbundenheit aus 7. Die romantischen Maler bemühen sich um mehr realistische Betrachtung der Natur, des Menschen und seiner Umwelt. Deswegen können manche Maler auch als Vorläufer des bürgerlichen Realismus gesehen werden. Sicher ist, dass die Romantik stark national geprägt ist.
Vertreter der strengen und ernsten norddeutschen Romantik sind Caspar David Friedrich (1774 – 1840), Philipp Otto Runge (1777 – 1810), Carl Gustav Carus und Georg Friedrich Kersting.
Friedrich malt meistens Naturerscheinungen wie Morgengrauen oder Abenddämmerung. Die Stimmung verstärkt er durch eine symbolträchtige, gebrochene Beleuchtung 8. Die Landschaft wird bei ihm zu einem Ausdrucksmittel persönlichen Denkens und Fühlens 9. Seine Kunst ist subjektiv und reflektierend, sie soll zwischen Mensch und Natur vermitteln. Die Bilder sind verschlüsselt, Personen und Gegenstände haben symbolhaften Charakter (z. B. Sonnenuntergang = Tod).
Eine weitere Richtung der Romantik sind die Nazarener. Im Gegensatz zu den norddeutschen Malern, die volksverbunden und national galten, geben sich jene weltabgewandt, religiös beeinflusst und Italien-euphorisch.
1809 schließen sich verschiedene Maler in Wien zusammen zu einem „Lukasbund“, nach Lukas, dem Patron der Maler. Es handelt sich um Franz Pforr (1788 – 1812), Friedrich Overbeck (1789 – 1869), Vogel, Hottinger. Sie ziehen 1810 nach Rom in ein Kloster, um dort religiöse Werke zu schaffen 10. Dort schließen sich ihnen später Peter Cornelius (1783 – 1767), Friedrich Wilhelm Schadow (1788 -1852), Julius Schnorr von Carolsfeld (1794 – 1872) u. a. an 11. Sie wollen damit an die Tradition frühitalienischer Maler wie Giotto und Raphael anknüpfen und versuchten dies mit ihrem „Deutschtum“ zu verbinden. („Man trug sich altdeutsch, mit Barett, Wams und Gürtel, und man empfand altitalienisch“ 12)
In der Spätromantik wurden die Themen weniger heroisch, die Künstler befassten sich mehr mit den „reizvollen Idyllen aus der schlichten Welt des kleinen Mannes“. Sie versuchten das „poetische Empfinden von der heimatlichen Natur“, „das Idyllische und mitunter Sentimentale“ alles 13 in Bildern auszudrücken.
Beispielhaft sind hier Adrian Ludwig Richter (1803 – 1884), der die Dresdner Spätromantik vertrat 14 und Moritz von Schwind (1804 – 1871). Dieser beschäftigte sich insbesondere mit Märchenwelt und Folklore15.
Die Spätromantik geht fast nahtlos zum Biedermeier über.
Biedermeier:
Der Biedermeier umschließt die Zeit von 1815 – 1860. Andere Bezeichnungen sind auch Restaurationsperiode oder Vormärz. Die Malerei lässt sich zwischen Romantik und Stimmungsrealismus der 50er und 60er Jahre des 19. Jh. einordnen 16.
Die Maler beschäftigen sich größten Teils mit kleinteiligen, heimatlichen Landschaftsbildern (Ferdinand Waldmüller (1793-1865))oder mit Genreszenen in engen Innenräumen (Georg Friedrich Kersting). Einer der bekanntesten Künstler ist Karl Spitzweg (1808 – 1885). Er malt humorvolle, kleinformatige Tafelbilder17 auf denen er „die gute alte Zeit“ aus dem Abstand des modernen „Weltbürgers“ schildert18.
Realismus:
Der Realismus trägt seinen Namen durch Gustav Courbets programmatischer Ausstellung „Le Réalisme“ von 185519. Durch die Fotografie wird dem Maler eine immer größere Freiheit gegenüber dem Zwang der Naturnachahmung eingeräumt20. Anfänglich stieß der Realismus aber auf Widerstand in höher gestellten Kreisen. Diese sahen „Kunst und Bildung als untrennbare Einheit und Malerei als volkserzieherisches, nicht aber sozialkritisches Mittel“21.
Im Realismus wird nach wirklichkeitsgetreuer Darstellung der gegebenen sozialen, ökonomischen, politischen und ideologischen Zeiterscheinungen und Verhältnisse gestrebt (Milieuschilderung). Im Gegensatz zur Romantik wird die Skepsis gegenüber der Fantasie größer, man bevorzugt das Reale, Vorhandene. Unscheinbare Motive werden plötzlich zum Bildgegenstand.
Karl Blechen (1798 – 1840) ist in Deutschland einer der Vorreiter. Der zunächst romantische Landschaftsmaler wendet sich später der Wiedergabe objektiver Natureindrücke zu22 und malt erste Industriemotive23.
Ein anderer prägender Künstler ist Adolf von Menzel (1815 – 1905). Er wird wegen seiner lockeren Handschrift, und seiner hellen Farbpalette auch als impressionistischer Vorläufer gesehen. Besonders in seinem Bild „Das Balkonzimmer“ (1845) wird dies deutlich. „Hier machen nur Licht und Luft das Leben des nichtssagenden Zimmers aus. Seine Werke leben oft allein von den Reflexen des Lichtes im Raum“24. Dagegen zeigt sein „Eisenwalzwerk“(1875), wie er die einfache Fabrik zu einer „monumentale Darstellung eines Industriebetriebes und seiner Arbeiter“ macht. Das heißt, er wendet sich zu den sozialen Aspekten des Realismus. (Pr. Dr. Busch: Säkularisierte Mythendarstellung, „Altarbild“ der Arbeit, aber: Fluchtlinien auf Fabrikdirektor)
Ein Treffpunkt berühmter Realisten ist die Düsseldorfer Malerschule, sie fördert bes. die sozialkritische Genremalerei, das bürgerliche Historienbild und die realistische Landschaftsmalerei25. Zu ihr gehören Carl Friedrich Lessing (1808 – 1880) und Carl Wilhelm Hübner (1814 – 1879). Weitere realistische Maler sind Wilhelm Leibl (1844 – 1900), der sich durch seine Detailliebe auszeichnet, und Hans Thoma (1839 – 1924), welcher besonders durch Bilder seiner Schwarzwälder Heimat berühmt wurde.
Historismus:
Der Historismus (ab 1830) beinhaltet die Idealistische Malerei der sog. Deutschrömer und die Historienmalerei.
Die Idealisten suchten eine „Erneuerung der idealen Malerei durch Orientierung an klassischer Kunst Italiens“26. In dieser Hinsicht gleichen sie den Nazarenern, sie bevorzugten aber weniger religiöse Themen als diese.
Hans von Marées (1837 – 87) verleiht seinen Darstellungen zeitlosen feierlichen Charakter, man könnte wegen der totalen Abgeschlossenheit der Bilder von Meditationskunst sprechen27. Seine Bilder stellen überwiegend verallgemeinert dargestellte Landschaften mit nackten Menschengestalten dar.
Anselm Feuerbach (1829 -1880) bevorzugt die antike Mythologie. Seine Bilder wirken kühl-zurückhaltend und vornehm-repräsentativ28.
Arnold Böcklin (1827 – 1901) malt Ähnliches, er hat Sinn für das Mystische, Märchenartige und Fabelhafte29. Seine Bilder sind monumentale, neuromantische Idyllen und Ideallandschaften30.
Deutscher Impressionismus
Der deutsche Impressionismus hat seine Vorläufer ab 1830, man grenzt die Epoche aber ein zwischen 1890 – 1930. Im Gegensatz zum französischen Impressionismus strebt der deutsche nicht nach einer Auflösung des Bildgegenstandes, sondern interpretiert ihn nur freier31. Deswegen und auch aufgrund seiner meistens eher dunkleren Farbpalette ist er manchmal schwer vom Realismus zu trennen. Ein Beispiel für den nahen Zusammenhang von deutschen Realismus und Impressionismus ist Max Liebermann (1847 – 1925) oder Lovis Corinth (1858 – 1925)32. Beide fanden erst nach realistischer zu impressionistischer Malerei.
Max Slevogt (1868 – 1932).
Quellen:
1: Fritz Baumgart: DuMont’s Kleine Kunstgeschichte. Köln: M. DuMont Schauberg 1972. Im Folgenden „Baumgart“ abgekürzt. S. 264.
2: Hans Baier: Taschenbuch der Künste. Stilkunde. Leipzig: VEB E.A. Seemann Verlag, 2. Auflage 1984. S. 151. Im Folgenden „Baier“ abgekürzt.
3: Brockhaus. Mannheim: F.A. Brockhaus, 19. Auflage 1992. Im Folgenden „Brockhaus“ abgekürzt. 12. Band. S. 52
4: Brockhaus. 18. Band. S. 518
5: Baier. S. 163
6: ebd.
7: ebd. S. 164
8: Hans Tintelnot: Vom Klassizismus zur Moderne, Teil 1. Ullstein Kunstgeschichte, Band 15. Frankfurt/Main – Berlin: Ullstein GmbH 1964. Im Folgenden abgekürzt „Tintelnot“. S. 73
9: Baumgart. S. 283
10: Baier. S. 165
11: Tintelnot. S. 70
12: ebd.
13: Baier. S. 169
14: Tintelnot. S. 77
15: Baier. S. 169
16: Brockhaus. 3. Band. S. 488
17: Baier. S. 170
18: Tintelnot. S. 78
19: Brockhaus. 18. Band. S. 133
20: Baumgart. S. 279
21: Tintelnot. S. 147 – 148
22: Tintelnot. S. 75
23: Baier. S. 172 – 173
24: Tintelnot. S. 140
25: Baier. S. 173
26: ebd. S. 176
27: Baumgart. S. 299
28: Baier. S. 176
29: Tintelnot. S. 155
30: Baier. S. 176
31: Baier. S. 216
32: Tintelnot. S. 145
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Handout zum Referat:
Ein Überblick über die deutsche Kunst des 19ten Jahrhunderts
Klassizismus:
- 1750 – 1830
- Massenproduktion (von Manufaktur zu Industrieproduktion)
- Untergeordnete Stile: Biedermeier, Empire, Louis-seize, Directoire
- Johann Joachim Winckelmann (1717-1768): Rückbesinnung auf antike Kunst
- Beispiele: Architektur: C. G. Langhans, Brandenburger Tor (1788 – 91); K. F. Schinkel, Altes Museums (1822 – 30) und Neue Wache (1816 – 18); Plastik: G. Schadow, C. D. Rauch; Malerei: J. H. W. Tischbein: Goethe in der Campagna, A. R. Mengs
Romantik:
- Ende 18. Jh. – 1870
- Malerei wird wieder zur führenden Kunstgattung
- Themen: Stimmungsvolle Landschaften, Menschen in inniger Verbindung mit der Natur
à volks- und naturverbunden, national geprägt, Herausbildung des bürgerlichen Realismus
- norddeutsche, frühe Romantik: Caspar David Friedrich (1774 – 1840), Philipp Otto Runge (1777 – 1810), C. G. Carus, G. F. Kersting: realistisch, volksverbunden, Themen: Einsamkeit, übermächtige Natur, Personen und Gegenstände haben symbolhaften Charakter
- Lukasbund (1809): Franz Pforr (1788 – 1812), Friedrich Overbeck (1789 – 1869) ,
Peter von Cornelius (1783 – 1767) Julius Schnorr von Carolsfeld (1794 – 1872) u. a. weltabgewandt, religiös („Nazarener“), an frühitalienische Meister (Giotto, Raphael) anknüpfen.
- Spätromantik: Moritz von Schwind (1804 – 1871) Adrian Ludwig Richter (1803 – 1884); Themen: harmonisches Zusammenspiel Mensch - Natur; das Idyllische und teilweise Sentimentale, Märchenwelt und Folklore
Biedermeier:
- 1815 – 1860
- auch: Restaurationsperiode, Vormärz
- Themen: kleinteilige, heimatliche Landschaftsbilder (Ferdinand Waldmüller), Genreszenen in engen Innenräumen (Georg Friedrich Kersting), humorvolle, kleinformatige Tafelbilder (Karl Spitzweg 1808 – 1885)
Realismus:
- 1830/40 – 1870/80, z. T. 1900
- Größere Freiheit der Malerei gegenüber dem Zwang der Naturnachahmung (Fotografie)
- Themen: Milieuschilderung, Skepsis gegenüber Fantasie, Wahl unscheinbarer Motive
- Beispiele: Karl Blechen (1798 – 1840) zunächst romantische Landschaftsmalerei, dann Webbereiter des Realismus: romantisch wirkende Landschaften und erste Industriemotive
Adolf von Menzel (1815 – 1905) Werke leben oft allein von den Reflexen des Lichtes im Raum
Düsseldorfer Malerschule: Förderung der sozialkritischen Genremalerei, des bürgerlichen Historienbildes und der realistischen Landschaftsmalerei. Mitglieder: Carl Friedrich Lessing (1808 – 1880), Carl Wilhelm Hübner (1814 - 1879) u. a.
Wilhelm Leibl (1844-1900) Exaktheit und Feinheit in der Wiedergabe von Details
Hans Thoma (1839 – 1924)
Historismus:
- ab 1830
- Idealistische Malerei (Deutschrömer) und Historienmalerei
- Erneuerung der idealen Malerei durch Orientierung an klassischer Kunst Italiens
- Beispiele: Hans von Marées (1837 – 87): Welt der Idealszene
Anselm Feuerbach(1829 – 1880): kühl-zurückhaltend und vornehm-repräsentativ, antike Mythologie
Arnold Böcklin (1827 – 1901): das Mystische, Märchenartige und Fabelhafte, Ideallandschaften
Deutscher Impressionismus:
- 1890-1930 (Vorläufer ab 1830)
- Themen: Alltag, Landschaft, Stilleben, Lichtreflexe, kaum Zeitereignisse oder geschichtliche u. mythologische Themen, fast keine Auflösung des Bildgegenstandes (wie in F), sondern freiere Interpretation;
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Dokuments "Ein Überblick über die deutsche Kunst des 19ten Jahrhunderts"?
Das Hauptthema ist die Entwicklung der deutschen Kunst im 19. Jahrhundert, unter Berücksichtigung des politischen, ökonomischen und sozialen Kontextes dieser Zeit.
Welche Kunststile werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt Klassizismus, Romantik, Biedermeier, Realismus, Historismus und deutschen Impressionismus.
Was sind die Merkmale des Klassizismus, wie er im Dokument beschrieben wird?
Der Klassizismus (ca. 1750-1830) zeichnet sich durch eine Rückbesinnung auf die Kunst der Antike aus. Johann Joachim Winckelmann beeinflusste diese Epoche maßgeblich. Architektur und Plastik waren vorherrschende Gattungen. Stile Directoire, Empire, Louis-seize und Biedermeier sind Unterteilungen.
Welche Aspekte prägen die Romantik in der deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts?
Die Romantik (Ende des 18. Jh. – 1870) legt den Fokus auf die Verbindung von Mensch und Natur, stimmungsvolle Landschaften, Märchen und Sagen. Sie ist geprägt von Volks- und Naturverbundenheit und stark national orientiert. Die Malerei wurde wieder zur führenden Kunstgattung.
Wer waren bedeutende Vertreter der Romantik, die im Text genannt werden?
Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge, Carl Gustav Carus und Georg Friedrich Kersting (norddeutsche Romantik). Franz Pforr und Friedrich Overbeck (Nazarener). Adrian Ludwig Richter und Moritz von Schwind (Spätromantik).
Was charakterisiert den Biedermeier in der Malerei?
Der Biedermeier (1815-1860) zeigt kleinteilige, heimatliche Landschaftsbilder (Ferdinand Waldmüller) und Genreszenen in Innenräumen (Georg Friedrich Kersting). Karl Spitzweg ist ein bekannter Vertreter.
Was sind die Hauptmerkmale des Realismus in der deutschen Kunst?
Der Realismus (1830/40-1870/80) strebt nach einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der sozialen, ökonomischen, politischen und ideologischen Verhältnisse. Die Fotografie ermöglichte eine größere Freiheit gegenüber der Naturnachahmung.
Wer waren wichtige Vertreter des Realismus in Deutschland?
Karl Blechen (Vorreiter), Adolf von Menzel, Carl Friedrich Lessing, Carl Wilhelm Hübner, Wilhelm Leibl und Hans Thoma.
Was versteht man unter Historismus in der Malerei des 19. Jahrhunderts?
Der Historismus (ab 1830) umfasst die idealistische Malerei der Deutschrömer und die Historienmalerei. Es gab eine Orientierung an der klassischen Kunst Italiens.
Welche Künstler gehören zu den Vertretern des Historismus?
Hans von Marées, Anselm Feuerbach und Arnold Böcklin.
Was unterscheidet den deutschen Impressionismus vom französischen?
Der deutsche Impressionismus (1890-1930) strebt im Gegensatz zum französischen nicht nach einer vollständigen Auflösung des Bildgegenstandes, sondern interpretiert diesen freier. Die Farbpalette ist oft dunkler.
Wer waren bedeutende Künstler des deutschen Impressionismus?
Max Slevogt, Max Liebermann und Lovis Corinth.
- Quote paper
- Rose (Author), 2003, Überblick: Deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108402