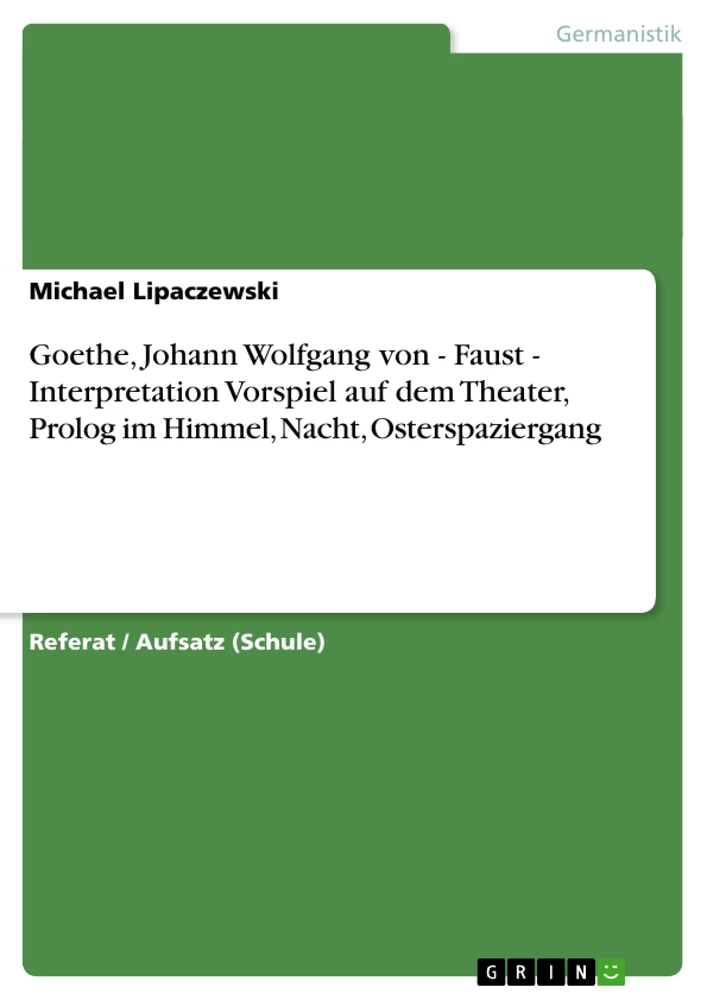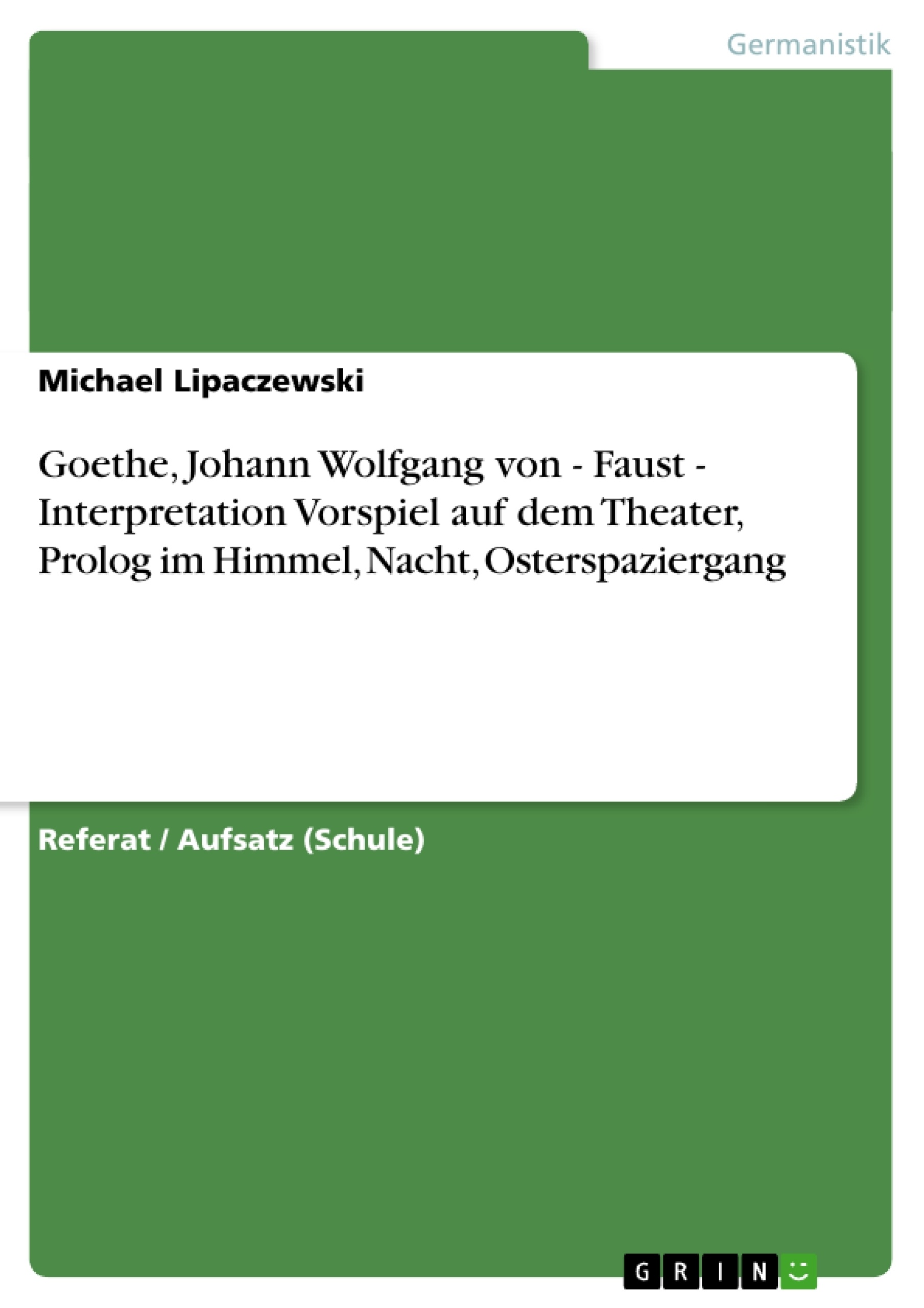Was hält die Welt im Innersten zusammen? Diese Frage quält den Gelehrten Faust, der in Johann Wolfgang von Goethes zeitloser Tragödie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist. Verzweifelt an der Erkenntnis, dass ihm sein Wissen keine wahre Erfüllung gebracht hat, wendet er sich dunklen Mächten zu. Doch bevor er dem Selbstmord nahe ist, hält ihn die Erinnerung an glückliche Kindheitstage auf. Im "Vorspiel auf dem Theater" wird das Publikum Zeuge eines Disputs zwischen Direktor, Dichter und Schauspieler, der die Zerrissenheit des Künstlers zwischen Anspruch, Kommerz und Publikumsgeschmack offenbart. Der "Prolog im Himmel" inszeniert eine Wette zwischen Gott und Mephisto um die Seele Fausts, der als Symbol des strebenden Menschen dargestellt wird. Mephisto, der ewige Skeptiker, sieht in den Menschen nichts als unvollkommene Geschöpfe, während Gott auf die unendliche Entwicklungsfähigkeit des Menschen vertraut. In der Szene "Nacht" begegnen wir Faust in seiner Studierstube, gefangen zwischen dem Drang nach Erkenntnis und der Erkenntnis seiner Grenzen. Die Begegnung mit dem Erdgeist lässt ihn die eigene Nichtigkeit erkennen. Der "Osterspaziergang" führt Faust aus der Enge seines Studierzimmers in die belebte Welt. Er beobachtet das einfache Volk, das die Auferstehung Christi feiert und sich an der erwachenden Natur erfreut. Hier ringt Faust mit der Frage, was es bedeutet, Mensch zu sein und seinen Platz in der Welt zu finden. Goethes "Faust" ist mehr als nur eine Tragödie; es ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den großen Fragen der menschlichen Existenz, mit dem Streben nach Glück, Erkenntnis und Erlösung. Es ist eine Reise durch die Höhen und Tiefen der menschlichen Seele, ein Spiegelbild unserer eigenen Sehnsüchte und Zweifel, und ein zeitloses Meisterwerk der deutschen Literatur, das bis heute nichts von seiner Strahlkraft verloren hat und jeden Leser auf seine ganz eigene Weise berührt und zum Nachdenken anregt über die Conditio Humana, die menschliche Natur, Schuld und Sühne, sowie die ewige Suche nach dem Sinn des Lebens und der Bedeutung von Gut und Böse. Tauchen Sie ein in diese faszinierende Welt voller Symbolik, philosophischer Tiefe und dramatischer Spannung!
Goethe, Johann Wolfgang von - Faust - Interpretation Vorspiel auf dem Theater, Prolog im Himmel, Nacht, Osterspaziergang
Vorspiel auf dem Theater
In der ersten Szene der von Johan Wolfgang von Goethe geschriebenen Tragödie, „Faust“ mit dem Titel „Vorspiel auf dem Theater“ wird dem Leser die Unschlüssigkeit Goethes, das Stück aufzuführen, verdeutlicht. Dazu benutzt er 3 Figuren, den Direktor, den Dichter und den Schauspieler (die lustige Person), welche in dramatischen Wechselreden über das Stück sprechen, das aufgeführt werden soll, wobei jeder Verschiedenes von der Aufführung erwartet. Der Schauspieler (Lustige Person) will vor allem ein unterhaltsames, lustiges Stück. Es sollen Szenen vorkommen, in denen er mit Mimik, Gestik, Körpersprache und Gesang wirken kann. Der Direktor hat vor allem das Geld im Auge, das die Aufführung einbringen soll. Der Dichter fühlt sich unverstanden. Ihm sind die Gedanken und Ideen des Dramas wichtig. Das Stück soll immer gültig sein und den Menschen helfen, ihr Leben besser zu meistern.
Goethe gibt allen drei Personen Recht. Erfolg kann das Stück nur haben, wenn es gut gespielt ist und dem Volk etwas für das Leben mitgibt. Also versucht er einen Kompromiss zwischen diesen 3 Personen zu finden
Dabei ist er sich der Schwierigkeiten bewusst, wie er in Zeile 131/32 schreibt:“ Sucht nur die Menschen zu verwirren, sie zu befriedigen, ist schwer“ Hier wird verdeutlicht, dass es nicht möglich ist es allen Menschen recht zu machen, darum setzt er seine Prioritäten tiefer und begnügt sich mit dem Verwirren der Menschen. Andererseits hält Goethe es für wichtig, das ein Dichter seinen Stoff aus dem wahren Leben greift, damit er den Menschen zeigen kann, wie sie ihr Leben meistern sollen. So in Zeile 167:“ greift nur hinein ins volle Menschenleben“. Weiterhin beschreibt er die Dichtung als Weg zur Selbsterkenntnis, wie er in Zeile 174 – 179 anmerkt:“ Dann sammelt sich der Jugend schönste Blüte, vor eurem Spiel und lauscht der Offenbarung, dann sauget jedes zärtliche Gemüte aus eurem werk sich melankol’sche Nahrung, dann wird bald dies, bald jenes aufgeregt, ein jeder sieht, was er im herzen trägt.“ Bereits in Zeile 212/13 gibt uns Goethe eine Kostprobe seiner Dichterischen Lehre, die uns zeigen soll, wie wir leben sollen und gibt uns einen Fingerzeig zu dem Weg zur genannten Selbsterkenntnis. Er schreibt:“ Das Alter macht nicht kindisch, wie man spricht, es findet uns nur noch als wahre Kinder“. Goethe schätzt an den Kindern, dass sie für Neues offen sind, die Wahrheit sagen und sich an vielem erfreuen können. Wir sollten im Alter das Kindliche, was sich durch ein einfaches Gemüt, welches sich an Kleinigkeiten freut, verkörpert wird, wiederfinden. Nach diesem Dichterischem Höhepunkt vertieft sich Goethe in den Einsatz von bühnenwirksamen Elementen. diese sollen nicht gespart werden, heißt es in Zeile 232 - 238:“Ihr wisst, auf unseren deutschen Bühnen probiert ein jeder, was er mag; Drum schonet mir in diesem Tag Prospekte nicht und nicht Maschinen. Gebraucht das groß und kleine Himmelslicht, die Sterne dürftet ihr verschwenden; an Wasser, Feuer, Felsenwänden, an Tier und Vögeln fehlt es nicht“. Alles, was im Requisitenlager vorhanden ist, soll verwendet werden. Daraus kann man ableiten, dass Goethe vorherige Stücke nicht richtig umgesetzt sieht und bei seinem Letzten und Größten Meisterwerk an nichts gespart wird, um die Menschen zu verwirren und zu begeistern, was ja sein obengenanntes Ziel war. Schließlich gibt Goethe die Bühne in Zeile 242 durch die Worte des Direktors frei:“ Vom Himmel durch die Welt zu Hölle“ was einen Vorgeschmack auf die eigentliche Tragödie ist und wahrscheinlich die kürzeste Zusammenfassung des Faust darstellt.
Es befinde sich viele auseinanderdriftende Meinungen in der ersten Szene des Buches, und man kann davon ausgehen, das Goethe hin und her gerissen war und schließlich so unsicher geworden ist, durch seine eigene Argumentation, dass er sich nicht mehr traute, dass Stück aufzuführen oder zu veröffentlichen. Dank Schiller blieb uns dieses Werk nicht verborgen so das sich Generationen von Schülern dieses Werkes erfreuen können.
Prolog im Himmel
In der zweiten Szene der von Johan Wolfgang von Goethe geschriebenen Tragödie, „Faust“ mit dem Titel „Prolog im Himmel“ gestattet Goethe einen ersten Eindruck von den Machtverhältnissen und der Mentalität Gottes und seiner Untertanen einschließlich Mephisto.
Gott der Herr, dem Fausts Streben gefällt, gestattet Mephistopheles, Faust auf die Probe zu stellen, solange Faust auf Erden wandelt, wobei er aber weiß oder hofft, dass der Teufel sein Ziel nicht erreichen wird. Interessant ist, das Gott selber Faust als Versuchsobjekt vorschlägt.
In Zeile 244 weißt Raphael auf die Harmonie, den Einklang in der Schöpfung und den Kosmos hin, den Gott so wunderschön und vollkommen geschaffen hat. Dadurch vermittelt sich beim Leser das Bild eines vollkommen guten, allmächtigen Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird. Dann aber, in Zeile 280 – 282 spricht Mephisto das Leid der Menschen an, die aus ihren Fehlern, die sie immer wieder machen, nicht lernen. Damit spricht er Gott auf einen Fehler an, den er bei der Schöpfung gemacht haben soll, an.
in den Zeile 285/86 meint Mephisto, dass der Mensch besser ohne Vernunft leben würde, weil er sie sowieso nicht einsetzt. Und schließlich wendet er sich in Zeile 300 u.f. Faust zu, indem er sagt, dass dieser die gesamte Schöpfung erkennen will, aber andererseits auch Lust, Freude, Liebe und Glück auf der Erde finden möchte. Eins wird durch das andere unmöglich. Das Titanische in Fausts Charakter trifft Mephisto und fordert seinen Ergeiz, ist sich jedoch Siegessicher und Vorschnell. Schließlich verlangt Mephisto in den Zeilen 313 u.f die Erlaubnis des Herrn, Faust auf der Erde zu verführen. Daraus erkennt der Leser, dass der Teufel auch nur ein Knecht des Herrn ist, in seine Schöpfung integriert ist und eine Aufgabe im Leben hat (Zeile 342): „der Mensch soll sich zum Guten oder zum Bösen entscheiden“. Gott lässt Mephisto gewähren und gibt ihm den Auftrag, er soll, wie in Zeile 324 beschrieben Faust vom Glauben, also Gott und seiner Schöpfung, abbringen.
Dieser Auftrag lässt Goethes Gott in einem ganz anderem Licht erscheinen. Hier nimmt er die Rolle eines gelangweilten Spieler ein, der sich eine gewisse Ablenkung durch eine kleine Wette erlaubt. Mephisto spielt dabei einen engen Bekannten, sodass sich die Wette auf die Ehre bezieht und damit keine größeren Schäden, auf welcher Seite auch immer, für den Verlierer entstehen.
Nacht
In der dritten Szene der von Johan Wolfgang von Goethe geschriebenen Tragödie, „Faust“ mit dem Titel „Nacht“ wird dem Leser Faust vorgestellt und dessen Charakter näher betrachtet.
Faust hat alle Wissenschaften durchforscht, doch keine hat ihm die wahre Erkenntnis vermittelt, was die Welt in seinem Innersten zusammenhält oder ihm Aufschluss über den Sinn des Seins gegeben. Deshalb beschwört er den Erdgeist, der ihn verspottet und in seine Grenzen zurückweist. Lerneifrig tritt Fausts Famulus Wagner dazwischen, der vorgibt, in der Nacht etwas lernen zu wollen und zufällig Stimmen in Fausts Zimmer gehört habe.
Nachdem Faust erkannt hat, dass er mit Hilfe seiner Bücher nie Allwissenheit erlangen wird, will er sich aus Verzweiflung und um eine letzte Erfahrung zu machen mit einer Phiole Gift töten. Durch die Osterglocken, die Faust an glückliche Kindheitstage erinnern, wird er jedoch von einem Selbstmord abgehalten.
In Zeile 398 werden Fausts Gefühle deutlich. Er sitzt Tag und Nacht über seinen Büchern im Studierzimmer. Er fühlt sich wie in einem Kerker, weil er keine Verbindung zur Natur und auch zu fast keinem Menschen hat was ihn schließlich auch zum Selbstmord bewegt, wie er in Zeile 481 verdeutlicht, in der er ausdrückt, dass der Gewinn an Erkenntnis das Leben für Faust kein zu hoher Preis wäre.
In Zeile 485 kann Faust den Geist beschwören, ist aber erschrocken und eingeschüchtert darüber und der überirdischen Gestalt nicht ebenbürtig. Trotzdem fühlt er sich dem Erdgeist nahe, er kann aber die Grunderkenntnis nicht begreifen, da es über sein menschliches Vermögen hinausgeht, wie in Zeile 499 u.f. beschrieben.
Wagner, Fausts Assistent und Nachfolger, macht ihm deutlich, in welcher menschl. Welt Faust zu leben hat.
Zeile 531 u.f.: Wagner geht nicht auf Faust ein. Er hört dem Reden des Lehrers nicht zu, weicht aus.
Zeile 539 u. f.: Wagner richtet sich nach den Meinungen anderer, um großartige Reden schwingen zu können und die Aussagen anderer als seine eigenen auszugeben, ohne selbst nachdenken zu müssen. Hauptsache für ihn ist die Weise, wie man einen Vortrag vorbringt, nicht der Inhalt einer Rede, den Faust für wichtig hält.
Zeile 558: Wagner lässt den Gedanken Fausts links liegen und bedauert, dass ein Mensch nicht alles schaffen kann.
Zeile 575 u.f.: Faust weißt darauf hin, dass wir in der Vergangenheit vielfach nur von unserem heutigem Standpunkt sehen. Wir sollten uns öfters in die Lage der Leute früher hineinversetzen.
Zeile 590 - 593: Die Menschen, die anderen wichtige Erkenntnisse mitteilen wollten, sind oftmals umgebracht worden.
Zeile 600/61: Ein weiterer Unterschied Wagners zu Faust ist der, dass Faust nie sagen würde, dass er sehr viel weiß. Obwohl Wagner im Gegensatz zu seinem Lehrer nur wenig Wissen besitzt, rühmt er sich dessen. Sogar der altgriechische Philosoph Sokrates sagte: "Ich weiß, dass ich nichts weiß". Als Schüler sollte Wagner viel mehr Fragen stellen; denn derjenige, der fragt, kommt immer wieder zu neuen Erkenntnissen.
Zeile 704/05: Der Tod bedeutet für Faust das Erlangen von weiterem Wissen. Ein neuer Abschnitt, ein neues Leben soll ihm dazu verhelfen, sein Streben auf eine andere Weise fortzusetzen.
Zeile 762 - 768: Faust weiß, was sich in der Kirche zuträgt - er ist ein Christ und hat Theologie studiert.
Zeile 781: Die Erinnerung an seine Jugendzeit hält ihn vor dem letzten Schritt zum Selbstmord zurück.
Vor dem Tor – Osterspaziergang
In der 5. Szene „Vor dem Tor“ der von Goethe geschriebenen Tragödie „Faust“ richtet Faust eine Rede an Wagner über das Menschsein.
Faust berichtet vom erwachen der Pflanzenwelt, vom Sieg des Frühlings über den Winter. Er beobachtet die Menschen, wie sie sich im Park vor den Stadttoren vergnügen und sich an den ersten Sonnenstrahlen erfreuen. Faust bemerkt die ausgelassene und zufriedene Haltung der Wanderer und vergleicht diese mit dem Paradies.
Faust lässt erkennen, dass er immer noch Gottesgläubig ist, wie er in Zeile 921 sagt: “Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn Sie sind selber auferstanden.“ Dieser Textauszug verdeutlicht die Haltung des normalen Volkes zu Gott und dessen Schöpfung, dessen sie sich gerade erfreuen. Die Meinung Fausts wird an dieser Stelle nicht näher erläutert, jedoch kann man aus der Tatsache, dass Faust die Gelassenheit der Menschen auf Gott zurückführt in die Richtung gehend deuten, dass er Gott noch nicht ganz aus seinem Leben gestrichen hat.
In Zeile 938 erklärt er den Park als eigentlichen Himmel. Dabei steht der Himmel für das Paradies, das der Bibel zufolge der schönste Platz sei, den sich ein Mensch vorstellen kann. Faust erklärt diesen Kommentar zwei Zeilen später selbst, in der er sagt: „hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“ Damit wird verdeutlicht, dass Faust sich unter dem Paradies einen Ort vorstellt, an dem der Mensch keine großartigen Taten vollbringen muss, oder sich durch besondere Verdienste auszeichnet. Ihm geht es vor allem darum, dass der Mensch sich als Mensch gibt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Vorspiel auf dem Theater" in Goethes Faust?
Das "Vorspiel auf dem Theater" ist die erste Szene von Goethes Tragödie "Faust". Es zeigt die Uneinigkeit zwischen dem Direktor, dem Dichter und dem Schauspieler über die Art und Weise, wie das Stück aufgeführt werden soll. Der Direktor will Unterhaltung und Profit, der Dichter strebt nach tiefgründigen Inhalten und der Schauspieler möchte seine Fähigkeiten zur Schau stellen. Goethe versucht einen Kompromiss zu finden, der alle zufriedenstellt, aber er ist sich der Schwierigkeiten bewusst, es allen recht zu machen.
Was passiert im "Prolog im Himmel"?
Der "Prolog im Himmel" ist die zweite Szene von Goethes Faust. Gott erlaubt Mephisto, Faust auf die Probe zu stellen, da Gott glaubt, dass Faust trotz seiner Fehler und seines Strebens nach Erkenntnis auf dem rechten Weg bleiben wird. Mephisto kritisiert die Menschheit und Faust selbst und verlangt die Erlaubnis, ihn zu verführen. Gott gewährt ihm dies, in der Hoffnung, dass Faust sich trotz der Verlockungen des Teufels für das Gute entscheidet.
Worum geht es in der Szene "Nacht"?
In der Szene "Nacht" wird Faust dem Leser näher vorgestellt. Er ist ein Gelehrter, der trotz seines Wissens keine wahre Erkenntnis gefunden hat. Er beschwört den Erdgeist, der ihn jedoch zurückweist. Verzweifelt plant Faust Selbstmord, wird aber durch die Osterglocken daran gehindert, die ihn an seine Kindheit erinnern.
Was wird im "Osterspaziergang" thematisiert?
Im "Osterspaziergang" (Szene "Vor dem Tor") betrachtet Faust die erwachende Natur und die feiernden Menschen. Er vergleicht die ausgelassene Stimmung mit dem Paradies und erkennt darin einen Ausdruck des Glaubens an die Auferstehung. Faust deutet an, dass er noch immer an Gott glaubt, aber betont auch, dass er sich als Mensch in dieser natürlichen Umgebung wohlfühlt, ohne besondere Leistungen erbringen zu müssen.
- Quote paper
- Michael Lipaczewski (Author), 2003, Goethe, Johann Wolfgang von - Faust - Interpretation Vorspiel auf dem Theater, Prolog im Himmel, Nacht, Osterspaziergang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108355