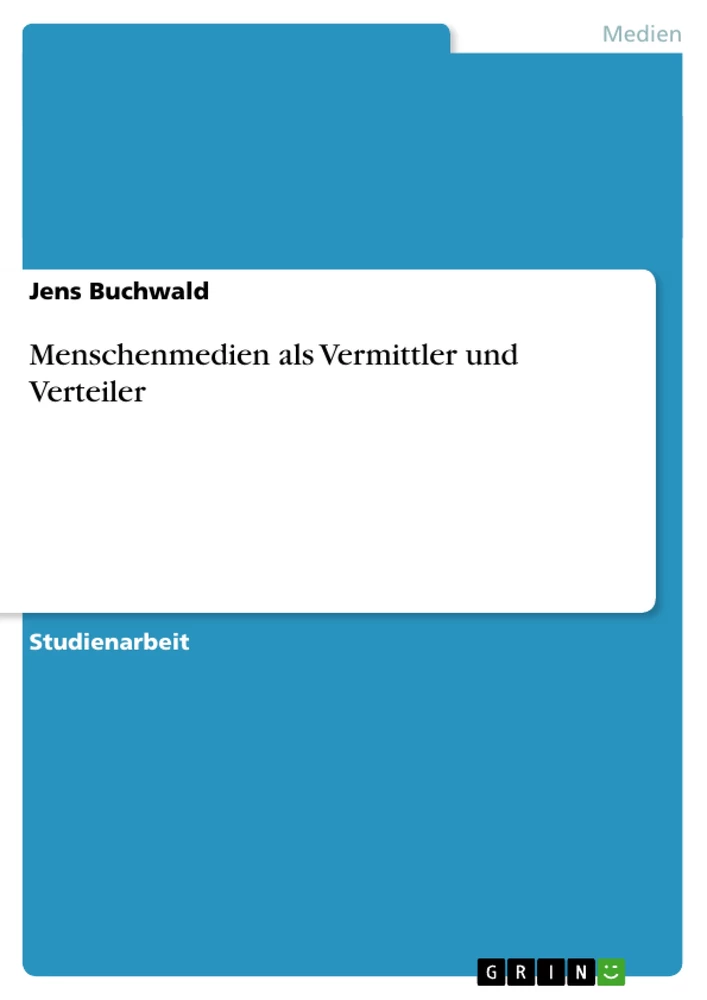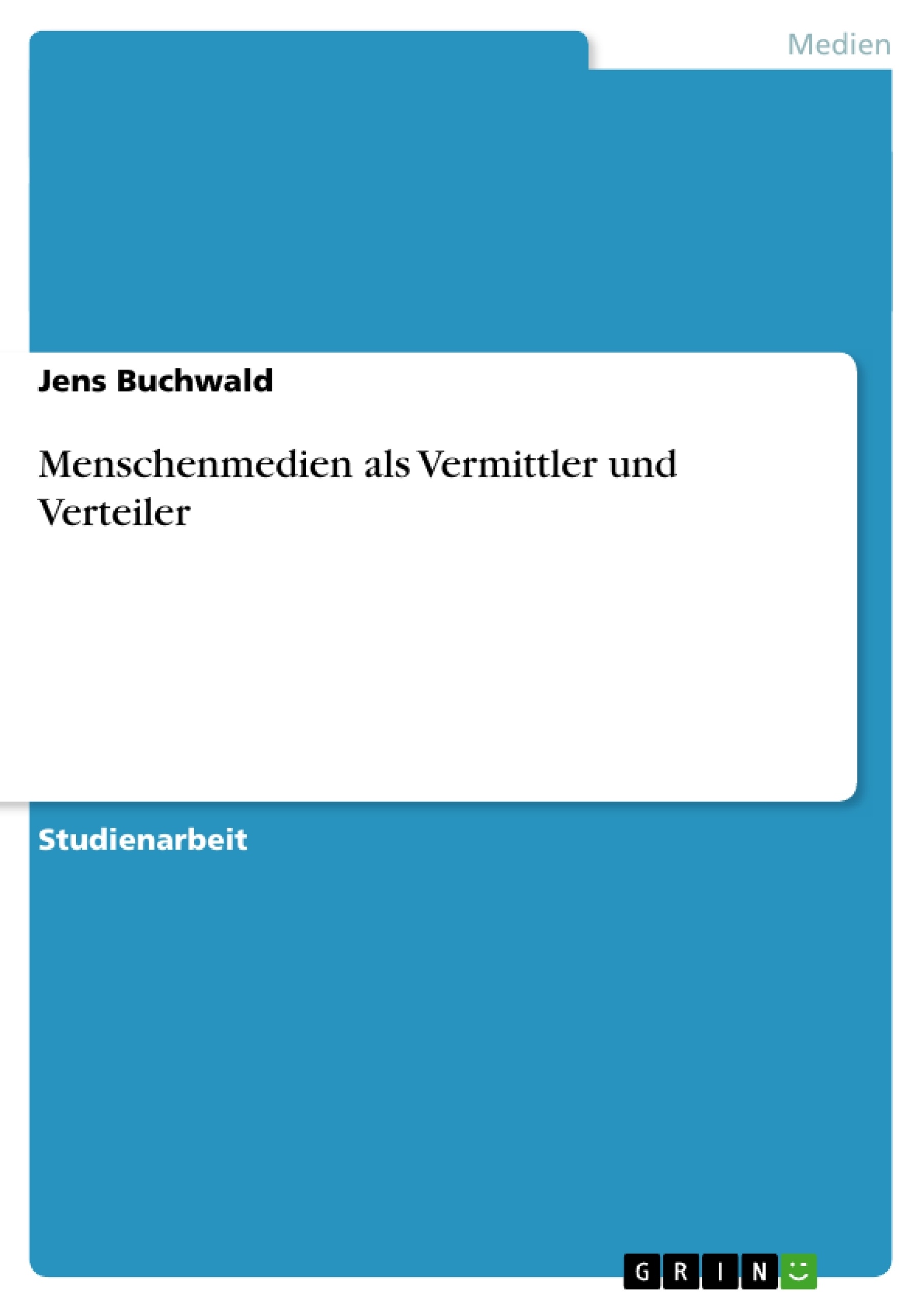In einer Welt, in der die digitale Revolution unaufhaltsam voranschreitet, stellt sich die intrigue Frage: Wer prägt unsere Meinungen wirklich? Sind es die allgegenwärtigen Massenmedien oder doch die Menschen in unserem unmittelbaren Umfeld? Diese tiefgründige Analyse der Medienlandschaft enthüllt die überraschende Bedeutung des Menschen als Kommunikationsmedium. Von der Definition primärer, sekundärer, tertiärer und quartärer Medien nach Harry Pross und Manfred Faßler, über die Untersuchung der medialen Funktionen des Menschen als Vermittler und Verteiler von Informationen, bis hin zur Analyse der Two-Step-Flow-Theorie von Paul Lazarsfeld, bietet dieses Buch einen umfassenden Überblick über die Dynamik der Medienwirkung. Die Leser erwartet eine fesselnde Auseinandersetzung mit der Rolle von Prominenten und Stars in der heutigen Gesellschaft, deren Einfluss weit über die reine Unterhaltung hinausgeht. Anhand von aufschlussreichen Beispielen und fundierten Forschungsergebnissen wird deutlich, wie diese Meinungsführer unsere Wahrnehmung der Welt formen und unsere Entscheidungen beeinflussen. Doch was bedeutet das für die Zukunft der Kommunikation? Werden computerbasierte Medien den Menschen als zentralen Akteur im Informationsaustausch verdrängen? Oder bleibt der Mensch, trotz aller technologischen Fortschritte, das wichtigste und einflussreichste Medium von allen? Dieses Buch liefert faszinierende Antworten und regt zum Nachdenken über die Macht der zwischenmenschlichen Kommunikation im Zeitalter der digitalen Medien an. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die verstehen wollen, wie Meinungen entstehen, wie Informationen sich verbreiten und welche Rolle wir selbst in diesem komplexen Geflecht spielen. Tauchen Sie ein in die Welt der Medienwirkungsforschung, der Massenkommunikation, der zwischenmenschlichen Beziehungen und der digitalen Medien. Entdecken Sie die verborgenen Mechanismen der Meinungsbildung und erlangen Sie ein tieferes Verständnis für die entscheidende Rolle des Menschen als Medium.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Medieneinteilung nach Kommunikationsebene
2.1 Primäre Medien
2.2 Sekundäre Medien
2.3 Tertiäre Medien
2.4 Quartäre Medien
3. Mediale Funktionen von Menschen
4. Two-Step-Flow Theorie
4.1 Die People’s Choice Studie
4.2 Folgestudien und Kritik
5. Prominente und Stars
5.1 Begriffsbestimmung
5.2 Merkmale und Funktionen von Prominenz
5.3 Merkmale und Funktionen von Stars
6. Schlussbemerkung
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Weit vor der Nutzung erster mechanischer Hilfsmittel und einfacher technischer Entwicklungen zur Verbesserung sowie Erweiterung der menschlichen Kommunikation und noch weiter vor der Erfindung und Etablierung der gegenwärtigen Massenmedien steht der Mensch selbst als Medium. Und bis heute ist der Mensch mit all seinen Möglichkeiten zur Kommunikation und der Schaffung seiner Kommunikationsmittel erster Träger und Vermittler von Informationen und damit einhergehend auch Medium. Dabei fungiert er als erstes Medium vor aber auch innerhalb anderer später hinzugekommener Medien und ist letztendlich auch Voraussetzung für die Existenz dieser.
Im Laufe dieser Arbeit soll nun der Frage nachgegangen werden, ob der Mensch das wichtigste und einflussreichste vermittelnde wie verteilende Kommunikationsmedium auf der Welt ist und bleibt, oder ob ihm andere Medien darin den Rang ablaufen oder sogar bereits abgelaufen haben. Dazu muss zuerst einmal geklärt werden, wie sich die verschiedensten existierenden Medien überhaupt einteilen lassen und welche Voraussetzungen für diese Einteilung eine Rolle spielen. Danach kann die mediale Funktion des Mediums Mensch nach der hier verwendeten Unterteilung in Vermittler und Verteiler eingegrenzt und im Vergleich zu anderen Einteilungen bestimmt werden.
Über einen Bereich der klassischen Medienwirkungsforschung soll in einem zweiten Teil der Arbeit anhand der sogenannten Two-Step-Flow Theorie aufgezeigt werden, welche Rolle dem Medium Mensch durch interpersonale Kommunikation bei der Vermittlung von Ansichten und bei der Meinungsbildung im Vergleich zu den Massenmedien zukommt. Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge werden an dieser Stelle zwei wichtige offizielle Studien zu dieser Theorie komprimiert vorgestellt und in Relation zur Frage der Bedeutung der Menschenmedien beschrieben.
Ein gutes Beispiel für den Einfluss und den Stellenwert, welchen Menschen als verteilende Medien in der Öffentlichkeit einnehmen können ist das Prinzip der Verehrung von Prominenz und Stars. Über herausgearbeitete Merkmale und Funktionen von Prominenten und Stars in der heutigen Gesellschaft soll im letzten Teil der Arbeit geklärt werden, was diese eigentlich ausmacht, warum sie verehrt werden und wie sie als Mensch als Medium wirken können. Mit der Nutzung moderner Massenmedien werden Stars heutzutage nicht mehr nur von Angesicht zu Angesicht bewundert und Prominente nicht mehr nur durch unmittelbaren Publikumskontakt bekannt, sondern auch über diesen Umweg, der allerdings für eine großflächige Verbreitung sorgt. Somit gewinnen Menschenmedien auf indirektem Weg stark an Bedeutung im Vergleich zu anderen Medien.
2. Medieneinteilung nach Kommunikationsebene
In seinem Werk „Medienforschung“ von 1972 teilt der Publizist und Medienwissenschaftler Harry Pross Medien anhand ihrer spezifischen Eigenschaften und ihres technischen Charakters in primäre, sekundäre und tertiäre Medien ein. Der Medien- und Kommunikationssoziologe Manfred Faßler nimmt diese Einteilung 1997 in seinem Buch „Was ist Kommunikation?“ auf und fügt ihr eine vierte Ebene hinzu – die quartären Medien.
2.1 Primäre Medien
Nach Harry Pross basieren primäre Medien auf den „Mittel[n] des menschlichen Elementarkontaktes”[1]. Er geht davon aus, dass jegliche menschliche Kommunikation erst einmal in der primären Bezugsgruppe beginnt, ohne dass dafür technische Hilfsmittel vonnöten sind - weder beim Sender noch beim Empfänger. Hier findet Kommunikation unmittelbar von Angesicht zu Angesicht statt, und es ist keinerlei technisches Gerät zwischen Kommunikator und Rezipient geschaltet, um Botschaften auszutauschen. Dies kann über weit mehr Möglichkeiten als nur über Sprache funktionieren, da dem Menschen mit seinem Körper wesentlich mehr Möglichkeiten für eine direkte, nonverbale Kommunikation zur Verfügung stehen. Vor allem über Gestik und Mimik, wie mit dem Ausdruck des Körpers und mit den unterschiedlichsten Ausdrucksmöglichkeiten allein der einzelnen Gesichtspartien wird anderen bewusst und unbewusst etwas mitgeteilt. Damit eine Botschaft erfolgreich übermittelt wird und vom Empfänger auch verstanden und nicht missdeutet wird, bedarf es allerdings gewisser gemeinsamer Kenntnisse. Dazu muss das Wahrgenommene in einen bestimmten festgelegten Codex eingebunden werden, welcher beiden Parteien dafür gemeinsam zugrunde liegen sollte.[2] Voraussetzung ist lediglich, dass die vorhandenen menschlichen Sinne dazu ausreichen, eine Botschaft zu produzieren, sie zu transportieren und auch sie zu empfangen. Hieraus wird deutlich, dass die für diese Arbeit wichtigen Menschenmedien eindeutig den primären Medien zuzuordnen sind. Beispiele für mimische und gestische Ausdrucksmöglichkeiten des primären Mediums Mensch sind Gebärden und Laute wie Lachen und Weinen, aber auch spezifische Fingersprache und Gerüche gehören dazu. Verschiedene dieser leiblichen Ausdrucksmittel sind zu Konventionen, Zeremoniellen und Traditionen geworden und dadurch in ihrem Gebrauch normiert worden, so dass sie durch streng geregelte Symbole und Rituale eine festegelegte Deutung bei ihren Benutzern haben.[3] Das wichtigstes Kommunikationsmittel der Menschenmedien bleibt allerdings die Sprache.
2.2 Sekundäre Medien
Sekundäre Medien werden in Pross’ Einteilung dadurch gekennzeichnet, dass der Kommunikator ein Gerät braucht, um „eine Botschaft zum Empfänger [zu] transportieren, ohne dass der ein Gerät benötigt, um die Bedeutung aufnehmen zu können“.[4] Diese Geräte und die damit verbundenen Arbeitsgänge definieren also die an dieser Stelle beschriebenen Kommunikationsmittel. Bei der Vermittlung von Information überwinden sekundäre Medien als erste Massenmedien Raum und Zeit und halten Mitteilungen somit verfügbar und unterstützen Wahrnehmungs- und Erinnerungsprozesse.[5]
Ein Meilenstein für deren Durchsetzung ist die Erfindung der Druckerpresse gegen Ende des 15. Jahrhunderts, welche grundlegende Voraussetzung ist für eine ganze Reihe von Medien in diesem Bereich. Nach einfacheren sekundären Kommunikationsmitteln wie Feuer oder Flaggen sind damit Bücher, Flugschriften, Zeitungen und Zeitschriften und deren kosten- und zeitsparende Vervielfältigung und großflächige, weitreichende Verbreitung erst möglich geworden. Sie haben der Allgemeinheit Informationen zugänglich gemacht, die ihr ansonsten verwehrt geblieben wären. Aber auch Schrift, Bild, Grafik und Fotografie gehören zu den medialen Errungenschaften, die von der Druckerpresse abhängig sind und daher im weitesten Sinne zu den Printmedien gezählt werden können.
All diese Erfindungen haben gemeinsam, dass zu deren Herstellung technisches Gerät notwendig ist - sei es ein mit Stift und Papier geschriebener Brief oder eine durch Belichtung und Entwicklung weitaus umständlicher herzustellende Fotografie -, die Rezeption aber jedem gesunden Menschen ohne Hilfsmittel möglich ist. Außerdem hat die Einführung sekundärer Medien zu einer grundlegenden Strukturveränderung in der Denkweise und Weltanschauung der Menschen geführt, auch weil die externerne Speicherung von Information plötzlich möglich geworden ist. „Die Form des gedruckten Buches erzeugte eine neue Methode, Inhalte zu organisieren, und förderte damit eine neue Methode zur Organisierung des Denkens. Die strenge Linearität des gedruckten Buches – der sequentielle Charakter seiner Satz-für-Satz-Darstellung, seine Einteilung in Abschnitte, seine alphabetisch geordneten Register, seine vereinheitlichte Orthographie und Grammatik – begründete Denkgewohnheiten und eine Bewusstseinsstruktur, die der Struktur der Typographie eng verwandt waren und die James Joyce ironisch als ‚ABCED-mindedness’ (ABC-Gesinnung + ‚absent-mindedness’ / Geistesabwesenheit) bezeichnet hat.“[6]
2.3 Tertiäre Medien
„Kommunikatoren und Rezepienten brauchen Geräte“[7] damit eine gelungene Übertragung von Information über tertiäre Medien funktionieren kann. Auf beiden Seiten im Kommunikationsprozess muss also technische Apparatur vorhanden sein, um eine funktionierende Kommunikation zu gewährleisten. Hierzu sind elektronische Kommunikationsmittel nötig, die mittels komplexer technischer Vorgänge Wort und Bild in elektrische Signale umsetzen. Diese werden dann auf Medien gespeichert oder über eine Sendeanlage ausgestrahlt bzw. weitergeleitet, um von spezifischen Empfangsanlagen aufgefangen und in ein für den Empfänger verständliches Signal umgewandelt zu werden. Der Kommunikationsprozess ist also bei Produktion, Sendung und Empfang an komplizierte Technik gebunden. Beispiele hierfür sind etwa das Telefon oder die Schallplatte, aber auch die sogenannten Rundfunkmedien mit Radio und Fernsehen sind klassische tertiäre Medien. Sie stellen eine Erweiterung der weiter oben genannten sekundären Medien dar, indem sie dem Nutzer eine Vielfalt an Möglichkeiten zur Kommunikation und Information bieten. „Neue Kommunikationsmittel revolutionieren den jeweiligen status quo, weil sie den Vorteil früherer Informationen verschaffen und neue Arbeitsteilungen erzwingen.“[8] Und „es steht außer Frage, dass optische wie akustische Medien, dass die audiovisuellen Techniken der Konservierung den Privatraum erweitern, indem sie in ihn eindringen“[9] – eine Tatsache, die auch auf die nächst höhere Kommunikationsebene zutrifft.
2.4 Quartäre Medien
Nach Manfred Faßler gehören zu den quartären Medien „die computerbasierten und –verstärkten Medienbereiche netztechnischer und elektronisch-räumlicher Konsumption, Information und Kommunikation. Sie sind durch die Telematik (Tele- & Informatik oder auch: Tele- und Automatik), durch das globale System der Fernanwesenheiten bestimmt.“[10] Teil dieser quartären digitalen ‚neuen Medien’ sind die sogenannten Hypermedien. Sie enthalten hypermedial gestaltete Informationsdarstellungen zu einem Thema oder Wissensbereich und basieren auf einer Technik der elektronischen Verknüpfung unterschiedlicher Medien; das heißt Text, Bild, Ton, Grafik und Video können multimedial miteinander vernetzt sein, wobei der Rezipient problemlos über sogenannte ‚links’ von einer Informationsquelle zur anderen wechseln kann. Der Begriff Cybermedien steht für eine eigene Welt der virtuellen Realität, die für den Menschen erst einmal gar nicht räumlich greif- und vorstellbar ist, da sie nur in den weltweit vernetzten Computern besteht - also eine digitale Scheinrealität, welche physisch so gar nicht existiert. Inzwischen verwendet man den Begriff quasi als Synonym für das Internet. Gemeinsam ist allen quartären Medien, dass sie aus einem permanenten computerbasierten Netz von Individualmedien bestehen.
3. Mediale Funktionen von Menschen
Dieser Arbeit liegt die Gliederung der in Kapitel 2.1 näher bestimmten primären Menschenmedien in Vermittler- und Verteilermedien zugrunde. Somit wird die mediale Funktion von Menschen als Medien heutzutage in zwei unterschiedliche Rollen aufgeteilt. Zum einen fungiert der Mensch als Vermittler, wobei er in seiner Kommunikation bestrebt ist, die Realität möglichst genau abzubilden, das heißt er dient als reiner Träger von Information, ohne diese zu interpretieren. Dabei nimmt er die Funktion eines Boten oder Zwischenträgers ein, welcher die ihm zugetragenen Informationen möglichst 1:1 weitervermittelt. Zum anderen können Menschenmedien als Verteiler wirken. Hier geht es darum, Kommunikation zu einem Publikum aufzubauen und sich persönlich mitzuteilen. Das Medium Mensch verteilt in diesem Fall also Information, die eine höchsteigene Interpretation durchlaufen hat oder gar dem Medium selbst entspringt. Beispiel hierfür ist die gesamte mediale Unterhaltungsbranche im Bereich der primären Medien wie das Theater oder Kabarett mit ihren Stars und Prominenten aber auch weniger bekannten Größen. Wobei Menschenmedien in der heutigen Zeit auch innerhalb eines höheren Mediums für vermittelnde wie verteilende Kommunikation sorgen können. In dem tertiären Medium Fernsehen beispielsweise können demnach beide mediale Funktionen von einzelnen Personen wahrgenommen werden. Während der Tagesschausprecher versucht, die ihm gegebenen Informationen neutral und interpretationsfrei zu vermitteln, wird der Schauspieler in einem Spielfilm bestrebt sein, in seiner Rolle einen möglichst persönlichen Eindruck seiner Leistung im Publikum zu verteilen und zu hinterlassen.
Werner Faulstich hat sich in seinem Buch „Medien und Öffentlichkeiten im Mittelalter 800-1400“ u.a. den Menschenmedien im Mittelalter angenommen, und unterscheidet in ähnlicher Art und Weise zwischen zwei Funktionen von Menschen (im Mittelalter). Einerseits stellt er, wie er es nennt, die „bloße mediale Funktion“ des Menschen heraus, andererseits zeigt er auf, wie der Mensch als „Medium“ wirkt.[11] Ähnlich der Definition des Vermittlermediums steht die ‚bloße mediale Funktion’ des Menschen für eine möglichst unverfälschte Darstellung der Wirklichkeit, bei der das Medium Mensch lediglich als Mittel oder Instrument fungiert.[12] Als Beispiel hierfür wird von Faulstich der mittelalterliche Historiograph beschrieben, welcher Geschichte rekonstruiert, dabei Sachverhalte den klaren Tatsachen entsprechend wiedergibt und Namen und Jahreszahlen aufzählt. Aber auch die Ritter dieser Zeit haben nur noch eine mediale Funktion und entfernen sich immer weiter davon, ein interpretierendes Kommunikationsmedium zu sein. Sie repräsentieren und stabilisieren die feudale Herrschaft beispielsweise in Spielen und Turnieren durch ihre öffentliche Demonstration herrschaftlicher Rollen, und halten sich dabei an feste Regeln und Rituale.[13]
Die bestimmendere Funktion der primären Menschenmedien Ende des Mittelalters liegt jedoch im Unterhaltungs- und Spektakelbereich. Äquivalent zu der weiter oben genannten Verteilerfunktion von Menschenmedien heutzutage liegt der Schwerpunkt hier auch auf der persönlichen Prägung und Interpretation der Information. So wirkt der Mensch als ‚Medium’ der Kommunikation und prägt damit „strukturell hier Information, Unterhaltung, Kommunikation und deren Speicherung – und damit die Sicherung der politischen, sozialen und ökonomischen Feudalherrschaft.“[14] Beispiel hierfür ist der mittelalterliche Berufsstand der Hofnarren, Sänger und Erzähler, die ihrer Informationsübermittlung als Kommunikationsmedium allesamt einen deutlichen persönlichen Stempel aufdrücken. Aus dieser Beschreibung wird klar, dass die Funktion des ‚Mediums’ sich bei Faulstich also mit der ‚Verteilerfunktion’ vergleichen lässt, und die „bloße mediale Funktion’ von Menschen zu einem großen Teil mit der ‚Vermittlerfunktion’ von Menschenmedien übereinstimmt.
4. Two-Step-Flow Theorie
Die ursprüngliche Annahme der Medienwirkungsforschung bis Mitte des 20. Jahrhunderts lautet, dass Massenmedien nahezu alle Rezipienten erreichen, dass diese die verbreiteten Botschaften direkt aufnehmen, was auch Grund für eine Meinungsänderung darstellen kann, und schließlich, dass sie auch so handeln, wie die Medien es ihnen vorschreiben. Mit anderen Worten, es wird davon ausgegangen, dass das primäre Medium Mensch durch die höhergestellten Medien komplett manipulierbar ist. Bis dahin wird der Rezipient als isoliert gesehen, ohne seine soziale Verankerung in der Gesellschaft zu berücksichtigen, und damit der Einfluss verkannt, den andere Menschenmedien in der Meinungsbildung auf ihn haben.[15]
4.1 Die People’s Choice Studie
Der Wahlforscher Paul Lazarsfeld und seine Mitarbeiter führen 1940 während der Präsidentschaftswahlen in den USA eine Studie über Wahlpropaganda durch, um das Konzept der direkten und einseitigen Wirkung der Massenmedien zu überprüfen. In dieser Panelstudie mit dem Namen ‚The People’s Choice’ kommen sie zu dem Ergebnis, dass Wähler in ihrer Wahlentscheidung weniger durch Massenmedien beeinflussbar sind als zuvor angenommen. Daraufhin entwickeln sie die Hypothese des „Zwei-Stufen-Flusses der Kommunikation“ und das Konzept des „Opinion Leader“, zu deutsch „Meinungsführer“.[16]
Two-Step-Flow Of Communication
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Bildquelle: http://www.wi.fh-osnabrueck.de)
Menschen sind soziale Wesen und zumeist fest in einem sozialen Umfeld verankert, wodurch sie darauf angewiesen sind, „ihre Orientierungen und Verhaltensweisen mit anderen zu vergleichen, zu bewerten und darauf abzustimmen: sozialer Vergleich, Konformitätsdruck und Anerkennungsbedürfnis.“[17] Diese Tatsache führt dazu, dass Meinungsbildung und persönliche Ansicht auch, aber nicht allein durch massenmediale Einflüsse bestimmt wird, sondern vielmehr durch interpersonale Kommunikation in der Gruppe. Besonders wichtig ist das Zusammenspiel von beiden: Die sekundären wie tertiären (und mittlerweile auch quartären) Massenmedien liefern einen Impuls, welcher erst über die sogenannten ‚Opinion Leader’ als primäre Menschenmedien zu den weniger aktiven und interessierten Teilen der Bevölkerung geleitet wird, und dort für das Festsetzen von Überzeugungen sorgt. Für die politische Wahlentscheidung von Menschen heißt das konkret, dass ‚Meinungsführer’ aus dem persönlichen Umfeld größeres Gewicht bei der Entscheidung der Abstimmung für oder gegen eine Partei haben als Massenmedien. „Zu unserer großen Überraschung fanden wir heraus, dass die Wirkung [der Massenmedien] ziemlich gering war. Wir erhielten den Eindruck, dass Menschen in ihren politischen Entscheidungen mehr durch Kontakte von Mensch zu Mensch beeinflusst werden - etwa durch Familienmitglieder, Bekannte und Nachbarn, sowie durch Arbeitskollegen - als unmittelbar durch die Massenmedien.“[18] Das primäre Medium Mensch ist also auch in der Massenkommunikation sehr wohl persönlich eingebunden in Entscheidungsfindungsprozesse.
4.2 Folgestudien und Kritik
Zwecks Ausbau und Weiterentwicklung der Ergebnisse der ersten Studie und der Untersuchung der spezifischen Eigenschaften der ‚Meinungsführer’ führen Lazarsfeld und andere Folgestudien durch, wie 1954 die sogenannte Elmira-Studie und 1955 die Decatur-Studie. Die Decatur-Studie hat ihren Namen nach einer Stadt im mittleren Westen der USA, in welcher für die Untersuchung etwa in jedem 20. Haushalt eine erwachsene weibliche Person eingehend zu Marketing, Mode, Kinobesuch und Politik befragt wird. Den Frauen werden jeweils zwei Fragen gestellt:
1. „Haben Sie in letzter Zeit jemandem einen politischen Rat gegeben?“
2. „Hat Sie jemand in letzter Zeit um ihren Rat bezüglich politischer Fragen gebeten?“[19]
Auf diese Weise werden über das Schneeballverfahren Primärgruppen miteinbezogen, da man über die Fragen direkt zur nächsten Person gelangt, und sich so auch der Weg und die Ausbreitung einer Meinung oder Information nachvollziehen lässt. Und auch in dieser Studie wird die Hypothese vom ‚Zwei-Stufen-Fluss der Kommunikation’ bestätigt, und die Schlussfolgerungen aus der People’s Choice Studie bekräftigt. Der Mensch existiert innerhalb der sozialen Gruppe und ist Teil eines Netzwerkes von Sozial- und Kommunikations-beziehungen. Innerhalb der Gruppe wird interpersonal von Angesicht zu Angesicht kommuniziert, wodurch Meinungen neu gebildet, verändert oder auch bestärkt werden können. „Charakteristika der Meinungsführer sind: ein höheres politisches Interesse, kosmopolitische Orientierung, höhere Mediennutzung, höhere Aufmerksamkeit für die Gruppe“[20], und dadurch bilden sie als primäre Menschenmedien das Bindeglied zwischen den Massenmedien und ihrer sozialen Gruppe. Wobei die ‚Opinion Leader’ hier auch als neutrale Vermittler von Informationen fungieren, aber hauptsächlich interpretierende Verteiler von Kommunikation sind, und ihre Mitmenschen damit mehr beeinflussen und manipulieren als die Massenmedien selbst.
Kritisch gesehen besteht der Kommunikationsprozess allerdings aus viel mehr als nur zwei Stufen, wie sie im oben beschriebenen Meinungsführerkonzept beschrieben werden. Der interpersonale Kommunikationsprozess ist weitaus komplexer und bietet noch mehr Informationsquellen als nur einzelne Meinungsführer. Diese tauschen sich im übrigen auch untereinander aus, und beeinflussen damit die Meinungsbilder sowohl untereinander als auch in ihrer jeweiligen Gruppe – dies wird „Opinion Sharing“ genannt.[21] Es muss außerdem unterschieden werden „zwischen dem Prozess der Informationsverbreitung vorab durch die Medien und jenem der Meinungsbeeinflussung“[22], das heißt grundlegende Informationen gelangen durchaus direkt von den Massenmedien zu den einzelnen Individuen, lediglich zusätzliche aber wichtige Informationen benötigen ‚Meinungsführer’, um das Publikum zu erreichen und zu lenken.
5. Prominente und Stars
5.1 Begriffsbestimmung
Das Wort ‚prominent’ kommt von dem lateinischen Verb ‚prominere’ [zu deutsch: herausragen] und bedeutet soviel wie hervorragend, bedeutend, maßgebend und berühmt. Birgit Peters merkt in ihrer Dissertation mit dem Titel „Prominenz – Eine soziologische Analyse ihrer Entstehung und Wirkung“ an, dass Prominenz ein Kreis von Personen mit hohem Bekanntheitsgrad ist, „die sich dadurch auszeichnen, dass sie von mehr Leuten gekannt werden, als sie selbst kennen.“[23] Auf der Grundlage dieser Annäherung an eine Definition ist allerdings auch jeder Schullehrer und Hochschulprofessor ein Prominenter. Hier geht es aber vielmehr um Prominente, die so gut wie jeder aus der Bevölkerung wenigstens mit Namen und ungefährer Tätigkeit kennt. Der Begriff wird dabei zumeist für Personen aus dem Bereich von Kunst, Sport, Politik und Medien gebraucht, wobei ein Prominenter auch aus jedem beliebigen anderen gesellschaftlichen Bereich kommen kann. Das auffälligste gemeinsame Merkmal der heutigen Prominenten ist jedoch ihre Präsenz in den Massenmedien, ohne welche der nötige Bekanntheitsgrad gar nicht zustande kommen kann. Mit dieser Abhängigkeit von den Medien verhält es sich ähnlich bei der Gruppe der ‚Stars’, die im folgenden in Abgrenzung zum Begriff der ‚Prominenz’ näher beleuchtet werden soll. „Stars bilden auch eine Teilmenge der Kategorie Prominente: Nicht alle Prominente sind Stars, aber alle Stars gehören zur Kategorie der Prominenten.“[24] Ein Star [englisch: der Stern] ist laut Meyers großem Handlexikon „jemand, der auf einem bestimmten Gebiet (besonders Film, Musik, Sport) Berühmtheit erlangt hat (und sich entsprechend feiern lässt).“ Dieser unvollständigen Definition ist aber hinzuzufügen, dass der Begriff des ‚Stars’ mehr beinhaltet als der der ‚Prominenz’, da ein Star in der Regel bekannter ist in der Öffentlichkeit und einen höheren Aufmerksamkeitswert sowie Nachrichtenwert besitzt. Sowohl Prominente als auch Stars lassen sich jedoch eindeutig den primären Menschenmedien zuordnen, und sind anschauliche Beispiele für Verteilermedien. Ob face-to-face oder innerhalb eines höheren Mediums, Stars und Prominente sind mehr als bloße Informationsvermittler und leisten wesentlich mehr als ein reines Abbilden der Realität. Sie sind durch bestimmte ihnen eigene Merkmale und Funktionen gekennzeichnet, die im folgenden beschrieben werden.
5.2 Merkmale und Funktionen von Prominenz
Prominente haben eine Leitbildfunktion: Zwar geht die in Kapitel 4 beschriebene ‚Two-Step-Flow Theorie’ mit dem Konzept des ‚Opinion Leader’ davon aus, dass besonders Freunde und Bekannte aus dem näheren sozialen Umfeld zu einem großen Teil für Meinungsbildung verantwortlich sind. Doch auch Prominente fungieren als ‚Opinion Leader’, und je prominenter jemand ist, desto häufiger wird ihm ein Einfluss auf die politische Meinungsbildung zugeschrieben.[25] Das heißt aber nicht, dass der Prominentenstatus immer mit einer meinungsbildenden Funktion einhergeht, gerade was politische Einstellungen betrifft. Vielmehr wirken Prominente aus ganz bestimmten Bereichen meinungsbildend für ihre ganz bestimmten Zielgruppen.
Prominente haben Aufmerksamkeitswert: Sie rufen allein durch ihre persönliche Anwesenheit, reichweitenbedingt jedoch vor allem innerhalb der höheren Kommunikations-medien eine erhöhte Aufmerksamkeit beim Publikum hervor, was sich die Werbeindustrie ja bekanntermaßen häufig für kommerzielle Zwecke zu Nutze macht. Manchmal reicht aber auch ihr bloßes Erwähnen, um Interesse in der Öffentlichkeit zu erwecken.
Prominente haben Nachrichtenwert: Bereits 1965 machen die Kommunikations-wissenschaftler Johan Galtung und Mari Holmboe Ruge anhand ihrer ‚Nachrichtentheorie’ mit einem ihrer bestimmten ‚Nachrichtenfaktoren’ darauf aufmerksam, dass Elite-Personen, also auch Prominente, im Nachrichtenfluss schon bei der journalistischen Selektion von Nachrichten bevorzugt werden, und damit eher in die Berichterstattung aufgenommen werden.[26] Durch einen Bezug zu Prominenten werden an sich uninteressante Nachrichten für die Öffentlichkeit interessant oder wenigstens meldenswert.
Prominente haben Unterhaltungswert: Birgit Peters stellt anhand von Befragungen fest, dass ein repräsentatives Publikum den Faktor ‚Unterhaltsamkeit’ bei Prominenten besonders hoch bewertet.[27] Im Bereich der Massenmedien, welche sich ja stets an den Wünschen des Publikums orientieren, wird dies besonders in der Beliebtheit der mannigfaltigen Boulevardpresse und -magazine deutlich.
Prominente und Selbstkommunikation: Prominente machen sich selbst mit ihrer eigenen Person zum Inhalt von Nachrichten. Daraus folgt, „dass die Prominenten selbst zum Issue werden, ihre Person demnach selbst Gegenstand der Information ist und dass sie aufgrund dieser Eigenschaft über ihre Person wiederum andere Informationen in die Medien lancieren können. Daher stellt Prominenz ein Kapital dar, das einsetzbar ist, um massenmediale Aufmerksamkeit für die eigene Person und für eigene Anliegen zu finden.“[28]
5.3 Merkmale und Funktionen von Stars
Stars sind außeralltäglich: Sie besitzen außerordentliche Eigenschaften und sind weit weg vom Alltag umgeben von einer speziellen „Aura“ des Besonderen und Unnahbaren, ähnlich einer „einmaligen Erscheinung“[29], wie Walter Benjamin es in seinem Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ beschreibt. Diese Außeralltäglichkeit bietet dem Publikum gedanklich die Möglichkeit zur Flucht aus dem Alltag in eine andere Welt.
Stars haben Fans: „Ich legte mir einen Kelly-Ordner an und begann eifrig, die nun immer häufiger erscheinenden Artikel zu sammeln. Gleichzeitig hatten wir die Idee zu einem Kelly-Family-Fanclub.“[30] Dieser Ausschnitt aus einem Erlebnisbericht eines passionierten Fans der Popgruppe die ‚Kelly Family’ ist ein gutes Beispiel zur Verdeutlichung, warum Menschen erst durch die Verehrung ihrer Fans, die sich teilweise sogar professionell als Anhängerschaft in sogenannten Fanclubs organisieren, zu Stars werden.
Stars werden idealisiert: Sie werden von ihrem Publikum häufig völlig verklärt, nicht der Realität entsprechend wahrgenommen und eher unsympathische und nicht ins Idealbild passende Eigenschaften an ihnen werden beschönigt. „Zum Star wird, so kann man weiterhin allgemein feststellen, eine Person erst dann, wenn das Publikum in ihm auf idealisierte, überhöhte Weise Eigenschaften wiedererkennt, die es sich selbst zuschreibt.“[31]
Auf Stars wird projiziert: Da kaum jemand aus der Bevölkerung einzelne Stars persönlich kennt, werden Wesenszüge und Merkmale in sie hineinprojiziert, die sie gar nicht besitzen. Auf diese Art und Weise werden sie als diejenigen angesehen, die an Stelle des Publikums selbst Dinge tun und erleben, die diesem verwehrt bleiben. Dabei kann das Publikum ersatzweise Erfolg erleben, ohne ständig und überall dem besonderen Druck der Öffentlichkeit ausgesetzt zu sein.
Stars pflegen ein Image: Das ‚Starimage’ teilt sich in drei Unterkategorien auf und besteht aus unterschiedlichen Elementen. Ein Star geht nämlich in erster Linie seiner spezifischen Profession nach, als zweites ist er bloße Arbeitskraft in der Industrie, für welche er tätig ist, und schließlich ist er selbst als Mensch eine Person mit eigener Biographie. Aus diesen drei authentischen Teilen setzt sich nun sein Image zusammen, welches es zu pflegen gilt.[32] Selbstverständlich wird heutzutage auch von Agenten, Beratern und professionellen Agenturen durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit künstlich an einem ‚Starimage’ gearbeitet, so dass auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Durch das Konzept der ‚Imagekontinuität’ wird dabei versucht, das Konsumverhalten und die Präferenzen der Öffentlichkeit berechenbar zu machen und so gut wie eben möglich zu steuern.
Stars machen Meinungen: „Dass unsere Wahrnehmung von Realität zu einem Großteil durch die Meinungsmacher in den Medien geprägt wird, ist eine mittlerweile fast schon banale Feststellung. Prominente aus Politik und Wirtschaft ebenso wie Journalisten und Entertainer, Schauspieler, Sportler, Musiker, Regisseure und Künstler, Modezaren und Starmodels beeinflussen als Multiplikatoren oder Leitbilder unser Verhalten, unsere politischen und gesellschaftlichen Sehweisen und Überzeugungen, ja sogar unser Handeln bis in die ‚kleinen’ Entscheidungen des Alltags hinein.“[33]
6. Schlussbemerkung
Die Opinion-Leader-Forschung hat gezeigt, dass in punkto politischer Meinungsbildung aber auch anderer gesellschaftlich relevanter Themen in erster Linie Menschen die Aufgabe des vermittelnden wie verteilenden Mediums wahrnehmen. Durch interpersonale Kommunikation haben sie dabei in der Wahrnehmung ihrer medialen Funktion mehr Einfluss als die höher gestellten Massenmedien. Auch Prominente und Stars können als Opinion Leader agieren, und somit Teile der Agenda ihres Publikums bestimmen, allerdings findet dies heutzutage in den seltensten Fällen über direkte Kommunikation von Angesicht zu Angesicht statt. Vielmehr existieren diese primären Medien innerhalb der sekundären, tertiären und mittlerweile auch der quartären Medien, behaupten hier eine feste Stellung, und wirken so über einen medialen Umweg auf die Rezipienten. Was die einfache möglichst realitätsgetreue Vermittlung von Information angeht, werden vor allem in der Zukunft die computerbasierten quartären Individualmedien den Menschen als Medium gefährden. Doch werden diese Medien wichtiger und einflussreicher als der Mensch und laufen ihm dabei den Rang in der Kommunikation ab? Die mediale Kommunikation wird sich mit der Entwicklung und Etablierung der neueren Massenmedien seit Beginn des 20. Jahrhunderts zwangsläufig immer weiter verändern, doch geht schließlich alle Informationsübermittlung ursprünglich vom Menschen aus – er hat alle Kommunikationsmittel, die über seine eigenen physischen Möglichkeiten hinausgehen geschaffen, und er bestimmt letztendlich noch eine Stufe vor der massenmedialen Verarbeitung von Information, wer, wo und wie informiert wird. Dennoch ist die bereits in der Einleitung gestellte Frage nicht eindeutig zu beantworten, aber ein Abschnitt aus der Rede des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog anlässlich der Verleihung des Carl-Bertelsmann-Preises am 10. September 1998 in Gütersloh soll ein Versuch dazu sein: „Gleichzeitig entsteht eine Vielzahl von neuen Dienstleistungsberufen, in denen auf Kreativität und menschliche Zuwendung nicht verzichtet werden kann. Wir erleben aber auch, wie klassische Dienstleistungsbereiche selbst wieder durch eine fortschreitende Technik unter Druck geraten. Das ‚Telebanking’ verändert die Arbeitswelt der Banken, ‚Teleshopping’ und ‚Electronic Commerce’ wird den Einzelhandel herausfordern. Und ob man künftig noch Reisebüros braucht, um seinen Urlaubsflug zu buchen, muss die Zukunft zeigen. Nicht alles, was technisch möglich ist, wird den Markt dominieren. Erst wenn wir mit den neuen Techniken experimentieren, werden wir uns klar darüber werden können, wo die Digitalisierung von Arbeits- und Geschäftsbereichen enden muss, weil sich letzten Endes der Mensch immer wieder als unersetzbar erweist.“[34]
Literaturverzeichnis
- Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Suhrkamp, Frankfurt/Main 1963
- Biermann, Christine (Hrsg.): Stars – Idole – Vorbilder. Friedrich Verlag, Seelze 1997
- Bonfadelli, Heinz: Medienwirkungsforschung, Band 1. Grundlagen und theoretische Perspektiven. UVK, Konstanz 1999
- Faßler, Manfred: Was ist Kommunikation? Fink Verlag, München 1997
- Faulstich, Werner: Medien und Öffentlichkeit im Mittelalter 800-1400. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1996
- Faulstich, Werner/ Korte, Helmut (Hrsg.): Der Star: Geschichte, Rezeption, Bedeutung. Fink Verlag, München 1997
- Giesecke, Michael: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit: Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Suhrkamp, Frankfurt/Main 1998
- Lazarsfeld, Paul/ Berelson, Bernard/ Gaudet, Hazel: The People’s Choice. Columbia University Press, New York 1948
- Noelle-Neumann, Elisabeth/ Schulz, Winfried/ Wilke, Jürgen (Hrsg.): Fischer Lexikon Publizistik/Massenkommunikation. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 1997
- Peters, Birgit: Prominenz in der Bundesrepublik: Bedingungen und Bedeutungen eines Phänomens. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin 1993
- Peters, Birgit: Prominenz: Eine soziologische Analyse ihrer Entstehung und Wirkung. Westdeutscher Verlag, Opladen 1996
- Postman, Neil: Das Verschwinden der Kindheit. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 1987
- Pross, Harry: Medienforschung. Film, Funk, Presse, Fernsehen. Habel Verlag, Darmstadt 1972
- Schenk, Michael: Medienwirkungsforschung. Mohr Verlag, Tübingen 1987
- Schramm, Wilbur (Hrsg.): Grundfragen der Kommunikationsforschung. Juventa Verlag, Weinheim 1986
- http://www.kommwiss.fu-berlin.de/~gwersig/lehre.htm (Stand 01.07.2003)
- http://www.wi.fh-osnabrueck.de (Stand 01.07.2003)
- http://preis.stiftung.bertelsmann.de (Stand 01.07.2003)
[...]
[1] Pross, Harry: Medienforschung. Film, Funk, Presse, Fernsehen. Habel Verlag, Darmstadt 1972, S. 128
[2] Vgl. ebd., S. 129
[3] Vgl. ebd., S. 131 ff.
[4] Pross, Harry: a.a.O., S. 128
[5] Vgl. Giesecke, Michael: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit: Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Suhrkamp, Frankfurt/Main 1998, S.33
[6] Postman, Neil: Das Verschwinden der Kindheit. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 1987, S. 41/42
[7] Pross, Harry: a.a.O., S. 224
[8] ebd., S. 226
[9] ebd., S. 233
[10] Faßler, Manfred: Was ist Kommunikation? Fink Verlag, München 1997, S. 117
[11] Vgl. Faulstich, Werner: Medien und Öffentlichkeit im Mittelalter 800-1400. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1996, S. 31
[12] Vgl. Faulstich, Werner: a.a.O., S. 32/33
[13] Vgl. ebd., S. 39/40
[14] ebd., S. 49
[15] Vgl. Bonfadelli, Heinz: Medienwirkungsforschung, Band 1. Grundlagen und theoretische Perspektiven. UVK, Konstanz 1999, S. 133
[16] Vgl. Bonfadelli, Heinz: a.a.O. , S. 134
[17] ebd., S. 133
[18] Lazarsfeld, Paul/ Menzel, Herbert: Massenmedien und personaler Einfluss. In: Schramm, Wilbur (Hrsg.): Grundfragen der Kommunikationsforschung. München 1973, S. 120
[19] Schenk, Michael: Medienwirkungsforschung. Mohr Verlag, Tübingen 1987, S. 245
[20] Bonfadelli, Heinz: a.a.O. , S. 136
[21] Vgl. ebd., S.137/138
[22] ebd., S. 138
[23] Peters, Birgit: Prominenz: Eine soziologische Analyse ihrer Entstehung und Wirkung. Westdeutscher Verlag, Opladen 1996, S. 19
[24] Staiger, Janet: Das Starsystem und der klassische Hollywoodfilm. In: Faulstich, Werner/ Korte, Helmut (Hrsg.): Der Star: Geschichte, Rezeption, Bedeutung. Fink Verlag, München 1997, S. 49
[25] Vgl. Peters, Birgit: Prominenz in der Bundesrepublik: Bedingungen und Bedeutungen eines Phänomens. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin 1993, S. 24
[26] Vgl. Schulz, Winfried: Nachricht. In: Noelle-Neumann, Elisabeth/ Schulz, Winfried/ Wilke, Jürgen (Hrsg.): Fischer Lexikon Publizistik/Massenkommunikation. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 1997, S. 331
[27] Vgl. Peters, Birgit: Prominenz. a.a.O., S. 146 ff.
[28] ebd., S. 109
[29] Vgl. Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Suhrkamp, Frankfurt/Main 1963, S. 15
[30] Haag, Sören: Warum ich Kelly-Fan war. In: Biermann, Christine (Hrsg.): Stars – Idole – Vorbilder. Friedrich Verlag, Seelze 1997, S. 6
[31] Hickethier, Knut: Vom Theaterstar zum Filmstar. In: Faulstich, Werner/ Korte, Helmut (Hrsg.): Der Star: Geschichte, Rezeption, Bedeutung. Fink Verlag, München 1997, S. 31
[32] Vgl. Staiger, Janet: Das Starsystem und der klassische Hollywoodfilm. In: Faulstich, Werner/ Korte, Helmut (Hrsg.): a.a.O., S. 49
[33] Faulstich, Werner/Korte, Helmut (Hrsg.): Der Star. Fink Verlag, München 1997, S. 7
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Menschen als Kommunikationsmedium im Vergleich zu anderen Medienformen. Es wird der Frage nachgegangen, ob der Mensch das wichtigste und einflussreichste Medium ist oder ob ihm andere Medien den Rang abgelaufen haben.
Wie werden Medien in dieser Arbeit eingeteilt?
Die Arbeit orientiert sich an der Einteilung von Harry Pross und Manfred Faßler in primäre, sekundäre, tertiäre und quartäre Medien. Primäre Medien basieren auf menschlicher Kommunikation ohne technische Hilfsmittel. Sekundäre Medien benötigen technische Geräte beim Sender, aber nicht beim Empfänger. Tertiäre Medien erfordern Geräte sowohl beim Sender als auch beim Empfänger. Quartäre Medien sind computerbasiert und netzwerkartig.
Welche medialen Funktionen von Menschen werden unterschieden?
Es wird zwischen der Funktion als Vermittler und als Verteiler unterschieden. Als Vermittler gibt der Mensch Informationen möglichst neutral und interpretationsfrei weiter. Als Verteiler prägt und interpretiert er die Informationen selbst.
Was besagt die Two-Step-Flow-Theorie?
Die Two-Step-Flow-Theorie besagt, dass Massenmedien nicht direkt auf alle Rezipienten wirken, sondern dass die Meinungsbildung stark durch "Meinungsführer" (Opinion Leader) beeinflusst wird. Diese Meinungsführer erhalten Informationen aus den Massenmedien und geben sie dann interpretiert an ihr soziales Umfeld weiter.
Wer sind Prominente und Stars und welche Rolle spielen sie als Medien?
Prominente und Stars sind Personen mit hohem Bekanntheitsgrad, die oft als Meinungsführer agieren und durch ihre Präsenz in den Medien Aufmerksamkeit erregen. Sie können als Leitbilder dienen und das Verhalten und die Meinungen der Öffentlichkeit beeinflussen. Stars zeichnen sich zusätzlich durch ihre Außeralltäglichkeit, die Verehrung durch Fans und Idealbilder aus.
Welche Merkmale haben Prominente?
Prominente haben Aufmerksamkeitswert, Nachrichtenwert, Unterhaltungswert, eine Leitbildfunktion und können Selbstkommunikation betreiben.
Welche Eigenschaften zeichnen Stars aus?
Stars sind außeralltäglich, werden idealisiert, von ihrem Publikum wird auf sie projiziert, sie haben Fans und pflegen ein Image.
Welche Kritik gibt es an der Two-Step-Flow-Theorie?
Kritisiert wird, dass der Kommunikationsprozess komplexer ist als nur zwei Stufen und dass es mehr Informationsquellen als nur einzelne Meinungsführer gibt. Außerdem wird betont, dass zwischen der Verbreitung von Informationen und der Beeinflussung von Meinungen unterschieden werden muss.
Welches Fazit zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der Mensch als Medium weiterhin eine wichtige Rolle spielt, insbesondere bei der Meinungsbildung und durch interpersonale Kommunikation. Computerbasierte Medien werden die realitätsgetreue Vermittlung von Informationen weiter vereinfachen, aber Mensch wird immer als unersetzbar erweisen.
Wo finde ich das Literaturverzeichnis?
Das Literaturverzeichnis befindet sich am Ende der Arbeit und listet die verwendeten Quellen auf.
- Quote paper
- Jens Buchwald (Author), 2002, Menschenmedien als Vermittler und Verteiler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108252