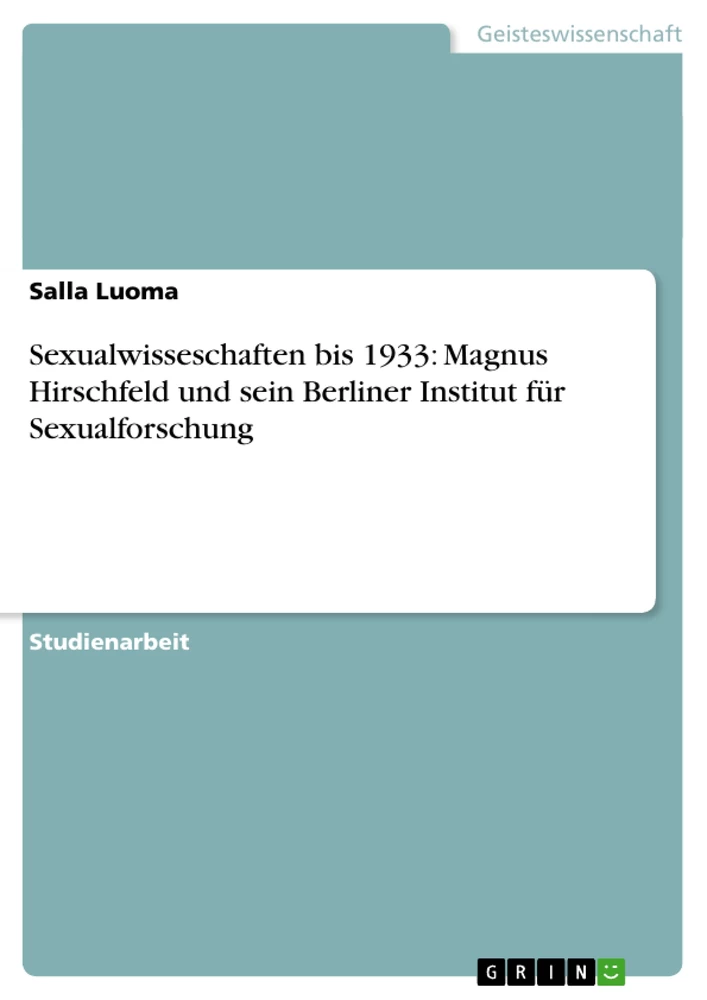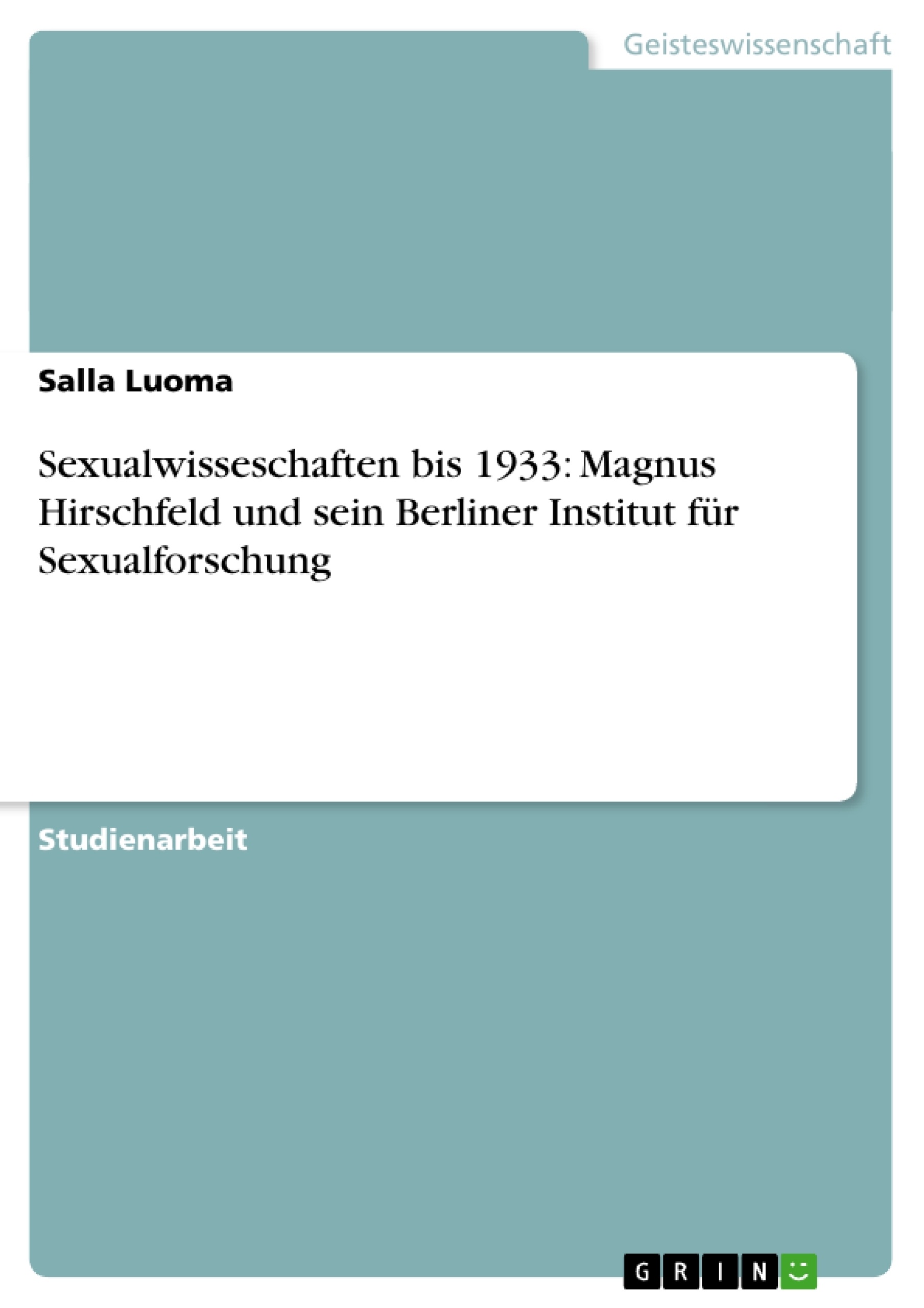Was geschieht, wenn wissenschaftliche Erkenntnis auf gesellschaftliche Vorurteile trifft? Tauchen Sie ein in das bahnbrechende Wirken von Magnus Hirschfeld und sein revolutionäres Institut für Sexualwissenschaft in Berlin, eine Institution, die in den Goldenen Zwanzigern zum Leuchtfeuer der Aufklärung avancierte und gleichzeitig zur Zielscheibe des aufkeimenden Hasses wurde. Diese fesselnde Darstellung beleuchtet die mutigen Pioniere der Sexualforschung, darunter Arthur Kronfeld, Friedrich Wertheim, Kurt Hiller und Helene Stöcker, die sich unermüdlich für die Rechte sexueller Minderheiten einsetzten und Tabus brachen, um ein offeneres Verständnis von Liebe, Geschlecht und Identität zu fördern. Erfahren Sie, wie Hirschfelds Institut zu einem Zufluchtsort für Homosexuelle, Transvestiten und Transsexuelle wurde, ein Ort, an dem Wissenschaft und Alltag ineinandergriffen und die Grundlagen für eine moderne Sexualberatung und -aufklärung geschaffen wurden. Doch der aufkommende Nationalsozialismus warf dunkle Schatten voraus. Verfolgung, Verleumdung und schließlich die Zerstörung des Instituts und die Verbrennung von Hirschfelds Schriften markierten einen tragischen Wendepunkt. Entdecken Sie die Hintergründe dieser Entwicklung, die Mechanismen der Stigmatisierung und die erschreckende Radikalisierung eugenischer Konzepte. Diese tiefgründige Analyse zeichnet nicht nur das Porträt eines außergewöhnlichen Menschen und seines Vermächtnisses, sondern wirft auch ein intriguing Licht auf die komplexen Zusammenhänge zwischen Sexualität, Moral, Politik und gesellschaftlichem Wandel im Deutschland der Weimarer Republik und der frühen NS-Zeit. Eine wichtige Lektüre für alle, die sich für Geschichte, Sexualwissenschaft, LGBT-Rechte und die Gefahren von Intoleranz interessieren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Magnus Hirschfeld und das Berliner Institut
2.1 Liebe – die menschliche Natur
2.2 Stiftung
3 Grundlagen des Instituts für Sexualwissenschaft
3.1 Ehe- und Sexualberatung
3.1.1 Personen im Institut, Institutsgründer
3.1.2 Personen im Institut, Ehe- und Sexualberater
3.1.3 Personen im Institut, Sexualreformer
3.2 Ehetauglichkeit und Empfängnisverhütung
4 Sexualaufklärung im Kaiserreich
4.1 Sexualität und neue soziale Aspekte
4.2 Aufklärung in den Medien
4.2.1 Filme
4.2.2 Publikationen
5 Sexualreform
5.1 § 175 im Reichstrafgesetzbuch
5.2 Homosexualität und Familienpolitische Maßnahmen
6 Magnus Hirschfeld zum Feindbild
7 Schlussbetrachtung
8 Literaturverzeichnis
9 Anlagen
1 Einleitung
Magnus Hirschfeld gilt als eine der bemerkenswertesten Personen der Sexualwissenschaften. Mit seinem Institut in Berlin hat er einen großen Schritt in seiner Zeit machen können; durch seine Forschungen und Theorien wurden Perspektiven ebenso in der Politik als auch in der Gesellschaft eröffnet. Diese wurden im negativen sowie im positiven Sinne behandelt.
Hirschfelds Institut war der Anfang für die Sexualforschung und Sexualwissenschaft. Erst durch die dort geführten Beratungen und Informationsveranstaltungen wurde es der Bevölkerung ermöglicht, Wissen über das bisher kaum behandelte Thema zu bekommen.
Über Sexualwissenschaften und Eugenik vor 1933 zu schreiben, bedeutet zwangsläufig sich mit ihrer Radikalisierung unter dem Nationalsozialismus auseinander zu setzen, der mit Hilfe eugenischer Konzepte die Verbesserung der Rasse legitimiert hat.
Es werden einige der wichtigsten Personen vorgestellt, die mit ihrer Arbeit insgesamt einen enormen Beitrag für die Sexualwissenschaft geleistet haben. Darunter sind u. a. die Mitbegründer (Dr. med. et phil. Arthur Kronfeld und Dr. med. Friedrich Wertheim) von Hirschfelds Institut sowie einige Sexualreformer (Dr. jur. Kurt Hiller und Dr. phil. Helene Stöcker) zu nennen.
Diese Arbeit versucht verschiedene Aspekte aufzudecken, um einen breiten Überblick über die Sexualwissenschaften und Sexualität vor 1933 zu verschaffen.
2 Magnus Hirschfeld und das Berliner Institut
Der deutsche Sexologe Magnus Hirschfeld (1868-1935) gilt als Pionier der Sexualwissenschaften. Er ist in der amerikanischen Presse als ‚Einstein des Sex’ genannt worden. Hirschfeld unterstützte vor allem die Homosexuellenbewegung. Seine Forschungen im Bereich ‚Sexualität’ sind insgesamt sehr bemerkenswerte Beiträge zur Entwicklung der Sexualwissenschaften.[1]
Magnus Hirschfeld hat neben seinem Philosophie- und Philologiestudium in Medizin promoviert und eröffnete nach seiner Dissertation eine Praxis für Naturheilkunde.[2]
2.1 Liebe – die menschliche Natur
Magnus Hirschfeld hat schon ab 1900 die Ansicht vertreten, dass Homosexualität weder als Krankheit noch als Laster, sondern als natürlich angeborene Variante sexueller Neigung anzusehen sei. Hirschfeld hat zusammen mit Kurt Hiller die ‚Zeitschrift für Sexualwissenschaften’ im Jahr 1908 herausgegeben und daraus resultierend folgte 1910 die Gründung der Ärztlichen Gesellschaft für Sexualwissenschaft und Eugenik in Berlin. Am 6. Juli 1919 wird in Berlin das weltweit erste Institut für Sexualwissenschaften eröffnet.
Die Zeit der Jahrhundertwende gilt als Zeit der Befreiungsbewegungen. In der Sexualität kämpfen Schwule und Lesben um ihre Rechte. Für Hirschfeld bleibt dieses Geschehen nicht in der Schublade liegen; er schreibt seine ersten Bücher über die Liebe. In den Büchern geht es um die Liebe der Männer und Frauen zwischen Personen des eigenen Geschlechts. Für Magnus Hirschfeld erklärt sich die Liebe zu Personen des gleichen Geschlechts aus der menschlichen Natur. Die Homosexualität bei Männern und Frauen wird zum Mittelpunkt in seinen Arbeiten.
2.2 Stiftung
Obwohl der Sexualwissenschaftler seine eigene Homosexualität in der Öffentlichkeit zu verbergen versuchte, lag doch bereits 1920 bei der Berliner Polizei ein ‚deutsch-gewissenhaft’ geführtes Dossier über Dr. Magnus Hirschfeld vor. Kein Wunder also, dass Hirschfeld im Oktober 1920 in München von rechtsradikalen Antisemiten überfallen und krankenhausreif geprügelt wurde.[3]
Gleich nach der Eröffnung des Instituts wird eine Stiftung seines Namens errichtet. Der Sinn und Zweck der Stiftung ist die Erforschung des Sexuallebens in der Gesamtheit, seiner diversen Varianten sowie von Störungen. Das Tätigkeitsfeld des Instituts ist vielfältig und neben der Arbeit der Mitarbeiter finden viele Beratungen und Vorlesungen statt.
Durch seine Arbeiten wird Magnus Hirschfeld schnell weltweit bekannt; es ist zu merken, dass er als erstes tiefgreifende Studien zu diesem verschwiegenen Thema betrieben hat. Die Verfolgung der Nazis führt jedoch dazu, dass M. Hirschfeld seine letzten Jahre im Exil verbringen muss bzw. dazu gezwungen wurde. 1933 wird sein Institut von den Nazis zerstört.[4] Seine über 12.000 Schriften werden öffentlich verbrannt.[5]
1982 wurde zur Ehren von Hirschfeld mit einer sog. Wiedererweckungsbewegung der Sexualwissenschaften begonnen. Diese Forschungsstelle hat sich vorgenommen, mit den früher angefangenen Forschungen weiterzumachen und das Werk von Hirschfeld auszuwerten und zu analysieren. Im März 2000 kam der Film ‚Einstein des Sex’ in die deutschen Kinos.[6]
3 Grundlagen des Instituts für Sexualwissenschaft
Hirschfelds Institut stand in enger thematischer Verbindung mit den wichtigen sozialen und (sexual)politischen Bewegungen seiner Zeit. Sie waren die Triebkraft hinter seinen Arbeiten. Diese Triebkraft der Wissenschaft, die aus der vielfach und massenhaft erlebbaren sog. ‚Sexualnot’ bestand, gibt es nicht mehr. Die heutigen Aufgabenstellungen der Sexualwissenschaft haben wenig mit organisierten politisch-sozialen Bewegungen zu tun.
Hirschfelds Institut war schließlich ein Ort zum Flüchten; für die Angehörigen sexueller Minderheiten, insbesondere den Homosexuellen, Transvestiten und Transsexuellen galt das Institut als ein kulturelles bzw. ein subkulturelles Zentrum ganz eigener Art.
Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft gilt als modern; Wissenschaft und Alltag kontrollieren sich gegenseitig. Daher sind Wissenschaft und Alltag nicht voneinander trennbar. Diese Bedingungen bestehen heute am ehesten im Rahmen der selbstorganisierten Forschung der Frauen-, Lesben- und Schwulenbewegung.[7]
Der Begriff Sexualwissenschaft wurde 1900 geprägt und Publikationsorgane wurden geschaffen. Die ersten sexualreformerischen Laienorganisationen wurden gegründet. Vor dem Ersten Weltkrieg setzte eine Gründungsphase konkurrierender sexualwissenschaftlicher Organisationen im Spannungsfeld von aufklärerischen und sexualreformerischen Bestrebungen einerseits und ‚nicht politisierter’ Akademisierung andererseits ein.[8]
3.1 Ehe- und Sexualberatung
Ab 1919 gilt Hirschfelds Institut als Ehe- und Sexualberatungsstelle. Ab 1922 bis 1932 werden in Deutschland über 400 Sexualberatungsstellen mit unterschiedlichen Schwerpunkten von öffentlichen Trägern gegründet, davon 40 allein in Berlin. Im Jahr 1924 wird das Institut von wöchentlich ca. 20 neuen Fällen aufgesucht. Ebenso wichtig wie die Einzelberatung ist die anonyme Beratung während der Frageabende im Institut, anfangs einmal monatlich, später vierzehntägig wegen der großen Nachfrage. Die Menschen konnten anonym die Fragen auf einen Zettel notieren; diese wurden dann am nächsten Beratungsabend beantwortet und diskutiert.[9]
3.1.1 Personen im Institut, Institutsgründer
Dr. med. et phil. Arthur Kronfeld und Dr. med. Friedrich Wertheim sind die Gründer des Hirschfelds Instituts. Kronfeld (1886-1941) ist Psychiater, Psychologe, Gutachter und Psychotherapeut. Im Institut ist Kronfeld von 1919 bis 1926 als Leiter der ‚Abteilung für seelische Sexualleiden’ tätig.
Zur Eröffnung des Instituts hält Kronfeld das wissenschaftliche Grundsatzreferat über ‚Gegenwärtige Probleme und Ziele der Sexologie’. Kronfeld arbeitet als einziger Arzt in bezahlter Festanstellung. Seine sexualwissenschaftliche Tätigkeit richtet sich auf psychologische, psychopathologische und psychotherapeutische Themen. Er führte Forschungen zur ‚Gleichgeschlechtlichkeit’ und ‚sexuellen Differenzierung der Sexualkonstitution’ durch. Während seiner Tätigkeit im Institut bringt Kronfeld zwei Bücher heraus: ‚Das Wesen der psychiatrischen Erkenntnis’ (1920) und das Lehrbuch der ‚Psychotherapie’ (1924).
Dr. med. Friedrich Wertheim war Dermatologe. Er hat im Hirschfelds Institut 1919 eine Praxis für Geschlechtskrankheiten und eine Beratungsstelle für ehemalige Geschlechtskranke eröffnet. Wertheims Blut- und Spermauntersuchungen werden notwendig, u.a. zur Feststellung von Vaterschaften in Ehescheidungsprozessen. 1921 verlässt Wertheim das Institut.[10]
3.1.2 Personen im Institut, Ehe- und Sexualberater
Dr. med. Max Hodann (1894-1946) ist Eugeniker und Ehe- und Sexualberater im Hirschfelds Institut. Dort arbeitete er von 1926 bis 1929. Er leitet die Sexualberatungsstelle als ‚Eugenische Abteilung für Mutter und Kind’ und veranstaltet öffentliche Frageabende zur Sexualaufklärung. Hodann war Mitglied im Verein sozialistischer Ärzte und im Reichsverband für Geburtenregelung und Sexualhygiene. Er wurde 1933 verhaftet und ohne Verfahren einige Zeit lang inhaftiert. Im englischen Exil bemühte er sich um die Wiedererrichtung eines Instituts.[11]
3.1.3 Personen im Institut, Sexualreformer
Dr. jur. Kurt Hiller (1885 – 1972) war Sexualreformer, Jurist und Schriftsteller. Hiller kam 1908, nach der Veröffentlichung seiner juristischen Dissertation ‚Das Recht über sich selbst’ durch Vermittlung Kronfelds mit Hirschfeld in Kontakt. Er trat dem Wissenschaftlich-humanitären Komitee bei, dem er bis zu dessen Ende angehörte. Im November 1929 wird Hiller zum zweiten Vorsitzenden gewählt als Magnus Hirschfeld zurücktritt.
Neben seinem Einsatz für die Rechte der Homosexuellen war Hiller in den zwanziger Jahren ein bekannter Vorkämpfer des Pazifismus. 1933 wurde er dreimal verhaftet und im Columbiahaus und später in den Konzentrationslagern Brandenburg und Sachsenhausen interniert. Es gelang ihm, nach seiner Entlassung aus dem Konzentrationslager 1934 erst nach Prag und 1938 nach London zu fliehen. Von dort kehrte er 1955 nach Hamburg zurück, wo er 1962 versuchte, das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee neu zu gründen. Er blieb dabei aber isoliert.
Dr. phil. Helene Stöcker (1869 - 1943) war ebenso als Sexualreformerin tätig . Stöcker war Philosophin, Publizistin und Frauenrechtlerin. Sie war die Organisatorin des sog. radikalen Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung. Sie propagierte eine ‚neue Ethik’ des Geschlechtslebens, deren Ausgangspunkte waren das Liebesideal der Deutschen. Stöcker engagierte sich im Kampf um das Frauenstudium und war 1896 eine der ersten Studentinnen an der Berliner Universität (Kunstgeschichte, Philosophie, Nationalökonomie). 1901 promovierte sie in Bern. Sie lebte als freie Publizistin in Berlin.
1905 war sie Mitbegründerin des ‚Bund für Mutterschutz’. Sie leitete den Bund bis zu dessen Ende 1933. Die Bekämpfung des Strafrechtsentwurfs von 1909, der die Strafbarkeit auch weiblicher Homosexualität vorsah, brachte sie in engeren Kontakt mit Hirschfeld und 1912 wurde sie Mitglied im Wissenschaftlich-humanitären Komitee. Als ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit war seit dem Ersten Weltkrieg der Kampf gegen Krieg und Militarismus hinzugekommen. Gleich nach dem Reichstagsbrand hatte Helene Stöcker Berlin verlassen. Sie ging zunächst in die Tschechoslowakei; von dort gelangte sie über die Schweiz, England, Schweden und die Sowjetunion in die USA.[12]
3.2 Ehetauglichkeit und Empfängnisverhütung
Die Patienten der Ehe- und Sexualberatung verteilten sich auf die drei großen Bereiche: Ehetauglichkeitsuntersuchungen, Eheprobleme (körperliche und seelische Unstimmigkeiten sowie Unfruchtbarkeit) und Trennungs- und Scheidungsprobleme. Im Zusammenhang der Beratung von Ehebewerbern wird erstmals erwähnt, dass es sich auch um Fragen der Empfängnisverhütung wegen schlechter Lebens- und Wohnverhältnisse handele. Geht es den Ärzten um die Gesundheit der Klientel und deren Nachkommenschaft, sind die Ratsuchenden vor allem an einfachen und billigen Verhütungsmethoden und -mitteln interessiert. Die Sexualberatung scheint sich sogar zu 90% auf Fragen der Empfängnisverhütung zu konzentrieren.[13]
4 Sexualaufklärung im Kaiserreich
Die Sexualmoral im Sinne eines Kulturgutes hat diverse Entwicklungen und Veränderungen aufzuweisen. In der Zeit vom Kaiserreich hatte man ein neues Menschenbild geschaffen und dieses hat bisherige Auffassungen in Frage gestellt. Neben Darwins Abstammungslehre wirkte sich besonders die Beschäftigung mit Sexualität durch die Wissenschaft aus. Es wurden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt und dabei wurden zwischen normaler und ‚nicht normaler’ Sexualität unterschieden. U.a. Sigmund Freud, aber auch viele andere hatten die Erfahrung von den sexuellen Faktoren bei psychischen Erkrankungen gemacht.[14]
4.1 Sexualität und neue soziale Aspekte
Die Sexualität als Problem blieb nicht nur bei den Individuen, sondern wurde auch auf der gesellschaftlichen Ebene bekannt. Darunter sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen: schnelle Urbanisierung und Bevölkerungszunahme in den Städten, die Bevölkerung wurde immer jünger, die Prostitution hatte rasch zugenommen und Homosexualität wurde bekannter. Daraus folgende Geschlechtskrankheiten wurden im Kaiserreich mit ihren Folgen auch ein soziales Problem.[15]
Die Sexualität darf nicht als universelles Gesetz betrachtet werden. Die Sexualität sollte vielmehr als ein Produkt der historischen Entwicklung zu betrachten sein. Im folgenden wird mit einigen Beispielen erläutert, wie die Aufklärung in Deutschland in den 20er Jahren durchgeführt wurde.[16]
4.2 Aufklärung in den Medien
Magnus Hirschfeld und das Institut für Sexualwissenschaft besitzen in der Weimarer Republik einen überaus hohen Bekanntheitsgrad, der vor allem auf die populäre Verbreitung von sexualwissenschaftlichem Wissen beruht. Neben diversen Aufklärungsvorträgen durch die Mitarbeiter des Instituts im In- und Ausland bedient sich das Institut schon früh der Licht- und Laufbildtechnik für seine Aufklärungsarbeit.[17]
4.2.1 Filme
Der bekannteste unter Hirschfelds Mitwirkung entstandene Film ist ‚Anders als die Anderen’ (1919). Seine Vorführung ist vielerorts Anlass zu Protesten gewesen. Mit der Wiedereinführung der Filmzensur im Mai 1920 wird der Film nur noch zur Vorführung zu wissenschaftlichen Zwecken und in geschlossenen Veranstaltungen zugelassen. ‚Anders als die Anderen’ ist nur noch teilweise erhalten. Ebenso ist der Film ‚Gesetze der Liebe - Aus der Mappe eines Sexualforschers’ (Humboldt-Film, 1927) nur noch teilweise erhalten; dieser Film ist durch die Schnittauflagen der Prüfstellen völlig verstümmelt worden. Hirschfeld nennt in der Geschlechtskunde weitere Filme, an denen er mitgewirkt hat, die aber völlig verschollen sind: ‚Die Prostitution’ (Oswald-Film), ‚Das Recht auf Liebe’, ‚Vererbte Triebe’ und ‚Mann oder Weib’.
4.2.2 Publikationen
In der seit 1905 erscheinenden sexualwissenschaftlichen Zeitschrift ‚Geschlecht und Gesellschaft’, die ab 1920 durch den Institutsmitarbeiter Freiherr von Reitzenstein herausgegeben wird, wird das Beiblatt ‚Sexualreform’ zum offiziellen Mitteilungsblatt des Instituts. Die ‚Mitteilungen des Wissenschaftlich-humanitären Komitees’ werden zwar im Institut herausgegeben; erreicht werden jedoch nur die Vereinsmitglieder.
Nachdem ab 1927 eine größere Zahl von Zeitschriften zu sexuellen Themen erscheinen (die aber immer wieder von der Zensur bedroht werden), gründet auch Hirschfeld zusammen mit Maria Krische Anfang 1929 eine eigene populärwissenschaftliche Zeitschrift mit dem Titel ‚Die Aufklärung’. Durch Hirschfelds Kontakte zum Neuen Deutschen Verlag wurde es ermöglicht in Arbeiter-Illustrierten und in der kommunistischen Presse auch Artikel über Sexualität zu veröffentlichen.[18]
5 Sexualreform
Auf die bedrohlich empfundene Proletarisierung und Verarmung breiter Bevölkerungsschichten durch die rasante Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts reagieren vor allem Kleinbürgertum und Mittelschichten mit Reformbestrebungen. Im Gegensatz zur organisierten Arbeiterschaft, die für eine Änderung der Produktionsverhältnisse kämpft, versuchen sie die soziale Not durch Veränderungen in der Lebenswelt zu beheben. Die eher links liberalen Sexualreformbewegungen versuchen soziale Notlagen in der Bevölkerung durch eine Reform des Ehe- und Sexualstrafrechts zu beheben.
Unter den Reformern befinden sich viele Ärzte aus Arbeiterwohnvierteln, die in ihren Praxen mit ungewollten Schwangerschaften und Kinderreichtum von Arbeiterfrauen konfrontiert sind. Die Sexualreformbewegungen setzen sich in ihrem Kampf um die ‚Sexualnöte’ für deren wissenschaftliche Erforschung ein, um Vorurteilen und tradierten Werten mit wissenschaftlichen Argumenten entgegen treten zu können.[19] Hirschfeld dankt 1924 anlässlich der staatlichen Anerkennung seiner Stiftung zur Förderung der Sexualforschung den Sexualreformbewegungen.[20]
5.1 § 175 im Reichstrafgesetzbuch
Mit der Reichseinigung 1871 trat der § 175 RStGB in Kraft. Als strafbar galten auf Reichsebene bald nur ‚ beischlafsähnliche Handlungen’.
In der bürgerlichen Ideologie der Sexualität galten Homosexuelle als Kranke und Kriminelle. Homosexualität stand bereits seit 1871 unter Strafe.[21] In der Weimarer Republik wurden Homosexuellen erstmals grundlegende bürgerliche Rechte zugestanden. Die Rechte wurden auch eifrig in Kauf genommen; die Zahl der diversen Vereinen sowie der homosexuellen Zeitschriften, Kneipen und Bars war in kürzester Zeit enorm gestiegen.[22]
Das ‚Wissenschaftlich-humanitäre Komitee’ ist die erste Organisation von homosexuellen Männern und Frauen. Das WhK kämpft für die Abschaffung des § 175 RStGB, der beischlafähnliche Handlungen zwischen zwei Männern unter Strafe stellt, hilft Angeklagten bei Strafprozessen und setzt sich für die gesellschaftliche Anerkennung von homosexuellen Männern und Frauen ein. Um die Reform des § 175 RStGB durchzusetzen, sammelte das Komitee Hirschfelds ab 1897 Unterschriften von Prominenten. Bekannt wurde diese Aktion auch durch Hirschfelds ‚Jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen’; diese ist eine Studiensammlung zu Fragen aus allen Bereichen der Homosexualität.[23]
Zusammen mit der ‚Abteilung für Sexualreform’ des Instituts setzt das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee in seinem Kampf für eine Strafrechtsreform auf den wissenschaftlichen Nachweis, dass Homosexualität eine Anlage der Natur ist.
Die Schwierigkeit des Wissenschaftlich-humanitären Komitees, eine Organisation für Homosexuelle aufzubauen, bestand vor allem darin, dass Homosexualität innerhalb der Gesellschaft mit einem Tabu belegt war und somit Homosexuelle kaum bereit waren, in einer Organisation mitzuarbeiten, die aufklärerische Arbeiten durchführte. Die Angst vor der gesellschaftlichen Diskriminierung ließ viele von Engagement fernbleiben.[24]
1929 wird im Reichstagssausschuss mit den Stimmen der SPD, KPD, DPD, DDP und des Ausschussvorsitzenden Kahl (DVP) die Abschaffung des Homosexuellenparagraphen beschlossen. Der Ausschussbeschluss kommt bis zum Machtantritt der NSDAP nicht mehr zur Abstimmung im Reichstag.[25]
5.2 Homosexualität und Familienpolitische Maßnahmen
Die um die Jahrhundertwende entstandene Sexualwissenschaft strebte in ihren Forderungen vor allem nach einem Mutterschutzgesetz, der Liberalisierung des Eherechts sowie die Aufhebung des Homosexuellen-Paragraphen. Auch wenn es der Reformbewegung Ende der 20er Jahre nicht gelang, den § 175 RStGB abzuschaffen, so konnte sie wenigstens eine Verschärfung dieses Paragraphen verhindern; den Forderungen der NSDAP wurde damit nicht entsprochen.
Als die Nationalsozialisten im Januar 1933 die Macht ergriffen, begann für die deutschen Homosexuellen eine Epoche, die sie wenige Jahre später in ihrer Emanzipation um Jahrhunderte zurückwerfen sollte. Die nationalsozialistische Ideologie betrachtete die Homosexualität vor allem im bevölkerungspolitischen Zusammenhang. Bevölkerungs- und familienpolitische Maßnahmen sollten die Menschenproduktion und ihren sozialen Rahmen sichern. So muss die Neufassung des § 175 RStGB im Kontext von großzügig gewährten Ehestandsdarlehen und Kindergeld und einer verschärften Anwendung des § 218 StGB, der die Abtreibung unter Strafe stellte, gesehen werden.[26]
6 Magnus Hirschfeld zum Feindbild
Vor dem Hintergrund sozialer Verunsicherungen angesichts von Wirtschaftskrisen, Inflation und Massenarbeitslosigkeit in der Weimarer Republik, kommt es am Ende der 20er Jahre zu einer gesellschaftlichen Polarisierung zwischen weltanschaulichen Gegnern und Stigmatisierungen von Bevölkerungsgruppen, ohne dass es gelingt, einen tragfähigen, demokratischen Konsens zu finden. Die politischen Auseinandersetzungen erfolgen radikaler und erbitterter, nicht zuletzt auch im Hinblick auf Sozial- und Sexualreformen. Neben den anhaltend christlich-konservativen Bestrebungen gegen die aufklärerisch wirksam werdenden Sexualreformer führen zunehmend auch nationalsozialistische Eiferer im Namen eines ‚gesunden Volksempfindens’ Angriffe und gewinnen dabei an öffentlicher Zustimmung. Ihr radikaler Kampf richtet sich zunächst gegen sozialistische Sozialreformer, international sich organisierende und kommunistische Verbände. Der Sexualreformer Hirschfeld verkörpert als Jude und Sozialist, wie als vermögender Institutsunternehmer, ein dafür beispielhaftes Feindbild. Nicht nur dem ‚jüdischen Sittenverderber’, auch seiner Homosexualität gelten die zunehmenden öffentlichen Angriffe. Hirschfeld wird sogar als ‚öffentlicher Gefahr’ bezeichnet.
Deutlich mehren sich in der Presse unter dem wachsenden Einfluss nationalsozialistischer Meinungsbildung böswillige Verleumdungen, persönliche Angriffe und bedrohliche Warnungen, die sich nicht zuletzt auch gegen das Institut für Sexualwissenschaft richten.
Der wachsende Verruf, in den Hirschfelds Institut am Ende der 20er Jahre gerät, ist bis dato noch nicht aufgearbeitet. Nur auszugsweise und beispielhaft können nachfolgende Dokumente Aspekte einer Meinungsbildung verdeutlichen von den Ansätzen einer Stigmatisierung, bis hin zum Hass, Verleumdungen, aggressiven Kampagnen und persönlichen Angriffen.[27]
1931 macht Hirschfeld eine Weltreise durch Nordamerika, Asien und den Orient. 1932 kehrt er zurück nach Wien; in dem selben Jahr geht er nach Ascona ins Exil. 1933 wird das Berliner Institut zerstört und geschlossen. Danach versucht Hirschfeld in Paris ein neues Institut zu gründen. Magnus Hirschfeld stirbt an seinem 67. Geburtstag 1935 in Nizza.[28]
7 Schlussbetrachtung
Sexualität stellt eine der Grundlagen des menschlichen Verhaltens dar und kann als ein Wert betrachtet werden. Wir müssen uns der Relativität solcher Werte bewusst sein, um zu Verstehen, wie es überhaupt zu einer Verbindung mit den Nationalismus kommen konnte. Es darf nicht als universelles Gesetz betrachtet werden, wenn irgendetwas als normal oder nicht normal angesehen wird; dies gilt als Produkt der historischen Entwicklung.
Die Zusammenhänge zwischen Nationalismus und bürgerlicher Moral zu finden, bedeutet zugleich, die Entwicklung einiger der wichtigsten Normen zu verfolgen, die unsere Gesellschaft sehr geprägt haben. Unter den Normen ist einerseits das Ideal der Männlichkeit zu verstehen und auf der anderen Seite die Stellung der Frau; die Stellung der angepassten, die diese Normen akzeptieren (müssen). Mit der Idealisierung der Männlichkeit ging zugleich die Idealisierung der Frau einher. Die Frau ist als Hüterin der Moral und der öffentlichen wie privaten Ordnung zu betrachten; dem Mann ist in der Familie Ordnung und Ruhe zu halten. Diese Untersuchungen und Forschungen der bzw. über die Sexualität kann ein Beitrag zum Verständnis sein, wie es überhaupt zu der heutigen Situation gekommen ist und wie wir uns verändert haben bzw. verändern werden.
Hirschfelds Institut mit seinen Sexualreformern hat in den 20er Jahren insgesamt eine grundlegende Arbeit geleistet; durch die Aufklärung wurde es der Bevölkerung ermöglicht, Information über das bisher verschwiegene Thema zu bekommen. Die Menschheit hat einen Punkt erreicht, an dem einer der relevantesten Elemente des Lebens, die Sexualität, klar gestellt wurde. Für die Bevölkerung war eine Basis geschaffen worden, auf der jede weitere Entwicklung des Thema Sexualität leichter weiter behandelt und erforscht werden konnte.
8 Literaturverzeichnis
Bagel-Bohlan, Anja; Salewski, Michael: Sexualmoral und Zeitgeist im 19. und 20. Jahrhundert, 1. Auflage, Opladen 1990
Eder, Franz X.: Kultur der Begierde (Eine Geschichte der Sexualität), 1. Auflage, München 2002
Fröhlich; Kaufmann: Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1850-1950, 1. Auflage, Berlin 1984
Maiwald, Stefan; Mischler, Gerd: Sexualität unter dem Hakenkreuz, 1. Auflage, München 2002
Mosse, George L.: Nationalismus und Sexualität (Bürgerliche Moral und sexuelle Normen, 1. Auflage, München / Wien 1985
Internetquellen
http://www.eurotica24.net/liebeskrank/sprechstunde/thema/hirsch.htm, am 01. Mai 2003
http://www.mcfa.de/stattfahrt/homosexuelle.html, am 01. Mai 2003
http://www.gayforum.de/kultur/02665.shtml am 01. Mai 2003
http://www.hirschfeld.in-berlin.de/frame.html?http://www.hirschfeld.in-berlin.de/forderungen.html am 01. Mai 2003
http://www.hirschfeld.in-berlin.de/index.html am 01. Mai 2003
http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/index1024_ie.html am 01. Mai 2003
http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/ifsframe.html am 11. Juni 2003
9 Anlagen
Hirschfelds Rede 1924 für die staatliche Anerkennung seiner Stiftung:
‚ Aber nicht nur von der rein gegenständlichen Naturforschung gingen die Keime dieser neuen Wissenschaft aus, sondern fast in gleichem Maße von den sozialen Reformbewegungen, die sich in den neunziger Jahren unabhängig voneinander bildeten, um den Sexualnöten der Zeit entgegenzutreten. Um hier nur einige der in Frage kommenden Vereinigungen zu nennen, erinnere ich an die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten, an den Bund für Mutterschutz, der sich der unehelichen Mutter und des außerehelichen Kindes annahm, an das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee, das gegen die gesetzliche und gesellschaftliche Verfolgung gleichgeschlechtlich veranlagter Männer und Frauen Stellung nahm und kämpfte, an die abolitionistische Bewegung, die sich gegen die Prostituiertenkontrolle wandte. Zu ihnen gesellten sich später noch andere wichtige, vor allem die 1913 (...) gegründete Ärztliche Gesellschaft für Sexualwissenschaft und Eugenik sowie die erst vor einigen Jahren in diesem Institut errichtete Gesellschaft für Geschlechtskunde. ’
Quelle: http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/index1024_ie.html
Chronologie der Ereignisse 1933
30. 1.
Hindenburg ernennt Hitler zum neuen Reichskanzler:
singende Nazigruppen feiern ihren Triumph mit Fackelzügen
31. 1.
Der Institutsmitarbeiter Ewald Lausch bekennt sich im Institut als begeistertes Mitglied der NSDAP. Seit 1923 arbeitet er als Heilgehilfe in der radiologischen Abteilung. Nach dem Weggang Karl Gieses, der 1932 Hirschfeld ins Exil folgt, führt er Bibliothek und Archiv.
27. 2.
Reichstagsbrand:Nazi-Revolte, Massenverhaftungen politischer Gegner
5. 3.
Wahlen, keine Mehrheit der NSDAP
23. 3.
Zustimmung des Reichstags zum "Ermächtigungsgesetz", das Hitler eine Alleinherrschaft zugesteht: Berlin, ein Fahnenmeer mit Naziflaggen, Nazi-Patroullien auf den Straßen, ‚Ausländer’ wird zum Schimpfwort
29. 3.
Die Institutsmitarbeiter Lausch, Hauptstein und Röser berichten in einem Brief an Hirschfeld, der sich mit Karl Giese im Schweizer Exil aufhält, wohlwollend und beschwichtigend über Haussuchungen ‚in korrekter, sachlicher und höflicher Form’ durch Kripo und Hilfspolizei. Sie erwähnen in ihrer Gegendarstellung zu den ‚Hetznachrichten aus Deutschland’ allerdings auch Besuche ‚von scheinbar illegalen S.A.-Leuten’ im Institut, die nach Hirschfeld ‚in Parteiangelegenheiten’ fragten.
1. 4.
Nazi-Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte: SA-Terror
6. 5.
Plünderung des Instituts. Vormittags kommen etwa hundert Sportstudenten von der "Deutschen Studentenschaft" mit LKWs und Blasmusik, riegeln das Institut ab. Mit einem Trompetensignal beginnen sie die Bibliothek zu plündern und verladen die Buchbestände. Die anschließende Kundgebung vor dem Institut findet mit einem dreifachen 'Sieg Heil' auf den Reichskanzler Adolf Hitler und dem Gesang des Liedes 'Burschen heraus' ihren Abschluss.
Nachmittags kommt ein SA-Trupp, um die verbliebenen Archivbestände zu konfiszieren. Die beschlagnahmten Buch- und Archivbestände werden ‚e iner genauen Sichtung durch Sachverständige unterzogen, damit nicht Werke vernichtet werden, die für die medizinische Wissenschaft einen hohen Wert besitzen (...) Auch das Bildarchiv des Instituts, in dem Hunderte von Diapositiven lagerten, wurde einer eingehenden Untersuchung unterzogen und alles Undeutsche vernichtet...’, teilt die Zeitung ‚Germania’ der katholischen Zentrumspartei tags darauf ihren Lesern mit.
10. 5.
Spektakuläre Bücherverbrennung auf dem Opernplatz: Bereits auf dem Fackelzug zum Scheiterhaufen trägt ein Student eine auf einen Stock aufgespießte Büste Hirschfelds. Dessen Schriften werden wie die vieler anderer verfemter Autoren anschließend in die Flammen geworfen.
14. 6.
Offizielle Schließung des Instituts durch den Berliner Polizeipräsidenten von Levetzow, ‚da eine Weiterführung des Betriebes die öffentliche Ruhe und Ordnung erheblich gefährdet hätte’. ‚ Aufgrund des § 14 Polizeiverwaltungsgesetz und des § 1 der Verordnung vom 28.2.33 wird das Grundstück entschädigungslos beschlagnahmt.’ Von Levetzow legt dem Innenminister nahe, der Stiftung den Status der Gemeinnützigkeit abzuerkennen, um bisherige Steuerermäßigungen als unrechtmäßig nachträglich einfordern zu können. Ein Verwalter soll mit der Finanzprüfung und Abwicklung beauftragt werden. Er schlägt vor, Vermögen und Stiftung einer Universität oder "hygienischen Zwecken" zuzuführen.
Acht Angestellte sind bis dato noch im Institut tätig, deren Gehälter rückständig sind. Der Dermatologe Bernhard Schapiro verlegt seine Praxis und fordert seine Einrichtungsgegenstände zurück. (Er emigriert noch 1933.)
Bis 1934 wohnen u.a. noch Hirschfelds Schwester, Recha Tobias, und auch die ehemalige Empfangsdame, Helene Helling, im Institutsgebäude.
Die Finanzbehörde fordert nach Aberkennung der Gemeinnützigkeit mehr als 100 000 Reichsmark nachträglich für Körperschafts- und Umsatzsteuer.
Nov.
Das Berliner Finanzamt veranstaltet eine Versteigerung von Gegenständen ‚ aus dem Besitz des bekannten Sexualforschers Dr. Magnus Hirschfeld, unter anderem eine 3000 Bände umfassende wissenschaftliche und schöngeistige Bibliothek, ferner ärztliche Apparate, Instrumente, Möbel usw. ’, berichtet das Wiener Neue Journal.
1933/34
Zwangsverwaltung der ‚Hirschfeld-Stiftung’ durch die ‚Fundament Treuhand A.G.’ Vermietung der Institutsräume an antikommunistische und antijüdische Institutionen, u.a. Gesamtverband deutscher antikommunistischer Vereinigungen, Bund Nationalsozialistischer Juristen, Institut zum Studium der Judenfrage, Nibelungen-Verlag
Quelle: http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/index1024_ie.html
[...]
[1] Vgl. http://www.eurotica24.net/liebeskrank/sprechstunde/thema/hirsch.htm
[2] Vgl. http://www.gayforum.de/kultur/02665.shtml
[3] Vgl. http://www.gayforum.de/kultur/02665.shtml
[4] Vgl. http://www.eurotica24.net/liebeskrank/sprechstunde/thema/hirsch.htm
[5] Vgl. http://www.mcfa.de/stattfahrt/homosexuelle.html
[6] Vgl. http://www.eurotica24.net/liebeskrank/sprechstunde/thema/hirsch.htm
[7] Vgl. http://www.hirschfeld.in-berlin.de/frame.html?http://www.hirschfeld.in-berlin.de/forderungen.html
[8] Vgl. http://www.hirschfeld.in-berlin.de/index.html
[9] Vgl. http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/index1024_ie.html
[10] Vgl. http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/ifsframe.html
[11] Vgl. http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/ifsframe.html
[12] Vgl. http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/ifsframe.html
[13] Vgl. http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/index1024_ie.html
[14] Vgl. Anja Bagel-Bohlan & Michael Salewski: Sexualmoral und Zeitgeist im 19. und 20. Jahrhundert, Seite 71 ff.
[15] Vgl. Anja Bagel-Bohlan & Michael Salewski: Sexualmoral und Zeitgeist im 19. und 20. Jahrhundert, Seite 73 ff.
[16] Vgl. Mosse, George L.: Nationalismus und Sexualität, Seite 9 ff.
[17] Vgl. http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/index1024_ie.html
[18] Vgl. http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/index1024_ie.html
[19] Vgl. http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/index1024_ie.html
[20] Siehe Anlage (Hirschfelds Rede 1924 für die staatliche Anerkennung seiner Stiftung
[21] Vgl. Stefan Maiwald & Gerd Mischler: ‚Sexualität unter dem Hakenkreuz’, Seite 172
[22] Vgl. http://www.gayforum.de/kultur/02665.shtml
[23] Vgl. Eder, Franz X.: ‚Kultur der Begierde’, Seite 193 ff.
[24] Vgl. Fröhlich; Kaufmann: ‚Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1850-1950, Seite 18
[25] Vgl. http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/index1024_ie.html
[26] Vgl. http://www.mcfa.de/stattfahrt/homosexuelle.html
[27] Vgl. http://www.hirschfeld.in-berlin.de/institut/de/index1024_ie.html
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments über Sexualwissenschaften?
Dieses Dokument ist eine umfassende Vorschau auf die Sexualwissenschaften vor 1933, insbesondere im Kontext von Magnus Hirschfeld und seinem Berliner Institut für Sexualwissenschaft. Es behandelt die Geschichte, die Grundlagen des Instituts, Sexualaufklärung, Sexualreform, die Rolle von Magnus Hirschfeld als Feindbild und die Verfolgung des Instituts durch die Nationalsozialisten. Ebenfalls werden bedeutende Personen, die mit dem Institut in Verbindung standen, sowie wichtige Themen wie Homosexualität, Eheberatung und Empfängnisverhütung behandelt. Das Dokument enthält auch ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen, Schlüsselwörter, Schlussbetrachtungen und ein Literaturverzeichnis.
Wer war Magnus Hirschfeld?
Magnus Hirschfeld war ein deutscher Sexologe und Pionier der Sexualwissenschaften. Er gründete das Institut für Sexualwissenschaft in Berlin und setzte sich für die Rechte von Homosexuellen ein. Seine Forschungen im Bereich Sexualität leisteten einen bemerkenswerten Beitrag zur Entwicklung der Sexualwissenschaften.
Was war das Institut für Sexualwissenschaft in Berlin?
Das Institut für Sexualwissenschaft war das weltweit erste Institut seiner Art, gegründet 1919 von Magnus Hirschfeld. Es war ein Zentrum für Forschung, Beratung und Aufklärung im Bereich Sexualität. Es diente auch als Anlaufstelle für sexuelle Minderheiten, insbesondere Homosexuelle, Transvestiten und Transsexuelle.
Welche Themen wurden im Institut behandelt?
Im Institut wurden verschiedene Themen behandelt, darunter Ehe- und Sexualberatung, Ehetauglichkeitsuntersuchungen, Empfängnisverhütung, Homosexualität, Transsexualität, Geschlechtskrankheiten und Sexualaufklärung.
Wer waren einige der wichtigen Personen, die mit dem Institut verbunden waren?
Zu den wichtigen Personen gehörten Dr. med. et phil. Arthur Kronfeld und Dr. med. Friedrich Wertheim (Mitbegründer), Dr. med. Max Hodann (Eugeniker und Ehe- und Sexualberater), Dr. jur. Kurt Hiller (Sexualreformer) und Dr. phil. Helene Stöcker (Sexualreformerin und Frauenrechtlerin).
Was war der § 175 im Reichstrafgesetzbuch?
Der § 175 RStGB war ein Paragraph im deutschen Strafgesetzbuch, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte. Magnus Hirschfeld und das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee setzten sich für die Abschaffung dieses Paragraphen ein.
Was geschah mit dem Institut für Sexualwissenschaft unter den Nationalsozialisten?
1933 wurde das Institut von den Nationalsozialisten zerstört und geschlossen. Die über 12.000 Schriften von Magnus Hirschfeld wurden öffentlich verbrannt. Hirschfeld selbst musste ins Exil gehen.
Welche Rolle spielte die Sexualaufklärung im Kaiserreich und in der Weimarer Republik?
Die Sexualaufklärung gewann im Kaiserreich und in der Weimarer Republik an Bedeutung. Es gab eine wachsende Auseinandersetzung mit Sexualität in den Medien und in der Wissenschaft. Magnus Hirschfeld und das Institut für Sexualwissenschaft spielten eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von sexualwissenschaftlichem Wissen.
Was sind einige der Schlüsselbegriffe, die im Dokument behandelt werden?
Zu den Schlüsselbegriffen gehören Sexualwissenschaft, Eugenik, Sexualreform, Homosexualität, Eheberatung, Empfängnisverhütung, § 175 RStGB, Nationalsozialismus, Magnus Hirschfeld und Institut für Sexualwissenschaft.
Was war das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK)?
Das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee war die erste Organisation von homosexuellen Männern und Frauen. Es kämpfte für die Abschaffung des § 175 RStGB und für die gesellschaftliche Anerkennung von Homosexuellen.
- Citar trabajo
- Salla Luoma (Autor), 2003, Sexualwisseschaften bis 1933: Magnus Hirschfeld und sein Berliner Institut für Sexualforschung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108137