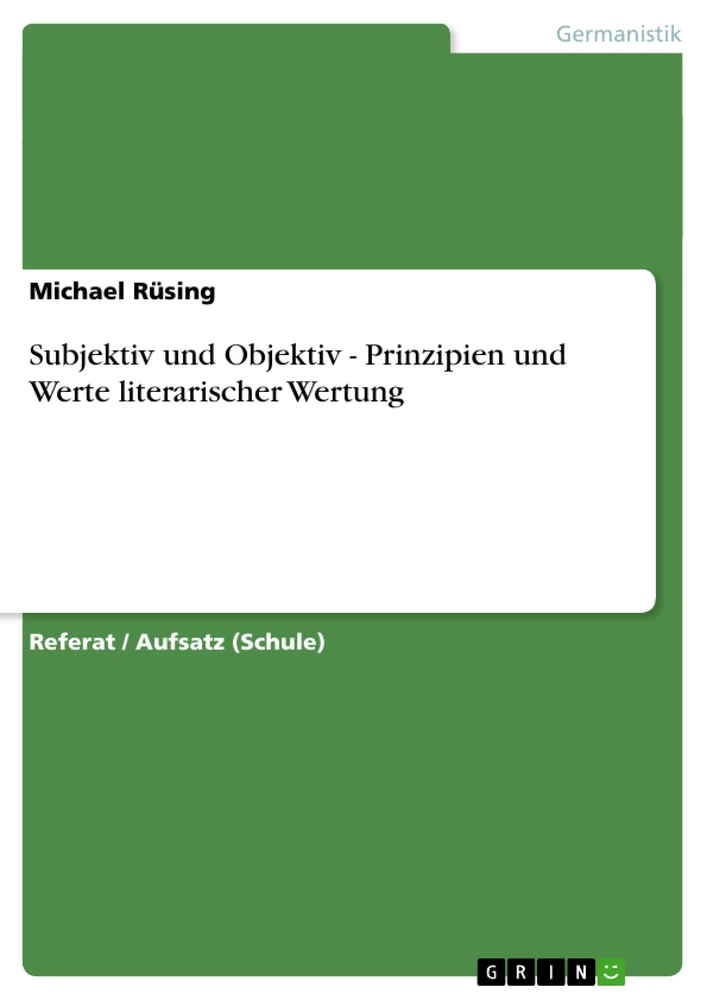Was macht ein Werk zur unsterblichen Literatur? Tauchen Sie ein in eine faszinierende Analyse der Literaturkritik, die von den antiken Wurzeln bis zu den modernen Debatten reicht. Dieses Buch seziert die Entwicklung literarischer Werturteile, entlarvt die subjektiven und objektiven Kräfte, die unsere Wahrnehmung von "guter" Literatur prägen, und wirft die alles entscheidende Frage auf: Gibt es überhaupt universelle Kriterien für literarische Exzellenz? Entdecken Sie, wie sich die Kriterien im Laufe der Epochen wandelten, von den dogmatischen Regeln der Aufklärung bis zur subjektiven Genialitätsverehrung des Sturm und Drang. Ergründen Sie die komplexen Beziehungen zwischen Autor, Text und Leser, und verstehen Sie, wie Sprache, Symbolik und Gattung die literarische Wertung beeinflussen. Anhand von Roman- und Lyrikkritik werden konkrete Bewertungskriterien wie Leserbeteiligung, emotionale Wirkung und die Verbindung von Wahrheit und Schönheit beleuchtet. Das Buch enthüllt die verschiedenen Formen der Rezension, von der prägnanten Kurzrezension bis zur umfassenden Sammelrezension, und analysiert, wie diese unsere Leseerfahrungen formen. Eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Urteilsprozess, das die Kunstwerke entweder in den Kanon erhebt oder in der Bedeutungslosigkeit versinken lässt. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Literatur begeistern, sich in der Welt der Bücher orientieren und verstehen wollen, wie literarische Werke ihren Wert erhalten – oder verlieren. Eine kluge Untersuchung, die den Leser dazu anregt, seine eigenen Bewertungsmaßstäbe zu hinterfragen und die Vielschichtigkeit literarischer Erfahrungen neu zu entdecken, fernab von festen Regeln und Normen, hin zu einer persönlichen und differenzierten Auseinandersetzung mit der Welt der Literatur. Ein Leitfaden, um die eigenen Sinne für das zu schärfen, worauf es bei herausragender Literatur wirklich ankommt, und um ein tieferes Verständnis für die subjektiven und objektiven Kräfte zu entwickeln, die unsere Leseerfahrungen prägen, während die Frage im Raum steht: Was macht ein literarisches Werk wirklich wertvoll und wie beeinflussen Rezensionen unsere Wahrnehmung?
Überblick
I. Einleitung
II. Geschichte der Literaturkritik
III. Das literarische Werturteil
IV. Kriterien literarischer Wertung
V. Die Literarische Rezension
VI. Fazit
I. Einleitung
" Ich forderte einen Maßstab des Urteils, und glaubte gewahr zu werden, daß ihn gar niemand besitze." (Kienecker 1989, 9)
Dieser Ausspruch Goethes beschreibt die von vielen geteilte Auffassung, dass man für die Beurteilung von literarischen Werken überhaupt keine verbindlichen Grundsätze festlegen könne. Literaturkritiker streiten seit jeher darüber, welche Kriterien bei literarischen Wertungen anzuwenden sind. Es ist eine außerordentlich große Zahl an Wertungsstandpunkten vorhanden, die manchmal sehr verwirrend für den Literaturinteressierten sein kann. Trotzdem haben sich Kriterien für die literarische Wertung herauskristallisiert, die aufgrund ihrer in Rezensionen auftretenden Häufigkeit als wichtig und gültig angesehen werden können. Ich möchte in diesem Referat veranschaulichen, wie sich die Auffassung von literarischer Wertung durch die verschiedenen Epochen hindurch verändert hat und welche Kriterien heute am häufigsten in der Literaturkritik zu Rate gezogen werden. Außerdem möchte ich darstellen, inwieweit man von Objektivität und inwieweit von Subjektivität bei literarischen Werturteilen sprechen kann. Desweiteren werde ich einen Einblick in die verschiedenen Formen von Rezensionen geben.
II. Geschichte der Literaturkritik
Seit der Antike bis hin zur Renaissance und Barock war man der Meinung, mithilfe von allgemeingültigen und objektiven Maßstäben bestimmen zu können was gute Dichtung sei (Degenhardt 1985, 149). Die Entstehung einer instutionalisierten Literaturkritik, die ständig die literarische Produktion begleitet, fand zu Beginn des 18. Jahrhunderts statt (Kienecker 1989, 12). In früherer Zeit wurde die Begründbarkeit von Poetiken (Kritiken) durch Berufung auf Autoritäten (vor allem Aristoteles) vorgenommen, wohingegen in der Zeit der Aufklärung die Vernunft als Instanz der Begründung von Regeln für die literarische Wertung bemüht wurde (Kienecker 1989, 13). Diese Regeln wurden als allgemeingültige Naturgesetze gedeutet, die eine allgemeingültige Bewertung von Literatur möglich machen sollten. Dies führte zu geringen Möglichkeiten der Veränderung von literarischen Formen, da Literatur, die gegen die 'naturgesetzlichen Regeln' verstieß, notwendig abgewertet wurde (Kienecker 1989, 15). Neue Kunstwerke, die zwar gegen die 'Regeln der Kunst' verstießen, jedoch großen Eindruck machten, warfen die Frage nach der Legitimation der aufklärerischen Normen für literarische Wertung auf. Deshalb kam eine neuartige Sichtweise auf, nämlich die, dass zuerst die eigene Empfindung befragt werden müsse. Danach wird der literarische Gegenstand analysiert und zum Schluss werden die Gründe aufgezählt, die zur positiven Empfindung geführt haben (Kienecker 1989, 15). Somit war der "ästhetische Dogmatismus" (Kienecker 1989, 16) der Aufklärung überwunden - jetzt drohte allerdings eine außerordentliche Subjektivierung der Kritik und Wertung durch Kritiker des Sturm und Drang, welche nur noch auf die Genialität des Dichters schauten ohne ihre Urteile aus der Beschaffenheit des Textes zu begründen. In der Romantik konnten dann beide Extreme, das der aufklärerischen Regelkritik und das der Subjektivität des Sturm und Drang überwunden werden (Kienecker 1989, 19). Die Idee der romantischen Kritik war es, die Intention eines Stückes zu erkennen und es an ihrem eigenen Anspruch zu messen (Kienecker 1989, 18). Entgegen dem romantischen Verständnis hatte das Junge Deutschland eine veränderte Konzeption (Kienecker 1989, 19). Literaturkritik sollte auch Zeitkritik sein, das heißt die Kritik sollte darauf achten, ob Literatur den 'Zeitgeist' adäquat zur Sprache bringt (Kienecker 1989, 19). Der Anfang der 1920er Jahre wird allgemein als Anfangspunkt der Wertungsdiskussion gesehen. Die Literaturwissenschaft wollte zu einer Objektivität der literarischen Wertung gelangen, welche durch zwingende Grundsätze der Bewertung zustande kommen soll (Kienecker 1989, 21). Bis heute gibt es einen Streit darüber, welche Kriterien bei der literarischen Wertung herangezogen werden sollten und ob es Kriterien gibt, die allgemeingültig sind.
III. Das literarische Werturteil
"Jedes literarische Urteil ist subjektiv und objektiv bestimmt" (Degenhardt 1985, 42).
Dieses Zitat von Leonhard Beriger deutet an, dass der langandauernde Streit, ob Literaturkritik nun objektiv oder subjektiv ist bzw. sein soll, vielleicht die Lösung in einem Mittelweg hat. Zunächst einmal geht Beriger davon aus, dass die Persönlichkeit des Kritikers für die partielle Subjektivität des Urteils verantwortlich ist (Degenhardt 1985, 42). Norbert Mecklenburg zählt dazu auch den Standort, den Horizont und die Perspektive des Rezensenten (Degenhardt 1985, 144). Der objektive Teil einer Rezension setzt sich aus Untersuchungen wie zu Sprache, Symbolik, Atmosphäre, Stoff, Form, Gattung etc. zusammen (Degenhardt 1985, 42).
Günter Waldmann hat folgende Vorstellung von literarischer Wertungsmöglichkeit für literarische Wertung. Für ihn ist ein Text ein Kommunikationssystem, welches auf einem bestimmten Kommunikationskanal eine kodierte Nachricht an den Empfänger, also den Leser sendet, welche dieser empfängt, indem er sie dekodiert (Degenhardt 1985, 115). Die Wertungsmöglichkeit für literarische Wertung ergibt sich für ihn aus dem Verhältnis des Empfängers zur Nachricht und Kodierung: Betrifft den Empfänger die Nachricht? Ist sie relevant oder irrelevant? Ist die Nachricht den Dekodierungsmöglichkeiten des Empfängers angemessen kodiert, also ist das Jargon für den Leser verständlich? Ist die Kodierung der zu übermittelnden Nachricht gemäß? (Degenhardt 1985, 115). Eine Untersuchung der Kodierung bedeutet für ihn, zu prüfen, ob das thematische Sujet dazu dienlich ist, die bestimmte (z.B. satirische, humoristische, idyllische, kritische usw.) Nachricht zu übermitteln und ob die gewählte Gattung dazu dienlich ist, die Nachricht zu übermitteln ( Degenhardt 1985, 117).
Es werden drei Arten von literarischen Werturteilen unterschieden, die sich aufgrund von verschiedenen Ausgangssituationen des Kritikers unterscheiden. Natürlich gibt es hierbei in der Praxis immer auch Überschneidungen. Die drei Arten von Werturteilen sind das Appetenz-, das Leistungs- und das Akzeptanzurteil.
Das Appetenzurteil hat seinen Ausgangspunkt im persönlichen Gefallen am beurteilten Text (subjektives Implikat) (Kienecker 1989, 72). Zumeist wird diese persönliche Empfindung durch Texteigenschaften erläutert (objektives Implikat), wodurch Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhoben wird (Kienecker 1989, 72).
Ein Leistungsurteil wird vergeben aufgrund eines für nachweisbar gehaltenen Tatbestand von Leistung oder Können des Autors (objektives Implikat) (Kienecker 1989, 74). Subjektiv wird das Urteil dadurch, dass Bewunderung oder Achtung für diese Leistung ausgesprochen wird. Ein nachweisbar gelungener Text muss dem Kritiker nicht zwingend gefallen, deshalb kann im Urteil gelobt werden, wie gekonnt der Text verfasst wurde und gleichzeitig gesagt werden, dass der Text dem Kritiker nicht sonderlich gefällt (Kienecker 1989, 74).
Das Akzeptanzurteil lobt einen Text aufgrund seiner herausragenden Stellung innerhalb seiner literarischen Gattung (Kienecker 1989, 76). Dabei werden allgemeine Kriterien benutzt (objektives implikat) und die eigene Akzeptanz ausgesprochen (subjektives Implikat) (Kienecker 1989, 76). Bei einem Akzeptanzurteil ist es durchaus möglich, dass dem Kritiker die Gattung, innerhalb welcher der beurteilte Text sehr gut ist, überhaupt nicht gefällt, und er sich nur von der Außerordentlichkeit des Textes innerhalb dieser Gattung beeindruckt zeigt.
IV. Kriterien literarischer Wertung
Wie schon zuvor angesprochen, gibt es unter Literaturwissenschaftlern eine Diskussion über die Kriterien von literarischer Wertung. Der Meinung, dass literarische Werturteile immer subjektiv-unbegründbar seien steht die Meinung derer gegenüber, dass es sehr wohl objektive Kriterien für ein literarisches Werturteil gebe (Kienecker 1989). Die unterschiedlichen Auffassungen von literarischer Wertung über die Jahrhunderte hinweg unterstreicht, dass sich die Menschen ziemlich uneins waren und sind, darüber, was gute Literatur ausmacht.
Wie dem auch sei, die Statistik zeigt, dass bestimmte Kriterien immer wieder zur literarischen Wertung herangezogen werden. Ich möchte nun einige dieser Kriterien am Beispiel der Roman- und der Lyrikkritik nennen.
Im Bereich der Romankritik werden literarische Werturteile oft anhand Kriterien wie des Lesers Teilnahme am Romangeschehen oder der Sympathie für den Helden gefällt (Kienecker 1989, 124). Außerdem wird oft bewertet aufgrund der Evokation von Erschütterung, Ergriffenheit und Rührung (Kienecker 1989, 124). Desweiteren kommt der positive Begriff der 'Spannung' häufig vor (Kienecker 1989, 124). Für die Romankritik gilt meist, dass der Text zwar erschüttern und bewegen soll, jedoch den Leser nicht in resignativer Stimmung entlassen (Kienecker 1989, 129). Ein positives Ende kommt bei den Romankritikern also in den meisten Fällen gut an.
In der Lyrikkritik gibt es ebenfalls Kriterien, die häufig zu einer literarische Wertung herangezogen werden. Für viele Kritiker spielt bei einem guten Gedicht die 'affektive Effizienz' eine große Rolle, also die gelungene Empfindungsauslösung beim Leser (Kienecker 1989, 147). Eine zu diesem Kriterium gehörende Aussage von Kritikern lautet beispielsweise "Der Leser wird in den Text hineingezogen" (Kienecker 1989, 147). Der spürbare Gefühlsausdruck des Dichters wird positiv bewertet (Kienecker 1989, 148). Ein weiteres Kriterium ist die geglückte Kombination von der Wahrheit der Aussage des Gedichtes und der Schönheit von Inhalt, und/oder Form und Sprache des lyrischen Textes (Kienecker 1989, 151). Wenn der Dichter auch in der Lage ist, die im Gedicht ausgedrückten Sachverhalte und inneren Zustände mit den perfekten Vokabeln zu versehen (Kienecker 1989, 161) , worauf es bei einem guten Gedicht ja hauptsächlich ankommt, ist seinem Gedicht eine positive Wertung gewiss.
V. Die Literarische Rezension
Eine 'Literarische Rezension' ist zunächst eine kritische Besprechung und Beurteilung eines literarischen Werkes, meist eines Buches. Das Wort Rezension kommt aus dem Lateinischen und bedeutet 'Musterung'. Die Rezension soll, wenn denn ein gutes Urteil gefällt wird, den Leser der Rezension zum Lesen des Buches anregen. Deshalb sind bibliographische Angaben, wie der Titel des Buches, außerdem Angaben zu Autor, Verlag, Erscheinungsort- und -Jahr, sowie Umfang und Preis wichtig (Schmalz). Beschreibende, analysierende sowie wertende Sätze vollziehen ein Zusammenspiel in einer Rezension. Der Leser der Rezension möchte über den Inhalt des Buches etwas erfahren, er möchte wissen, was die Aussage des Buches ist und wie gut diese Aussage beim Leser des Buches ankommt. Es ist Aufgabe einer Rezension, vor allem solche in Zeitungen, "Appetit" zur Lektüre des rezensierten Buches zu machen. Der Inhalt sollte grob wieder gegeben werden. Um spannende Handlungen im Buch nicht vorwegzunehmen, kann der Inhalt verkürzt dargestellt werden. Der Rezensent sollte die Aussage des Buches beschreiben und bewerten und natürlich sagen, wie gut diese Aussage schriftstellerisch "kodiert" wurde. Weiter soll der Leser der Rezension über den gekonnten oder auch nicht so gekonnten Gebrauch von Stilmitteln im Buch informiert werden. Wie schon in III. erläutert, sollte die Rezension Information über Sprache, Atmosphäre, Symbolik etc. enthalten. Bei Rezensionen, die in Zeitungen abgedruckt sind, ist eine Kaufempfehlung, sei sie denn berechtigt, üblich. Voraussetzung für eine gute Rezension ist, dass der Rezensent sich intensiv mit dem zu bewertenden literarischen Gegenstand befasst, was eine intensive Lektüre des zu bewertenden Buches sowie eventuell sekundärer themenverwandter Literatur beinhaltet. Er wird nicht umher kommen, das Buch zu interpretieren, um das Interpretierte danach zu beschreiben und zu bewerten. Wichtig ist auch, dass des Rezensenten Urteil über das bewertete Buch gut begründet ist, so dass sich der Leser ein besseres Bild machen kann.
Die Rezension ist als Textgattung sehr flexibel und frei gestaltbar (Schmalz). Ihre sprachliche Gestaltung hängt meist von den potentiellen Lesern der Rezension ab; eine Rezension für ein wissenschaftliches Magazin wird wahrscheinlich mehr Fachjargon enthalten als eine Buchrezension in der Tageszeitung. Der Text sollte jedoch immer flüssig und gut lesbar gestaltet werden (Schmalz).
Es gibt mehrere Arten von Rezensionen. Die erste, die ich ansprechen möchte, ist die Kurzrezension. Sie hat einen Umfang um die 30 Zeilen (Schmalz) und soll meistens für Literaturinteressierte einen kurzen Überblick über Inhalt, Aussage und darüber, ob ein Buch lesenswert sein könnte, bieten.
Die ausführliche Rezension weicht von der Kurzrezension im Umfang ab, sie kann mehrere Seiten umfassen (Schmalz). Meist geht sie intensiver auf Thema und Aussage des bewerteten Buches sowie objektive Textmerkmale ein.
Die Sammelrezension bespricht mehrere Bücher. Eine Möglichkeit hierfür ist das Erstellen von zum Beispiel thematischen Vergleichskategorien, anhand derer der Rezensent mehrere Bücher bespricht (Schmalz). Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird jedes Buch einzeln mithilfe der Vergleichskategorien präsentiert oder die Kategorien finden gleichzeitige Anwendung auf alle Bücher (Schmalz). Eine andere Art der Sammelrezension ist der sukzessive Vergleich. Bei diesem Verfahren wird jedes Buch zunächst einzeln bewertet und abschließend werden alle Bücher miteinander verglichen und bewertet (Schmalz).
VI. Fazit
Ist literarische Wertung nun von Wert oder nicht? Sind literarische Rezensionen wirklich nur subjektiv-unbegründbare und damit wertlose Urteile, wie manche behaupten? Ich denke nicht. Zunächst können Leistungs- und Akzeptanzurteile im Zweifelsfall für den Leser einer Rezension von größerem Wert sein als hauptsächlich subjektiv begründete. Doch warum gibt es diese Meinungsverschiedenheit über das literarische Werten? Erwarten wir vielleicht zu viel von einer Rezension? Manche erwarten von der literarischen Wertung, dass sie allgemeingültige Urteile fällt, nach festen Prinzipien, Regeln und Normen. Woher kommt dieser Wunsch? Warum soll es eigentlich verbindliche Kriterien geben, die sagen, was gute Kunst ist und was schlechte? Die literarische Wertung wird immer, zumindest zum Teil, subjektiv bleiben. Es ist eine subjektive Aussage, dass ein Dichter die besten Vokabeln verwendet, die er hätte verwenden können. Ob ein Text ein festgelegtes objektives Kriterium, sei es noch so richtig, erfüllt, wird auch subjektiv bewertet. Die Meinungen der Menschen werden immer außeinander gehen. Das Schöne an der literarischen Wertung ist doch, dass jeder Rezensent einen anderen Ansatz für die Rezension wählt, jedem ganz bestimmte Kriterien wichtig sind und jeder Kunst auf eine andere Weise liebt oder nicht liebt. Ein Verriss eines literarischen Werkes, genau wie ein überschwengliches Lob, sie muten beide extrem subjektiv an. Doch was kümmert uns das? Eine Rezension kann nicht für uns entscheiden, ob ein literarisches Werk nun lesenswert ist oder nicht. Wir können nicht von literarischer Wertung erwarten, dass sie uns sagt, was gute Literatur und was schlechte Literatur ist. Nein, wenn literarische Wertung gut ist, dann ist sie kein Richter über Literatur, sondern ein Sachverständiger, der unsere Sinne im besten Fall für das schärft, worauf es bei guter Literatur ankommt. Wenn literarische Wertung gut ist, dann spielen Objektivität und Subjektivität in ihr so gut zusammen, dass ein jeder Leser eines Buches genau weiß, was für ihn selbst gute Literatur ist.
Literarische Rezension
zu: "Novelle" von Goethe
Titel des Buches: Novelle / Das Märchen
erschienen: Ditzingen: Reclam, 1997.
ISBN 3-15-007621-8
Das Lesen eines literarischen Werkes von Johann Wolfgang von Goethe setzt einige Dinge voraus. Zunächst muss man sich mental darauf vorbereiten, dass alles was man an zeitgenössischer Literatur bisher gelesen hat, nicht im Entferntesten mit dem zu vergleichen ist, was Goethe aufs Papier bringt. Man bringt eine gehörige Portion Respekt mit vor dem Werk dieses "Genies", welches Goethe, glaubt man vielen Kritikern, ist. Man atmet also tief durch, trinkt noch ein Glas Wasser und dann geht es los. "Ein dichter Herbstnebel verhüllte noch in der Frühe die weiten Räume des fürstlichen Schloßhofes,...", so fängt es an. Man atmet ein wenig auf. Der Anfang ist ja gar nicht so schlimm, denkt man sich. Man liest weiter. Nach der zweiten Seite hält man an. Man braucht ein weiteres Glas Wasser. Man überlegt. Was habe ich da gerade eigentlich gelesen, fragt man sich. Also noch mal von vorn. Wort für Wort. Der Inhalt wird klarer. Aha, denkt man sich, jetzt verstehe ich. Ist ja ganz einfach. Man liest weiter. Eine Textstelle lässt einen stolpern. Man versteht, was da geschrieben ist. Es ist offensichtlich Deutsch. Aber was meint der Autor? Wovon redet er? Man überlegt. Und überlegt. Dann nimmt man ein Buch über Goethe zur Hand. Wann hat er noch mal gelebt, der Goethe? In welcher Epoche ist die Novelle entstanden? Man findet Erkenntnis. Aha, denkt man sich wieder. Ist ja toll. Was Goethe meinen könnte, wenn er erzählt, man beginnt es zu vermuten. Man liest also weiter. Der Text ist durchzogen mit Textstellen, die man im ersten Moment nicht richtig versteht, sie aber überliest um endlich zu erfahren, worum es in dem Buch überhaupt geht. Etliche Anspielungen auf die Bibel sind vorhanden. Manches kommt einem bekannt vor. Man liest im Buch weiter. Das habe ich doch eben schon mal gelesen, denkt man. Man blättert zurück. Und tatsächlich. Ein paar Seiten zuvor stand das Gleiche schon einmal, nur etwas anders umschrieben, von einer anderen Person ausgedrückt zum Beispiel. Mensch, man muss echt aufpassen wie ein Luchs, wenn man alles mitbekommen möchte, was in der Novelle steht. Dabei ist sie doch so kurz.
Die Novelle hat natürlich auch einen Inhalt. Sie berichtet von einem Tag im Leben einer Fürstenfamilie. Im Morgengrauen werden die Pferde gesattelt, der Fürst bricht zur Jagd auf, seine schöne Gattin soll den Tag mit dem Fürst-Oheim verbringen. Dieser zeigt ihr die schönen Skizzen von der Stammburg und dessen Ruinen, die wieder begehbar und zum Gedenken der Vorzeit hergerichtet werden sollen. Die Fürstin bekommt Lust, die Stammburg in Augenschein zu nehmen und bricht mit dem Oheim und Honorio, dem Junker, auf. In der Stadt ist gerade der große Jahrmarkt und da so tolles Wetter ist, möchte die Fürstin dahin. Sie sieht grauenvolle Bilder von wilden Tieren in Form von Plakaten, die eine Marktattraktion darstellen. Der Ritt geht weiter in Richtung der Burgruine. Plötzlich sehen sie Rauch, ein Feuer auf dem Markt scheint ausgebrochen. Der Oheim reitet zurück in Richtung Stadt, Honorio und die Fürstin folgen ihm langsamer. Plötzlich taucht ein Tiger vor ihnen auf. Honorio schießt, verfehlt jedoch. Er fordert die Fürstin auf zu fliehen und Honorio jagt den Tiger, der seinerseits der Fürstin hinterherrennt. Die Fürstin stürzt vom Pferd und sieht den Tiger auf sich zukommen, als Honorio den Tiger ritterlich gekonnt niederstreckt. Er möchte ihr nun des Tigers Fell als Zeichen seiner Verehrung schenken, die Fürstin lehnt jedoch ab. Ein relativ spannender Moment im Stück findet statt, als Honorio entgegen der Bitte der Fürstin auf den Knien bleibt, welches die im 18. Jahrhundert übliche Stellung eines Liebhabers ist. Was wird nun passieren? Das Unmögliche? Gesteht er ihr seine Liebe? Die beiden haben nämlich ein Auge aufeinander geworfen, sie sind ja beide auch unglaublich schön, wie der Leser mehrmals erfährt. Doch es kommt anders. Er und sie wissen, dass die Standesgrenzen eine Beziehung unmöglich machen würden und Honorio bittet die Fürstin stattdessen, dem Fürsten gut zuzureden, ihm eine Reise zu ermöglichen. Freut sich der Leser jetzt? Oder ist er enttäuscht? Wer wollte nicht insgeheim, dass die beiden, gegen jede Vernunft, einfach ihren Gefühlen füreinander freien Lauf lassen? Wie schon gesagt, Honorio hat alles im Griff und die Schicklichkeit wird gewahrt. Natürlich möchte Goethe am Beispiel der Entsagung Honorios etwas zeigen, der Leser soll ja auch etwas über das Leben lernen. Doch dazu später mehr. Mitten in den sinnlichen Moment zwischen Honorio und der Fürstin platzt dann die Jagdgesellschaft, die ihrerseits den Brand bemerkt hat und auf dem Weg in die Stadt ist. Und noch jemand kommt hinzu: Es sind die Besitzer des Tigers, die seinen Tod bejammern. Zu allem Überfluss ist auch noch der Löwe los. Er befindet sich, wie gleich gemeldet wird, im Hof der alten Stammburg. Der Fürst möchte den Löwen genau wie den Tiger erlegen lassen, doch die Schaustellerfamilie hat eine viel bessere Idee: Der kleine Sohn der Familie soll den Löwen einfach mit seiner Flötenmusik zähmen. Die Idee erweist sich als Volltreffer: Der Junge nähert sich dem Tier und spielt ein Lied. Daraufhin legt der Löwe seine Pfote in den Schoß des Jungen und lässt sich einen Dorn zwichen den Zehen entfernen. Zum Abschluss singt der Junge von der Einheit von Natur und Mensch, Kosmos und Gott und beschwört das Universum der Liebe.
Goethe lehrt uns in seiner Novelle viel über das Leben. Wir lernen, dass man Konflikte ohne Gewalt lösen sollte und auch kann, dass innere Ruhe der Kern allen Erfolges ist, dass die Einheit von Mensch und Natur das Beste ist; dass Kunst und Natur zusammengehören, dass das Alte vergänglich ist, dass die wahrlich guten Menschen entsagen und überhaupt das Paradies die stärkeren Vorzüge gegenüber der Realität besitzt. Um uns diese wahrlich ehrenhaften Tugenden vor Auge zu führen, macht es sich Goethe sehr einfach. Man versetze sich in das Szenario: Das Chaos tobt, ein wilder Tiger fällt fast die Fürstin an, Honorio kann sie retten, der Tiger ist tot. Die Schaustellerfamilie betrauert ihr gestorbenes 'Familienmitglied', den Tiger, die Fürstin müsste eigentlich unter Schock stehen und Honorio immer noch damit beschäftigt sein, die Tötung des Tigers und seine unterdrückte Leidenschaft für die Fürstin zu bewältigen. Kurz gesagt: Die Nerven dürften kollektiv blank liegen. Und was verwendet Goethe als Beruhigungsmittel? Er lässt den Löwen los. Eigentlich müssten doch daraufhin alle Beteiligten komplett die Nerven verlieren. Doch in Goethes Novelle bleiben alle ruhig. Der Fürst ordnet in sachlichem Ton an, wie der Löwe zu erlegen ist, die Schaustellerfamilie vergibt Honorio, ach ja, und außerdem haben die Schausteller ja noch ein Ass im Ärmel: Der kleine Junge mit der Flöte, der es schließlich richten wird. Obwohl skeptisch, geht der Fürst auf den Vorschlag der Familie ein, den Jungen das Tier bändigen zu lassen, was den Weg frei macht zum großen Finale. Angst haben die Schausteller keine, sie ruhen in sich selbst; der kleine Junge sowieso, er kann ja schließlich auch ganz toll Flöte spielen. Am Ende wird alles viel besser als gut und man freut sich über die paradiesischen Zustände. Natürlich werden Befürworter der Novelle von Goethe argumentieren, dass die Menschen Ideale brauchen, an denen sie sich orientieren können. Schön und gut. Aber warum missachtet Goethe die Merkmale einer realistischen Handlung in diesem Ausmaß, nur um unerreichbare und deshalb vollkommen unsinniges Ideale aufzuzeigen?
Der Titel des Werkes, nämlich "Novelle", lässt rein gar nichts über den Inhalt des Stückes erahnen, und offenbar scheint Goethes Hauptaugenmerk auf diesem auch gar nicht zu liegen. Seine eigene Definition einer Novelle ist eine "sich ereignete unerhörte Begenheit". Zum einen ist von dem Brand als einem "unerwartet außerordentlichen Fall" die Rede und die Begegnung mit dem Tiger wird als "seltsames unerhörtes Ereignis" tituliert, welches Goethes Novellendefinition im Prinzip gleichkommt. Der Brand ereignet sich genau in der Mitte der Novelle, deshalb kann man ihn als Wendepunkt bezeichen. Ein Wendepunkt ist übrigens auch ein Wesensmerkmal einer Novelle. Die Einheit der Novelle soll durch ein Symbol repräsentiert werden, eine Sache, die die Ereignisse am Laufen hält und zu einem überraschenden Ende führt. Der Löwe ist ein Paradebeispiel für dieses Symbol, welches eine gute Novelle charakterisiert. Kurz gesagt, Goethe zeigt dem Leser, dass er, der quasi Erfinder der allgemeinen Novellendefinition, weiß wie man eine richtige Novelle schreibt. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die "Novelle" eine perfekte Novelle im Sinne der Erfüllung der Merkmale dieser literarischen Gattung darstellt. Sie ist ein Musterbeispiel für eine Novelle, ein wahres Meisterstück. Nur leider mutet Goethes Stück wie eine reine Demonstration seiner außerordentlichen Fertigkeiten an. Die Novelle selbst zieht mich als Leser zu keinem Zeitpunkt in ihren Bann. Im Gegenteil, sie liest sich teilweise eher wie eine literaturwissenschaftliche Arbeit. Der Titel des Stückes, "Novelle", passt dazu. Das Stück ist eben einfach eine Novelle mit allem was dazugehört. Die Unrealistik der Geschichte kommt wie reine Bequemlichkeit daher.
Zusammengefasst kann ich sagen, dass ich "Novelle" von Johann Wolfgang von Goethe eventuell für Menschen, die an der Novelle als Gattung interessiert sind, empfehlen würde. Allen anderen möchte ich von der Lektüre der Novelle abraten, da die Novelle für meinen Geschmack zu umständlich geschrieben ist; der Inhalt sehr unrealistisch ist und der Autor versucht, unerreichbare und deshalb zweifelhafte Ideale zu vermitteln. Desweiteren versteht es die Novelle nicht, den Leser in seinen Bann zu ziehen, da die paradiesische Schilderung der Zustände nicht dazu förderlich ist, Spannung aufzubauen.
Literaturverzeichnis
Bauerlein, Mark. Literary Criticism: An Autopsy. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997.
Carlsson, Anni. Die deutsche Buchkritik von der Reformation bis zur Gegenwart. Bern: Franke, 1969.
Degenhardt, Inge (Hrsg.). Literarische Wertung. Ditzingen: Reclam, 1985.
Kienecker, Michael. Prinzipien literarischer Wertung. Palaestra Bd. 286. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989.
Krämer, Herbert (Hrsg.). Theorie der Novelle. Ditzingen: Reclam, 1986.
Schmalz, Jens. Rezension historischer Literatur. http://www.wi.uni-muenster.de/aw/lehre/archiv/RezSchmalz.pdf. Online.
Rath, Wolfgang. Die Novelle. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000.
Reich-Ranicki, Marcel. Über Literaturkritik. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 2002.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptzweck dieses Textes über Literaturkritik?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Literaturkritik. Er untersucht die Geschichte der Literaturkritik, die Natur literarischer Werturteile, die Kriterien, die bei der literarischen Wertung verwendet werden, und die verschiedenen Formen der literarischen Rezension.
Welche Themen werden in diesem Text behandelt?
Die behandelten Themen umfassen eine Einführung in die Literaturkritik, die Geschichte der Literaturkritik von der Antike bis zur Moderne, die Analyse literarischer Werturteile (einschließlich Appetenz-, Leistungs- und Akzeptanzurteile), die verschiedenen Kriterien, die bei der Bewertung von Romanen und Lyrik verwendet werden, und einen Überblick über die literarische Rezension als Form der Kritik.
Was wird über die Geschichte der Literaturkritik gesagt?
Der Text beschreibt, wie sich die Literaturkritik von der Verwendung allgemeingültiger Maßstäbe in der Antike bis zu subjektiveren Ansätzen im Sturm und Drang entwickelt hat. Er behandelt die Rolle der Vernunft in der Aufklärung, die Bedeutung der Empfindung und die Entwicklung der romantischen Kritik sowie die Idee der Zeitkritik im Jungen Deutschland.
Was sind die verschiedenen Arten von literarischen Werturteilen?
Es werden drei Arten von literarischen Werturteilen unterschieden: Appetenzurteile (basierend auf persönlichem Gefallen), Leistungsurteile (basierend auf nachweisbaren Leistungen des Autors) und Akzeptanzurteile (basierend auf der Stellung des Werkes innerhalb seiner Gattung).
Welche Kriterien werden in der Roman- und Lyrikkritik häufig verwendet?
In der Romankritik werden oft Kriterien wie die Teilnahme des Lesers am Romangeschehen, die Sympathie für den Helden und die Evokation von Erschütterung oder Spannung herangezogen. In der Lyrikkritik spielen die "affektive Effizienz" (die gelungene Auslösung von Empfindungen), der Gefühlsausdruck des Dichters und die geglückte Kombination von Wahrheit und Schönheit eine Rolle.
Was ist eine literarische Rezension und welche Arten gibt es?
Eine literarische Rezension ist eine kritische Besprechung und Beurteilung eines literarischen Werkes. Der Text beschreibt verschiedene Arten von Rezensionen, darunter Kurzrezensionen, ausführliche Rezensionen und Sammelrezensionen (einschließlich thematischer Vergleiche und sukzessiver Vergleiche).
Was wird über Objektivität und Subjektivität in der Literaturkritik gesagt?
Der Text betont, dass literarische Urteile sowohl subjektive als auch objektive Elemente enthalten. Die Persönlichkeit und Perspektive des Kritikers beeinflussen das Urteil, während objektive Analysen von Sprache, Symbolik und Form ebenfalls eine Rolle spielen.
Was ist das Fazit des Textes über die literarische Wertung?
Das Fazit argumentiert, dass die literarische Wertung trotz ihrer subjektiven Elemente wertvoll ist. Sie sollte nicht als allgemeingültiges Urteil verstanden werden, sondern als eine Sachverständige, die die Sinne für die Qualität von Literatur schärft. Eine gute literarische Wertung kombiniert Objektivität und Subjektivität, um dem Leser zu helfen, zu verstehen, was für ihn selbst gute Literatur ausmacht.
Welche Bewertung wird in der Rezension zu Goethes "Novelle" abgegeben?
Die Rezension von Goethes "Novelle" hebt die formale Meisterschaft des Stücks hervor, kritisiert aber gleichzeitig seine Unrealistik und die fehlende Fähigkeit, den Leser in den Bann zu ziehen. Es wird argumentiert, dass das Stück eher wie eine Demonstration von Goethes Fähigkeiten als eine fesselnde Geschichte wirkt.
Gibt es ein Literaturverzeichnis?
Ja, der Text endet mit einem umfassenden Literaturverzeichnis, das Werke zur Theorie der Literaturkritik, der Novelle und zur Geschichte der Buchkritik enthält.
- Quote paper
- Michael Rüsing (Author), 2003, Subjektiv und Objektiv - Prinzipien und Werte literarischer Wertung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108083