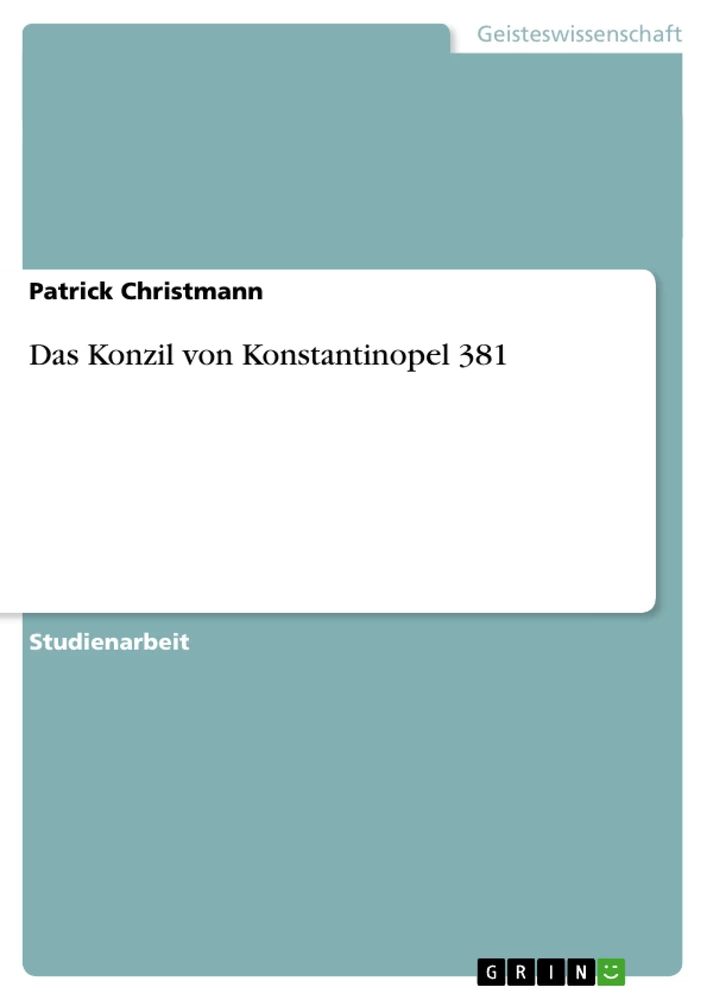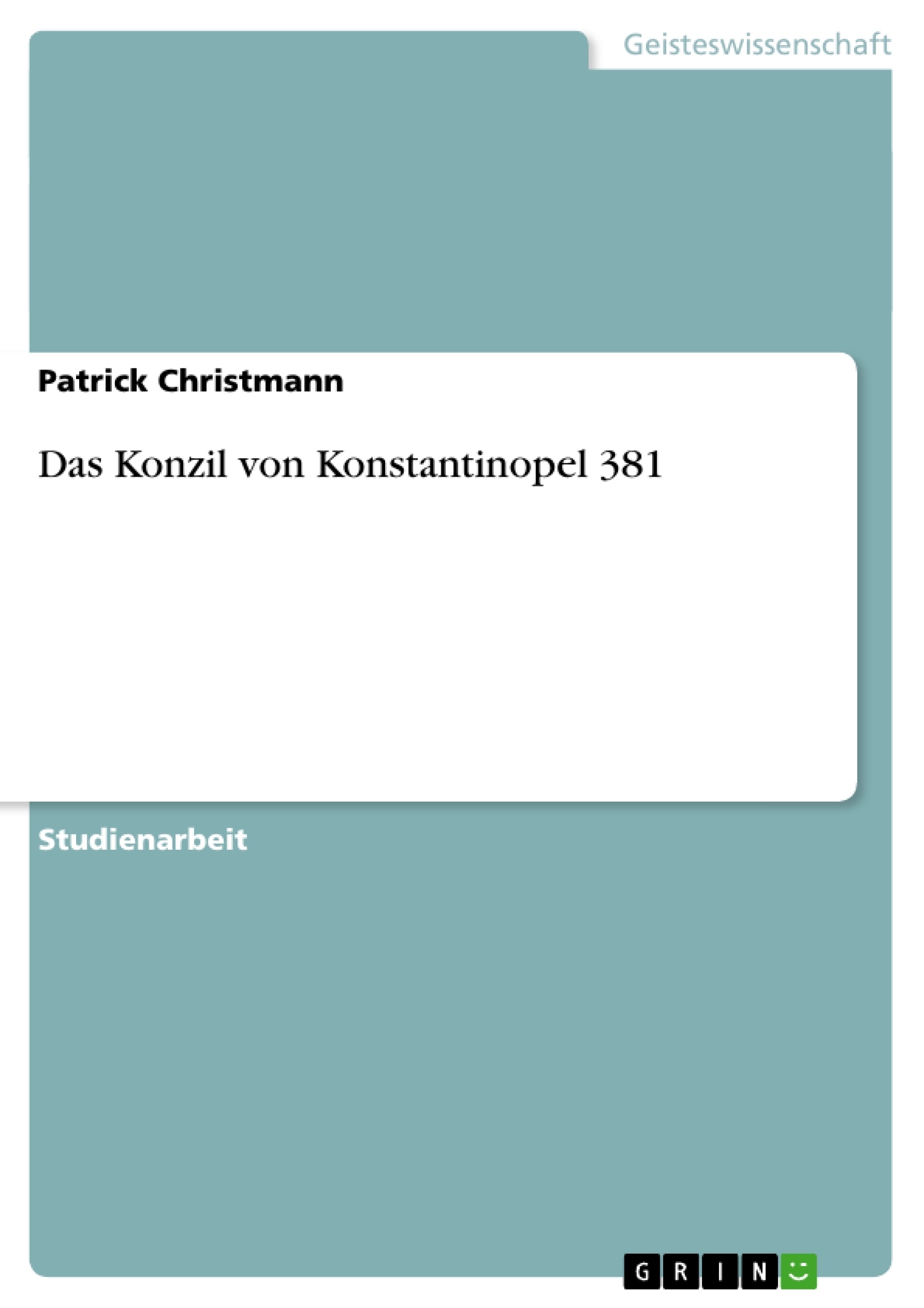Ein Reich in Aufruhr, zerrissen durch theologische Grabenkämpfe und politische Intrigen: Tauchen Sie ein in die turbulente Welt des Konzils von Konstantinopel im Jahr 381, einem Wendepunkt der Kirchengeschichte, der die Weichen für das Christentum, wie wir es heute kennen, neu stellte. Dieses Buch enthüllt die dramatischen Ereignisse, die sich hinter den verschlossenen Türen des Kaiserpalastes und der Apostelkirche abspielten, als Kaiser Theodosius I. versuchte, die Einheit des Reiches durch die Festigung des Glaubens wiederherzustellen. Erleben Sie die hitzigen Debatten zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen – von den Arianern und Pneumatomachen bis hin zu den Sabellianern und Apollinaristen –, die um die wahre Natur Gottes und die Rolle des Heiligen Geistes stritten. Verfolgen Sie, wie die Konzilsväter unter dem Druck politischer Interessen und persönlicher Eitelkeiten rangen, um ein gemeinsames Glaubensbekenntnis zu formulieren, das die Grundlage für das Nicaeno-Constantinopolitanum bildete, das bis heute in den christlichen Kirchen gesprochen wird. Entdecken Sie die Schlüsselpersonen – von den streitbaren Bischöfen wie Gregor von Nazianz und Meletius von Antiochien bis hin zum machtbewussten Kaiser Theodosius – und ihre komplexen Beziehungen, die das Konzil maßgeblich prägten. Analysiert werden die Beschlüsse des Konzils, insbesondere die Kanones, die das Verhältnis zwischen den Bischofssitzen von Rom und Konstantinopel neu definierten und damit den Grundstein für die spätere Spaltung der Kirche legten. Dieses Buch bietet einen fundierten und spannenden Einblick in eine Zeit des Umbruchs, in der theologische Dogmen und politische Machtkämpfe untrennbar miteinander verwoben waren und das Schicksal des Christentums auf dem Spiel stand. Eine tiefgreifende Analyse der historischen Kontexte, theologischen Auseinandersetzungen und kirchenpolitischen Implikationen, die das Konzil von Konstantinopel zu einem der bedeutendsten Ereignisse der Kirchengeschichte machen. Verstehen Sie die Hintergründe des Glaubensbekenntnisses und seine Auswirkungen auf die christliche Lehre bis in die Gegenwart. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Kirchengeschichte, Theologie und die Entstehung des christlichen Glaubens interessieren. Die detaillierte Darstellung des Konzilsverlaufs, der verschiedenen Glaubensrichtungen und der politischen Einflüsse ermöglicht ein umfassendes Verständnis der damaligen Zeit.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Konzil
2.1. Der Konzilsverlauf (I)
2.2. Intermezzo: Die verschiedenen Glaubensrichtungen des Konzils
2.2.1. Die pneumatomachische Richtung
2.2.2. Die Sabellianer
2.2.3. Die Markellianer/Photinianer
2.2.4. Die Apollinaristen
2.2.5. Der Arianismus
2.3. Der Konzilsverlauf (II)
3. Die Beschlüsse des Konzils
3.1. Kanon
3.2. Kanon
3.3. Kanon
3.4. Kanon
3.5. Der Synodalbrief
4. Der Kaiser des Konzils: Theodosius I. (der Große)
5. Das Glaubensbekenntnis
6. Das Konzil von Konstantinopel als eines der ökum. Konzilien
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Schon im Jahre 377 gab es Bestrebungen unter Basileios von Kaisareia ein Konzil zur Klärung der Trinität Gottes abzuhalten. Zwei Jahre später (379) wurde in einer Synode in Antiochien die Glaubenseinheit mit Rom bekanntgegeben. Die Religionsgemeinschaft der Christen veränderte sich 380, als dann das Christentum zur Staatsreligion ausgerufen wurde.
Quellen über das Konzil von Konstantinopel findet man bei den Kirchenhistorikern Sokrates, Sozomenus und Theodoret, die zwar erst später lebten aber von Quellen des Konzils schöpfen konnten, eine besonders wichtige Quelle ist ein Gedicht von Gregor von Nazianz über sein eigenes Leben: „Carmen de vita sua“, indem er auch über die Geschehnisse des Konzils aus seiner Sicht berichtet.
Das Konzil sollte die anstehenden kirchlichen und dogmatischen Probleme lösen. So hatte Kaiser Konstantin der Große in Nizäa Arius selbst verbannt und sich dann vor seinem Tod arianisch taufen lassen. Durch diese Geste hatten die Arianer an Macht gewonnen, durch den Tod des Kaisers dann aber wieder an Einfluß verloren, all dies und die verschiedenen Interpretationen der Wesenheit Gottes führten nun zu neuen Problemen, die der neue Kaiser lösen mußte.
2. Das Konzil
2.1. Der Konzilsverlauf (I)
Einberufen durch Kaiser Theodosius I. (s. u. ) am Anfang des Jahres sammelte sich das Konzil im Monat Mai 381. Die offizielle Dauer wurde bis 9. Juli desselben Jahres festgesetzt.
Eingeladen waren zu dem Konzil 146 Bischöfe. Die Zahl wurde später auf 150 „aufgerundet“, um eine Rechtfertigung in der Bibel zu erhalten (1 Chr 8, 40 „...Sie hatten viele Söhne und Enkel, insgesamt hundertfünfzig. Alle diese gehörten zu den Nachkommen Benjamins.“, Neh 5,17 „ An meinem Tisch speisten die führenden Juden und Beamten, hundertfünfzig an der Zahl...“). Die Einladungen ergingen zu Anfang des Jahres 381, um Reiseschwierigkeiten der Teilnehmer im Voraus zu vermeiden Teilnehmer waren unter anderem Meletius von Antiochien, Cyrill von Jerusalem, Gelasius von Caesarea, Diodor von Tarsus, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa, Petrus von Sebaste, Amphilochius von Ikonium und Eulogius von Edessa.
Das Konzil wurde feierlich im Thronsaal des Konstantinpalastes eröffnet. Die ersten Sitzungen fanden auch in diesem Kaiserpalast statt. Später wechselte man in die Apostelkirche (Apostoleian, die Haupt- und Bischofskirche der Reichshauptstadt Konstantinopel). Mittlerweile ist diese zerstört, an ihrem Platz steht heute die Fatih- Moschee.
Kaiser Theodosius eröffnete feierlich das Konzil und erwies den Anwesenden seine Verehrung. Er forderte sie zugleich auf die anstehenden Probleme zu lösen. Als erstes erzeigte er nun Meletius von Antiochien seine Ehrerbietung, weil ihm dieser im Traum vor einigen Jahren erschienen war und ihm darin die Kaiserinsignien überreichte. Durch diese Gesten bezeugte der Kaiser seinen Schutz und erhob Meletius zum Konzilspräsidenten. Der Kaiser selbst nahm an dem Konzil nicht teil, ob er allerdings durch Beamte vertreten war ist umstritten.
Von den Konzilsteilnehmern vertraten Sechsunddreißig die pneumatomachische Richtung. Deren Wortführer waren Eleusius von Kyzikos und Markianus von Lampsakos. Die Vertreter dieser Richtung wurden nach Makedonius (360 als Bischof von Konstantinopel vertrieben) Makedonianer benannt. Sie bestritten das volle göttliche Wesen des Heiligen Geistes. An dieser Stelle ist es nun angebracht die verschiedenen Strömungen vorzustellen:
2.2. Intermezzo: Die verschiedenen Glaubensrichtungen des Konzils
2.2.1. Die pneumatomachische Richtung
Führer dieser Richtung waren Macedonius und Eustathius von Sebaste. Sie waren der Meinung, dem Heiligen Geist fehle die „Homousie“ (Wesensgleichheit) mit Gott. Der Heilige Geist ist Teil des göttlichen Wesens, steht aber nicht auf gleicher Stufe mit Gott Vater und Gott Sohn, sondern ist „Dolmetscher“(bzw. Sprachrohr) Gottes und hat somit eine dienende Funktion. Er ist ein Geschöpf Gottes und besitzt zwar himmlische Macht aber ist Gott auch untergeben. Diese Glaubensrichtung war in Kleinasien und im dortigen Mönchstum stark verbreitet. Es stellte sich auch nicht gegen die Glaubensaussage des Konzils von Nizäa (siehe Symbolum Nicaenum „Wir glauben an...und an den Heiligen Geist “), da dort das Wesen des Heiligen Geistes nicht näher beschrieben wurde. Was nun natürlich zu diesem Problem der Wesenheit des Heiligen Geistes führen mußte.
2.2.2. Die Sabellianer
Die Sabellianer vertraten die Theorie, daß Gott zuerst als Vater (AT), dann als Sohn (NT) und dann als Heiliger Geist (Apg) erschien, d.h. daß es also ein Gott in verschiedenen Erscheinungsformen gibt.
2.2.3. Die Markellianer/Photinianer
Die Markellianer gehen wohl auf Markell von Ankyra (gest. 375) zurück.
Die Photinianer waren Schüler des Photinus von Sirmium. Der wiederum ein Schüler Markells war. Wie die Sabellianer leugneten auch diese die Trinität Gottes und beriefen sich auf den Apostel Paulus (1Kor 15, 28 „...damit Gott herrscht über alles und in allem.“), dagegen steht im NC „seiner (Christus, Anmk. des Verf.) Herrschaft wir kein Ende nehmen.“
2.2.4. Die Apollinaristen
Die Apollinaristen gehen auf die Lehren Apollinaris von Laodicea (gest. 390) zurück. Dieser sah in der Homousität Christi ein Beleg für die Einnaturenlehre (Monophysitismus): Jesus war so sehr Gott(heit), daß er nicht mehr Mensch sein konnte. Die Vernunftseele (Nous) des Menschen in Christus, war das Wesen der Gottheit. Hier spricht das NC dagegen wenn es vom „Fleisch geworden aus dem Heiligen Geist und der Jungfrau Maria“ spricht.
2.2.5. Der Arianismus
Arius war der Meinung, daß Jesus, wie alle anderen aus dem Nichts geschaffen ist. Er existiert nicht von Ewigkeit her. Jesus ist zwar Gott ähnlich (homoiusios), aber geschaffen von Gott, als dessen höchstes Wesen.
Vertreter dieser Richtung waren zur Zeit des Konzils Eunomios, ein gefährlicher und radikaler Arianer und Eudoxios, der in den 60er Jahren des 4. Jahrhunderts Bischof von Konstantinopel war und einen gemäßigten Arianismus vertrat.
2.3. Der Konzilsverlauf (II)
Die Pneumatomachen verweigerten aber die Kirchengemeinschaft mit den Konzilsvätern und beharrten auf ihrem Standpunkt. Es kam zu keinem Konsens und so verließen sie das Konzil. Damit konnte der antipneumachtomachische Absatz „..der Heilige Geist mit dem Vater und dem Sohne angebetet und...) verabschiedet werden. Die restliche Konzilsmehrheit beschloß nun wohl das Glaubensbekenntnis „Nicaenoconstantinopolitanum“.
Die erste Hürde wurde genommen.
Nach der Auseinandersetzung mit den Pneumotomachen erschienen dann noch Vertreter des Westens: Timotheus von Alexandrien, Dorotheus von Oxyrhynchos, Acholius von Thessalonich und deren Anhang. Ziel dieser Einladung konnten ein friedlicher Abschluß mit allen (restl. Parteien) sein oder gar die Absicht des Kaisers auf eine ökumenische Glaubensordnung, was zum Ziel hatte, daß im ganzen Reich (West- und Ostreich) nur ein Glaube gelten sollte, um so religiöse (aber auch politische) Unruhen zu vermeiden. Nun folgte die Absetzung Maximus als Bischof von Konstantinopel, der 380 (mit alexandrinischer Unterstützung) heimlich zum Bischof ernannt wurde, nachdem man den Homöer Demophilos vertrieben hatte. Noch Ende 381 erklärten die westlichen Bischöfe unter ihrem Wortführer Bischof Damasus von Rom (366 bis 384) die Ansprüche Maximos als Bischof von Konstantinopel. Trotz allem wurde Gregor von Nazianz statt dessen in der zweiten Hälfte des Monats Mai als neuer Bischof von Konstantinopel inthronisiert. Er war seit einem Jahr schon als Bischof tätig und ein Jahr zuvor schon mit der Betreuung der Gemeinde aufgefordert worden. Gregor von Nazianz war der Streit zwischen dem Westen und dem Osten wegen der Bischofsstühle zwar immer ein Greuel gewesen, aber er trotz allem nahm diese Ehre an.
Ende Mai stirbt dann der Konzilspräsident Meletius. Gregor von Nyssa hält daraufhin die Leichenpredigt (wie dieser auch die Inthronisierungspredigt für Gregor von Nazianz hielt). Die Konzilsväter erweisen dem verstorbenen Präsidenten die letzte Ehre bevor er nach Antiochien in seine Heimatgemeinde überführt wird. Das Konzil ruhte infolge des Todes und der Trauer, sowie der Trauerfeierlichkeiten einige Tage. Danach nahm, wie dies normalerweise üblich ist, der Ortsbischof, hier: Konstantinopels, Gregor von Nazianz, den Vorsitz auf.
Durch den Tod Meletius aus Antiochien erwuchs daraus ein religiös-politisches Problem. Antiochien hatte zwei Bischofssitze (antiochienisches Schisma): Auf der einen Seite stand der Kappadozier Meletius, der die Unterstützung des Kaisers des Ostens genoß auf der anderen Seite Paulinus, der römisch orientiert war und unterstützt wurde durch die Bischöfe von Alexandrien und Rom. So kam es, wie es kommen mußte zur Krise. Der Osten fühlte sich von dem Westen bevormundet. Gregor von Nazianz (der wie Meletius auch Kappadozier war) versuchte das Problem auf die wohl einfachste und biologischste Weise zu lösen. Paulinus war recht alt und so dachte sich Gregor von Nazianz sollte man diesen Greisen als alleinigen Bischof von Antiochien belassen bis er stirbt. Danach kann ein neuer Bischof dann bestimmt werden und so klärt sich die Angelegenheit von selbst. Dies war auch ein ehemaliger Vorschlag des Westens gewesen und so wären eigentlich beide Seiten zufrieden gewesen doch der Osten rebellierte gegen diesen Vorschlag. Es kam zu einem Streit zwischen den Ansichten der westlichen Bischöfe und den östlichen Bischöfen. Jeher war der Westen in vielen Dingen tonangebend gewesen. Das durfte man nun nicht auf sich beruhen lassen. Man argumentierte mit dem Lauf der Sonne: Bekanntlich geht die Sonne zuerst im Osten auf. So zog man Parallelen und meinte, wo die Sonne zuerst sei, dort seien auch die ersten und besseren Argumente.
Im Jahre 382 wurde Flavian dann trotzdem vom Osten zum Bischof bestimmt. Bis Paulinus´ Tod im Jahre 398 gab es dann immernoch 2 Bischöfe. Aber Paulinus erhielt dadurch nur noch Recht geringe Beachtung.
Durch diese Streitigkeiten resignierte Gregor von Nazianz allmählich. Er meldete sich krank. Als im Monat Juni dann die westlichen Bischöfe eintrafen, hofft er von diesen auf Unterstützung. Doch stattdessen werden sie seine eigenen Gegner, weil sie wegen der Absetzung Maximos und der Benennung Gregors von Nazianz zum Bischof von Konstantinopel über dieses Vorgehen erbost sind. Sie berufen sich auf Kanon Fünfzehn des Konzils von Nizäa, indem festgelegt ist, daß ein Bischof sein Bischofsstuhl nicht wechseln darf. Gregor von Nazianz war aber schon 372 Bischof von Sasima. Er verteidigte sich damit, daß er nie diesen Bischofssitz angetreten hatte. Außerdem wären die Gesetze „längst tot“ und würden nicht beachtet (so im Osten nicht und im Westen erst seit kurzem).
Trotzdem reichte Gregor von Nazianz seinen Rücktritt bei Kaiser und Konzil ein. Er begründete dies mit dem auftretenden Neid und Hass der anderen Konzilsväter gegen seine Person. Nach seinem Rücktritt kehrte er nach Nyzanz zurück und übernahm die Position des Bischofverwesers. Mit seinem Rücktritt war Gregor von Nyzanz als Kirchenpolitiker gescheitert. Eventuell wollte er durch seinen Rücktrittsgesuch das Konzil unter Druck setzen und erwartete deren Ablehnung.
Es mußte also wieder ein neuer Bischof gefunden werden. Aufgrund Empfehlungen von Medetius von Antiochien und Diodar von Tarsus wurde Nektarius von Tarsus ausgewählt. Er war eigentlich Politiker und Jurist, dazu noch ungetauft. Aber als eine Art Kultusminister beliebt und angesehen im Volk. Nektarius wurde nun getauft und inthronisiert. Er behielt den Bischofsitz bis zu seinem Tode 397. Wie zu erwarten war der Westen gegen Nektarius als Bischof von Konstantinopel. Das NC wurde durch Nektarius noch verstärkt, der dieses bei seiner Taufe und Inthronisierung selbst vortrug. Der neue Bischof Nektarius führte dann das Konzil noch zu einem versöhnlichen Abschluß.
3. Die Beschlüsse (Kirchenrechtsquellen) des Konzils
Eigentliche Konzilsakten (wie Protokolle u.ä.) liegen nicht vor. Überliefert sind aber die folgenden Quellen.
Als erstes wäre hier die Proklamation des Tomos zu nennen: Das Nicaenoconstantinopolitanum, unser heutiges Glaubensbekenntnis. Das zwar schriftlich nie bei diesem Konzil festgelegt wurde, oder mittlerweile verloren ging. Welches, wie wir durch den Schriftverkehr der Bischöfe wissen, aber sehr wohl dort proklamiert war. Es ist anzunehmen, daß dies nach dem Abzug der Pneumatomachen entstanden ist. Als weitere Beschlüsse des Konzils sind die 4 Kanones (Gesetze) zu nennen: Kanon 1: „Der Glaube der im bithynischen Nizäa zusammengekommenen Väter darf nicht beseitigt werden, sondern soll entscheidend bleiben. Und jede Häresie der Eunomianer oder Anhomöer1, und die der Arianer oder Eudoxianer, und die der Semiarianer oder Pneumatomachen, und die der Sabellianer, Markellianer, die der Photinianer und die der Apollinaristen.“
Kanon 2: Ein Bischofsstuhl darf sich nicht in die Angelegenheiten eines anderen Bischofsstuhls einmischen.
Dadurch wurde indirekt Petrus von Alexandrien gerügt, der den Maximus zum Bischof von Konstantinopel erhoben hatte.
Dies war schon im Kanon 6 des Konzils von Nizäa verabschiedet worden. Nun galt aber, daß die kirchlichen und politischen Verwaltungsgebiete sich gleichten oder aneinander angepaßt werden sollten. Der Bischof steht dem kirchlichen Verwaltungsgebiet vor und hat somit das Recht eine Synode seines Gebietes einzuberufen und dort dann interne Probleme zu lösen (ohne Einflußnahme Fremder). Kanon 3: „Nach dem römischen Bischof soll der Bischof von Konstantinopel den Ehrenplatz haben, weil diese Stadt das neue Rom ist.“ Dieser Kanon erzeugte erhebliche Spannungen zwischen Ost und West. Er kam wohl auf Druck des Kaisers zu Stande. Der „seine“ Reichshauptstadt stärken wollte. Dies erzeugt selbstverständlich eine Vormachtstellung über Alexandrien und Antiochien (die sich auf ihre apostolische Bedeutung beriefen) und eine nahezu Gleichstellung mit dem Bischofsstuhl von Rom. Kanon 4: Er beschäftigt sich mit der Absetzung des Maximus und legitimiert sie. Alle diese Kanons entstanden wohl in der Anfangszeit des Konzils, wohl noch ohne die westlichen Bischöfe. Am Ende des Konzils wurden sie in einem Synodalbrief dem Kaiser vorgestellt, der diese durch seine Unterschrift bestätigte und dadurch ein Gesetzescharakter erlangten.
Daneben liegt noch der Synodalbrief an den Kaiser vor, der einen kurzen Abriß über das Konzil bietet und dem Kaiser Dank ausspricht, sowie die Veröffentlichung der Beschlüsse durch ihn wünscht.
4. Das Konzil von Konstantinopel als eines der ökumenischen Konzilien
Anspruch als Ökumenisches Konzil zu gelten, erhielt Konstantinopel aber erst 382. Als eine neue Synode der Bischöfe des Ostreiches an die westlichen Bischöfe übersandt wurde und das Konzil als „ökumenische Synode“ benannt wurde. In dem Brief wurden vor allem die Positionen des Konzils erläutert, die Glaubensdefinitionen ausgeführt und die Wahl des Nektarius als Bischof von Konstantinopel bekannt gegeben. Damit verbunden war auch die Bischofswahl in Antiochien (siehe oben). Das Konzil selbst und ihre Väter sahen in ihm in erster Linie Angelegenheiten des östlichen Reiches. Dadurch begann der Aufstieg Konstantinopels zum Patriarchat und die Vormachtstellung nach Rom. Man überwies sich selbst die selbständige Leitung über die Diözesen Oriens, Pontus, Askien und Thrakien erst 451 auf dem Konzil con Chalkedon wurden die Beschlüsse offiziell verbindlich für das ganze Reich und das Konzil von Konstantinopel als „2. Ökumenisches Konzil“ nach Niczäa anerkannt. Damit kam es zum Durchbruch der Absicht Kaiser Theodosius „Ein Reich - Ein Glaube“.
Theodosius I. (der Große)
Theodosius war ein erfolgreicher, spanischer Feldherr und Nachfolger von Valens (364 bis 378), der auf Druck der Armee 364 erstmals zum Mitaugustus erhoben wurde und somit den Ostteil des römischen Reiches zugesprochen bekam.
Valens war homöistisch geprägt, lies der Kirche aber ihren Streit sich selbst überlassen.
Am 19. Januar 379 wurde Theodosius dann durch Gratian, den Kaiser des Westens, zum Kaiser von Ostrom erhoben.
Am 28. Februar 380 erließ Theodosius dann in Konstantinopel das Edikt „Cunctos Populos“ von Saloniki. In diesem wird das Christentum offiziell zur Reichs- und Staatsreligion. Hier wird gesagt, daß das Christentum sich auf den Glauben an den dreifaltigen Gott (wird aber nicht näher beschrieben)gründet und nach der Überlieferung des Apostels Paulus und dem Bekenntnis von Damasus von Rom und Petrus von Alexandrien zu befolgen sei. Alle Völker des Reiches sollen daran glauben, ansonsten erleidet man göttliche Vergeltung und die Rache des Reiches. Die Ausübung von Toleranz mit Un- oder Andersgläubigen entfällt somit.
Am 13. Juni 389 zieht Theodosius in Rom ein.
Nach dem Selbstmord Valentinians am 13. Mai 392 wird Theodosius Kaiser des ganzen Reiches. Er stirbt Anfang November des Jahres 395 und wird am 8. 11. 395 in Konstantinopel beigesetzt.
Das Glaubensbekenntnis
Auch genannt „Symbol der 150 Väter von Konstantinopel“. Gab Antwort auf die Frage nach dem Wesen des Hlg. Geistes.. Aussagen des Nicaenums blieben bestehen. Es folgten Erweiterungen zum Hlg. Geist. (vgl. Nicaenum: „Wir glauben an den Heiligen Geist.“): Ich glaube an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der vom Vater und vom Sohne ausgeht. Er wird mit dem Vater und dem Sohne zugleich angebetet und verherrlicht. Er hat gesprochen durch die Propheten.
Durch die Bezeichnung Herr (griech.: Kyrios) und Lebensspender soll aufgezeigt werden, daß es sich bei dem Heiligen Geist um Gott handelt. „der vom Vater und vom Sohne ausgeht.“ ist eine These gegen die Macedonianer, die den Heiligen Geist als geschaffenes durch den Sohn sahen. „Er wird mit dem Vater und dem Sohne zugleich angebetet und verherrlicht." soll die Wesenseinheit mit Gott Vater und Sohn verdeutlicht werden.
Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge.
Und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes ein(zig) geborenen Sohn. Er ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit; Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott; gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und um unseres Heiles willen ist er vom Himmel herabgestiegen. Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist aus Maria, der Jungfrau, und ist Mensch geworden. Gekreuzigt wurde er sogar für uns. Unter Pontius Pilatus hat er den Tod erlitten und ist begraben worden. Er ist auferstanden am dritten Tage gem äß der Schrift. Er ist aufgefahren in den Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, Gericht zu halten über Lebende und Tote, und seines Reiches wird kein Ende sein.
Ich glaube an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der vom Vater (und vom Sohne) ausgeht. Er wird mit dem Vater und dem Sohne zugleich angebetet und verherrlicht. Er hat gesprochen durch die Propheten. Ich glaube an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. Ich bekenne die Taufe zur Vergebung der Sünden. Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Amen.
Literaturverzeichnis:
Bacht, Heinrich/Dumeige, Gervais (Hg.): Ignacio Ortiz de Urbina(Band 1). Nizäa und Konstantinopel. Mainz 1964
HKG: Baus, Karl/Ewig, Eugen (Hg.), Bd.2 Die Reichskirche nach Konstantin dem Großen. Freiburg 1973
LThK: Kasper, Walter (Hg.), Bd. 6. Freiburg 1997
Neuner, Josef/Roos, Heinrich (Hg.): Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung. Regensburg 1971(13.Aufl.)
Ritter, Adolf-Martin: Das Konzil von Konstantinopel und sein Symbol. Göttingen 1965
Schwaiger, Georg: Päpstlicher Primat und Autorität der Allgemeinen Konzilien im Spiegel der Geschichte. München 1977
Staats, Reinhart: Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. Darmstadt 1996
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes "Sprachvorschau"?
Der Text ist eine Sprachvorschau, die einen Überblick über das Konzil von Konstantinopel bietet. Er umfasst ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, Beschreibungen des Konzilsverlaufs, die verschiedenen Glaubensrichtungen, die Beschlüsse des Konzils, Informationen über Kaiser Theodosius I., das Glaubensbekenntnis und eine Bibliographie.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen sind das Konzil von Konstantinopel, die Trinität Gottes, die verschiedenen Glaubensrichtungen (pneumatomachische Richtung, Sabellianer, Markellianer/Photinianer, Apollinaristen, Arianismus), die Beschlüsse des Konzils (Kanons und Synodalbrief), Kaiser Theodosius I. und das Glaubensbekenntnis.
Wer waren die Schlüsselfiguren im Text?
Schlüsselfiguren sind Basileios von Kaisareia, Kaiser Konstantin der Große, Kaiser Theodosius I., Arius, Meletius von Antiochien, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa, Nektarius von Tarsus und Bischof Damasus von Rom.
Welche Quellen werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt die Kirchenhistoriker Sokrates, Sozomenus und Theodoret als Quellen, sowie ein Gedicht von Gregor von Nazianz ("Carmen de vita sua").
Was waren die dogmatischen Probleme, die das Konzil lösen sollte?
Die dogmatischen Probleme umfassten die Wesenheit Gottes (insbesondere die Trinität), die Interpretation der Wesenheit Jesu Christi (Arianismus) und die Rolle des Heiligen Geistes (pneumatomachische Richtung).
Was sind die Kernaussagen des Konzils von Konstantinopel?
Die Kernaussagen umfassen das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel, die Verurteilung verschiedener Häresien, die Festlegung von Kanons (Gesetzen) und die Stärkung des Bischofsstuhls von Konstantinopel.
Was waren die wichtigsten Beschlüsse des Konzils?
Die wichtigsten Beschlüsse waren die Bestätigung des Glaubensbekenntnisses von Nizäa, die Verurteilung verschiedener Häresien (Eunomianer, Arianer, Semiarianer, Sabellianer, Markellianer, Photinianer, Apollinaristen), die Festlegung von Kanons (z.B. zur Zuständigkeit von Bischofsstühlen) und die Anerkennung des Bischofs von Konstantinopel als Ehrenplatz nach dem römischen Bischof.
Welche Rolle spielte Kaiser Theodosius I. beim Konzil?
Kaiser Theodosius I. berief das Konzil ein, eröffnete es feierlich, forderte die Lösung der anstehenden Probleme, schützte das Konzil und bestätigte die Beschlüsse durch seine Unterschrift. Er erließ auch das Edikt "Cunctos Populos", das das Christentum zur Staatsreligion machte.
Was ist das Nicaenoconstantinopolitanum (Glaubensbekenntnis)?
Das Nicaenoconstantinopolitanum ist das Glaubensbekenntnis, das auf dem Konzil von Konstantinopel verabschiedet wurde. Es erweiterte das Glaubensbekenntnis von Nizäa und präzisierte insbesondere die Lehre über den Heiligen Geist.
Was waren die Gründe für die Spannungen zwischen Ost- und Westkirche während des Konzils?
Die Gründe waren der Streit um die Bischofssitze (insbesondere in Antiochien und Konstantinopel), die unterschiedlichen Ansichten über die Rolle des Bischofs von Rom und die Vormachtstellung Konstantinopels.
- Quote paper
- Patrick Christmann (Author), 2002, Das Konzil von Konstantinopel 381, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108062