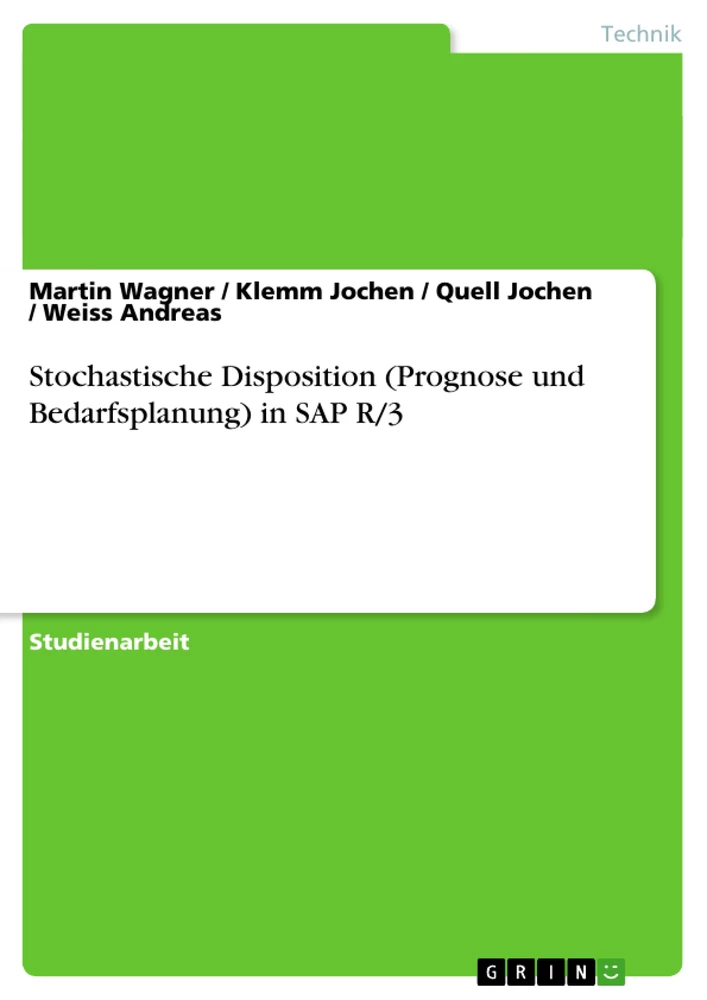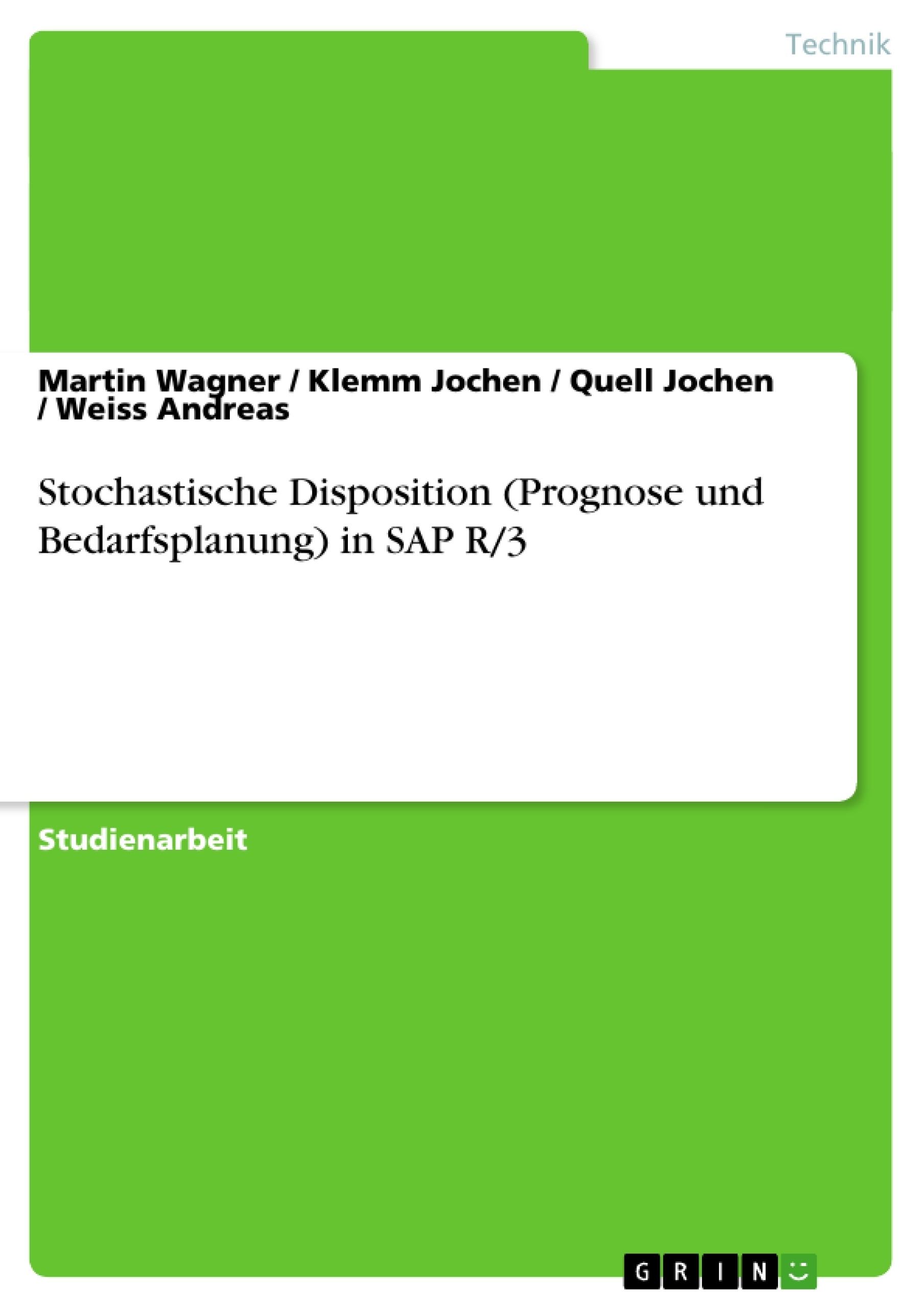Stehen Sie vor der Herausforderung, Ihre Materialwirtschaft zu optimieren und die Komplexität der stochastischen Disposition in SAP R/3 zu meistern? Dieses Buch entführt Sie in die Welt der bedarfsgesteuerten Materialwirtschaft, wo es Ihnen das nötige Fachwissen vermittelt, um Ihre Lagerbestände zu senken, Lieferengpässe zu vermeiden und Ihre Produktionsprozesse zu optimieren. Von den Grundlagen der ABC- und XYZ-Analyse über die Implementierung verbrauchsgesteuerter Dispositionsverfahren bis hin zur detaillierten Anwendung der Bestellpunktdisposition und rhythmischen Disposition in SAP R/3 – dieses Werk deckt alle wesentlichen Aspekte ab. Lernen Sie, wie Sie Bedarfsprognosen präzise erstellen, Prognosemodelle effektiv auswählen und die Ergebnisse im SAP-System optimal nutzen. Erfahren Sie, wie Sie Losgrößenverfahren anwenden, Terminierungen durchführen und Bestellvorschläge generieren, um Ihre Beschaffungsprozesse zu optimieren. Die Nettobedarfsrechnung, Lagerortdisposition, Quotierung und werksübergreifende Disposition mit Umlagerung werden ebenso detailliert behandelt wie die Interpretation und Nutzung von Dispositionslisten und Bedarfs-/Bestandslisten. Dieses Buch ist Ihr unverzichtbarer Leitfaden, um die stochastische Disposition in SAP R/3 erfolgreich zu implementieren und Ihre Materialwirtschaft auf ein neues Level zu heben. Egal, ob Sie Einsteiger oder erfahrener SAP-Anwender sind, die praxisorientierten Beispiele, Tabellen und Abbildungen helfen Ihnen, die Konzepte zu verstehen und erfolgreich in Ihrem Unternehmen anzuwenden. Entdecken Sie, wie Sie durch die richtige Anwendung der Materialdisposition nicht nur Kosten senken, sondern auch die Effizienz Ihrer gesamten Wertschöpfungskette steigern können. Tauchen Sie ein in die Welt der intelligenten Materialwirtschaft und sichern Sie sich einen Wettbewerbsvorteil durch optimierte Prozesse und transparente Lagerbestände mit diesem unverzichtbaren Ratgeber für SAP-Anwender und Logistikexperten. Nutzen Sie die Kraft der stochastischen Disposition, um Ihre Supply Chain widerstandsfähiger und agiler zu gestalten und den Herausforderungen des modernen Marktes erfolgreich zu begegnen.
Inhaltsverzeichnis
Darstellungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Begriff und Aufgabe der Materialdisposition
1.1.1. Begriffserklärung stochastische Disposition
1.2. ABC- und XYZ-Analyse
1.3. Programm- oder verbrauchsorientierte Disposition?
2. Materialdisposition in SAP R/3
2.1. Eingliederung der stochastischen Disposition in SAP R/3
2.2. Plangesteuerte Disposition
2.3. Verbrauchsgesteuerte Disposition
2.4. Bestellpunktdisposition
2.5. Stochastische Disposition
2.6. Rhythmische Disposition
2.7. Allgemeine Parameter der Materialdisposition
3. Bedarfsprognose
3.1. Prognoseparameter
3.2. Prognosemodelle
3.2.1. Verbrauchsverläufe
3.2.2. Prognosemodelle
3.3. Modellauswahl
3.3.1. Manuelle Modellauswahl
3.3.2. Maschinelle Modellauswahl
3.3.3. Manuelle Modellauswahl mit zusätzlichem maschinellen Test
3.4. Verbrauchswerte (Vergangenheitsdaten) erfassen
3.5. Prognose mit Bezug auf ein anderes Material
3.6. Modellinitialisierung
3.7. Prognosedurchführung
3.7.1. Einzelprognose
3.7.2. Gesamtprognose
3.7.3. Gesamtprognose im Hintergrundmodus
3.8. Berechnung des Sicherheitsbestands
3.9. Überwachung des gewählten Prognosemodells
3.10. Prognoseergebnis
4. Durchführung der Disposition innerhalb des SAP-Systems
4.1. Was ist vor der Durchführung der Disposition zu bedenken
4.2. Prüfung der Planvormerkungsdatei
4.3. Nettobedarfsrechnung
4.4. Losgrößenverfahren
4.4.1. Statische Losgrößenverfahren
4.4.2. Periodische Losgrößenverfahren
4.4.3. Optimierende Losgrößenverfahren
4.5. Terminierung
4.6. Ermittlung des Bestellvorschlags
4.7. Erstellung von Ausnahmemeldungen und Umterminierungsprüfung
4.8. Lagerortdisposition
4.9. Quotierung
4.10. Werksübergreifende Disposition mit Umlagerung
4.11. Abweichungen der SAP-Vorgehensweise von der Allgemeinen BWL
5. Dispositionsergebnis
5.1. Was ist eine Dispositionsliste?
5.2. Aktuelle Bedarfs-/Bestandsliste
5.3. Planaufträge
5.4. Verwaltung von Planungsvormerkungen
Literaturverzeichnis
Erklärung
Darstellungsverzeichnis
Tabelle 1 Dispositionsarten in Abhängigkeit von der ABC-XYZ- Analyse
Abbildung 1 Dispositionsverfahren
Abbildung 2 Verbrauchsverläufe
Tabelle 2 Zuordnung Bedarfsverlauf – Prognosemodell
Abbildung 3 Formeln zur Überwachung des Prognosemodells
Tabelle 3 Steuerungsparameter Disposition
Abbildung 4 Schematische Darstellung der Planvormerkungsdatei
Abbildung 5 Berechnung der Unterdeckungsmenge bei stochastischer Disposition
Abbildung 6 Losgrößenverfahren bei der Materialdisposition
Abbildung 7 Periodische Losgrößenverfahren
Tabelle 4 Ermittlung der optimalen Bestellmenge bei verschiedenen Verfahren der optimierenden Losgröße
Tabelle 5 Ermittlung der optimalen Bestellmenge nach dem Groff’schen Losgrößenverfahren
Abbildung 8 Vorgehensweise bei der Rückwärtsterminierung
Abbildung 9 Beispiel zur Umterminierungsprüfung
Tabelle 6 Beispiel zur Umterminierungsprüfung
Abbildung 10 Lagerortdisposition
Tabelle 7 Beispiel zur Quotierung
Tabelle 8 Ermittlung des Nettobedarfs
Abbildung 11 Dispositionsliste
Abbildung 12 Bedarfs- / Bestandsliste
Abbildung 13 Planauftrag
Abbildung 14 Neuplanung
1. Einleitung
1.1. Begriff und Aufgabe der Materialdisposition
1.1.1. Begriffserklärung stochastische Disposition
Das Wort Stochastik stammt aus dem griechischen und steht für eine an der Wahrscheinlichkeit orientierte Betrachtungsweise in den Naturwissenschaften und in der Statistik, welche besagt, daß bei Massenerscheinungen Aussagen nicht ganz exakt gemacht werden können, sondern nur unter Berücksichtigung gewisser zufälliger Abweichungen vom empirisch ermittelten Mittelwert. Die zeitliche Entwicklung einer Zufallsgröße nennt man eine Zufallsfunktion oder einen stochastischen Prozess.[1]
Der Begriff der Disposition hat seinen Ursprung im Lateinischen und bedeutet die Verfügung über die Verwendung oder den Einsatz einer Sache, in diesem Falle des Materials.[2] Etwas verkürzt wird oft auch nur vom „sinnvollen Verfügen“ gesprochen. Aus heutigen Gesichtspunkten sind in der Materialdisposition die Tätigkeiten zu verstehen, die notwendig sind, um den Markt oder den Betrieb als Verbraucher mit den erforderlichen Einsatzstoffen oder Handelswaren nach Art und Menge termingerecht zu versorgen. Hinzu kommt die Vorgabe, sowohl Kosten als auch Kapitalbindung möglichst niedrig zu halten. [3]
Unter Berücksichtigung dieser Aufgabenstellung ist der Zielkonflikt vorprogrammiert. Eine sichere Versorgung der Produktion unter Mithilfe hoher Lagerbestände hat neben hohen Kapitalbindungskosten auch erhöhte Lagerhaltungskosten zur Folge. Andersherum können knapp kalkulierte Lagerbestände zu Produktionsausfällen führen, welche die gesenkten Kosten der Lagerhaltung nicht nur schnell kompensieren, sondern innerhalb kürzester Zeit in einen gegenteiligen Effekt umwandeln, der die Kosten eines größeren Lagerbestandes um ein vielfaches übersteigt.
Je nach Material sind die Anforderungen an die Disposition unterschiedlich, gerade aus eben genannten Gesichtspunkten. Um eine sinnvolle Disposition gewährleisten zu können ist eine Klassifizierung der verschiedenen Materialien nahezu unumgänglich. Hierzu bedient man sich der ABC- und XYZ-Analyse.
1.2. ABC- und XYZ-Analyse
Mit Hilfe der ABC-Analyse werden die Materialien in Höhe ihrer Verbrauchswerte klassifiziert. Der Mengenverbrauch pro Periode multipliziert mit den Stückkosten ergibt den Periodenverbrauch, nachdem geordnet wird. Werte aus Praxis haben ergeben, daß A-Güter mit ca. 20% Mengenanteil zwischen 60%-70% des Wertanteils ausmachen.
Bei der XYZ-Analyse werden die Materialien nach der Vorhersagegenauigkeit ihres Verbrauches klassifiziert. X-Güter haben nahezu konstante Bedarfsverläufe und folglich eine hohe Vorhersagegenauigkeit.
Dagegen besitzen Z-Güter nahezu keine Vorhersagegenauigkeit, da sie starken Schwankungen unterliegen. Y-Güter haben ebenfalls schwankende Bedarfsverläufe, diese sind jedoch trendförmig oder saisonal und bieten somit zumindest ein gewisses Maß an Vorhersagegenauigkeit.
1.3. Programm- oder verbrauchsorientierte Disposition?
Der programmorientierte Ansatz ist in der Hinsicht der Richtige, da durch die mengen- und termingenaue Planung die Kapitalbindungs- und Lagerhaltungskosten niedrig gehalten werden. Da dieser deterministische Ansatz jedoch zeit- und kostenintensiv ist, kann von einer optimalen Lösung über alle Güter hinweg nicht gesprochen werden.
Der verbrauchsorientierte Ansatz ist dagegen weniger zeit und kostenintensiv, verursacht aber höhere Lagerhaltungskosten.
Aus diesen Gründen werden in der Praxis bei verschiedenen Gütern auch verschiedene Dispositionsarten verwendet.
Für 70%-80% des Sortiments (B- und C-Güter) wäre die programmbezogene Bedarfsrechnung zu aufwändig.[4] Daher wird die verbrauchsorientierte Disposition vor allem bei B-Gütern und Tertiärbedarf (Betriebsstoffe, evtl. Hilfsstoffe und C-Artikel) angewendet.
Nachfolgend eine tabellarische Darstellung der gängigen Dispositionsarten in Abhängigkeit von der ABC-XYZ-Analyse.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1 Dispositionsarten in Abhängigkeit von der ABC-XYZ-Analyse; in Anlehnung an: Zahn/Schmid, Produktionswirtschaft, 1996, S.337
2. Materialdisposition in SAP R/3
2.1. Eingliederung der stochastischen Disposition in SAP R/3
Im folgenden Kapitel wird geklärt, wie die stochastische Disposition in SAP R/3 im Bereich der gesamten Materialdisposition einzugliedern ist. Dieses Kapitel wurde hauptsächlich mit Hilfe der SAP-Bibliothek stellt, erweitert um ergänzende Literatur. Im Vorfeld dieses Kapitels ist klarzustellen, daß sich die Eingliederung und Beschreibung der Materialdisposition in SAP R/3 von der klassischen Betriebswirtschaftslehre kaum erwähnenswert unterscheidet. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel auf eine vergleichende Gegenüberstellung verzichtet. Auftretende Unterschiede werden im einzelnen aufgeführt.
Zum besseren Verständnis wird mit einer grafischen Darstellung (Abb. 1) begonnen, die aufzeigt, wie SAP R/3 das Thema der stochastischen Disposition im Bereich der Dispositionsverfahren integriert wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Dispositionsverfahren (nach Wenzel, Logistik mit SAP R/3, 2001, S.98)
2.2. Plangesteuerte Disposition
Wie in Abbildung1 ersichtlich wird auf der ersten Ebene zwischen den verbrauchsgesteuerten Verfahren und einem deterministischen Verfahren unterschieden, welches in der plangesteuerten Materialdisposition mündet. Voraussetzung für dieses Verfahren ist zum einen, daß der Primärbedarf mit Mengen und Terminen vorliegt. Zum anderen ist es erforderlich, daß die verfügbaren Bestände abrufbar sind, um somit den Nettobedarf ermitteln zu können.
Anhand von Produktionsplänen, dem Primärbedarf der Zukunft, und Kundenaufträgen wird der termin- und mengengerechte Sekundärbedarf errechnet. Diese sogenannte Bruttobedarfsrechnung wird zur Nettobedarfsrechnung, sobald Lager- und Auftragsbestände vom errechneten Bruttobedarf abgezogen werden.
Die deterministische Disposition kommt meist dann zum Einsatz, wenn die Ausgangsmaterialien einen hohen Wert besitzen (A-Güter) und die Bedarfe starken Schwankungen unterliegen. Ergänzend hierzu kommt der Wunsch nach niedrigen Lagerbeständen hinzu, um somit geringere Lagerhaltungskosten realisieren zu können.
2.3. Verbrauchsgesteuerte Disposition
Bei verbrauchsgesteuerten Dispositionsverfahren wird der Bedarf anhand von Verbrauchswerten aus der Vergangenheit ermittelt. Daten der Zukunft wie Aufträge, Produktions- und Absatzprogramme haben bei diesen Verfahren, im Gegensatz zur deterministischen Disposition, keinen Einfluß auf die Bedarfsermittlung.
Als Voraussetzung für die verbrauchsgesteuerten Verfahren ist eine Kopplung an die Lagerbestände notwendig. Denn zum einen kann der Lagerbestand einen Bestellvorschlag auslösen, zum anderen kann der aktuelle Lagerbestand eine entscheidende Größe im Hinblick auf die Bestellmenge einnehmen.
Innerhalb dieser verbrauchsgesteuerten Disposition gibt es drei Hauptverfahren, die im folgenden erläutert werden. Auch Mischformen verschiedener Verfahren sind sowohl in der Literatur als auch in der Praxis vorzufinden.
2.4. Bestellpunktdisposition
Die Bestellpunktdisposition arbeitet mit Hilfe eines Meldebestandes. Dieser Meldebestand setzt sich aus einem Sicherheitsbestand und dem durchschnittlichen Materialbedarf der Wiederbeschaffungszeit zusammen.
Unterschreitet der verfügbare Bestand den Meldebestand wird ein Bestellvorschlag ausgelöst. Bei dieser Methode wird weiter nach maschineller oder manueller Bestellpunktdisposition unterschieden. Im manuellen Fall wird der Meldebestand durch den Disponenten festgelegt. Größen wie Wiederbeschaffungszeit und Termintreue des Lieferanten spielen bei der Festlegung des Meldebestandes (inkl. Sicherheitsbestand) eine tragende Rolle.
Bei der maschinellen Bestellpunktrechnung werden Sicherheits- und Meldebestand durch das System über Prognosemodelle ermittelt und im Materialstammsatz hinterlegt. Als Ergebnis solcher Prognosen können auch Änderungen des Meldebestandes die Folge sein.
Die Bestellmenge wird mit Hilfe verschiedener Losgrößenverfahren ermittelt, welche in Kapitel 5 näher beschrieben werden.
2.5. Stochastische Disposition
Dieses Thema wird hier nur kurz angerissen, da die folgenden Kapitel sich ausschließlich mit der stochastischen Disposition befassen. Dort werden unter anderem auch die verschiedenen Prognosemodelle sowie Losgrößenverfahren erklärt. Diese Art der Disposition bedient sich ebenfalls Prognosewerten. Doch im Gegensatz zur Bestellpunktdisposition fließen die Ergebnisse direkt in die Materialdisposition ein, und dienen nicht zur Berechnung des Meldebestandes (Ein Meldebestand existiert in der stochastischen Disposition nicht). Grundlagen dieser Prognosen sind verbrauchswerte aus der Vergangenheit. Mit Hilfe von verschiedener Prognosemodellen wird in regelmäßigen Abständen der erwartete Bedarf für die nächste Periode berechnet. Anhand dieser Werte wird die Nettobedarfsrechnung durchgeführt. Ist hierbei der prognostizierte Bedarf größer als der tatsächliche Lagerbestand wird ein Bestellvorschlag ausgelöst.
Die ausgewiesene Menge im Bestellvorschlag wird mit Hilfe des gewählten Losgrößenverfahrens errechnet.
2.6. Rhythmische Disposition
Im Gegensatz zum Bestellpunktverfahren wird der Bestellvorschlag nicht durch die Unterscheitung des Meldebestandes ausgelöst, sondern durch eine regelmäßige Überprüfung des Bestandes, aus dem dann ein Bestellvorschlag erzeugt wird, falls im Überprüfungszeitraum Material verbraucht wurde. Dabei ist die Bestellmenge die Differenz zwischen tatsächlichem Bestand und der definierten Bestellgrenze. Diese Bestellgrenze richtet sich einerseits nach dem durchschnittlichen Bedarf im Überprüfungsintervall, andererseits nach der Wiederbeschaffungszeit und einem Sicherheitsbestand.
Vorteil dieses Verfahren ist eindeutig, daß durch die Regelmäßigkeit der Bestellung, und folglich auch Lieferung, Lieferterminverzögerungen oder andere Probleme des Bestellablaufes reduziert werden können. Oft ist dieses Verfahren auch durch den Lieferanten bedingt, welcher beispielsweise nur an einem Wochentag liefert. Das Überprüfungsintervall ist somit eine Woche und der Tag der Überprüfung kann über die Wiederbeschaffungszeit retrograd errechnet werden.
In der Praxis findet man auch Mischformen aus Bestellpunkt- und Bestellrhythmusverfahren. Hierzu bedient man sich den Vorteilen aus beiden Verfahren. Man verbindet beispielsweise eine regelmäßige Überprüfung mit einem Meldebestand. Eine Bestellgrenze ist ebenfalls definiert. Somit wird nicht automatisch bei einem Materialverbrauch ein Bestellvorschlag ausgelöst. Dies ist bei schwankenden Materialverbrauch von Vorteil, da geringe Verbräuche keine geringen Bestellmengen nach sich ziehen.
2.7. Allgemeine Parameter der Materialdisposition
Die in SAP als „allgemeinen Parameter“ bezeichneten Kenngrößen werden im Materialstammsatz hinterlegt. Sie können beim Anlegen eines Materialstammsatzes eingestellt oder nachträglich im Stammsatz geändert werden. Die Bezeichnung
„allgemein“ kommt daher, daß diese einzustellenden Parameter weder vom Dispositionsverfahren noch vom Lösgrößenverfahren abhängig sind. Im folgenden werden die einzelnen „allgemeinen Parameter“ beschrieben und die jeweiligen Sichten, in denen diese Parameter einzustellen sind, genannt. Der Großteil dieser Kennzeichen kann eingestellt, bei einigen Wenigen ist dies zwingend erforderlich. Die Reihenfolge richtet sich nach den Dispositionssichten, in der denen die jeweiligen Parameter einzustellen sind.
Folgende Parameter sind in der Dispositionssicht 1 vorzufinden:
Dispositionsgruppe:
Die Dispositionsgruppe fasst verschiedene Materialien aus der Sicht der Disposition zusammen; somit können den Materialien spezielle Steuerungsparameter für den Planablauf zugeordnet werden. Die Dispositionsgruppe wird im Customizing definiert und mit Steuerungsparametern versehen.
Disponent:
Dies ist ein Schlüssel für einen Disponenten (oder eine Gruppe von Disponenten), der (die) für die Disposition eines Materials zuständig ist. Mit Hilfe dieses Schlüssels können im späteren Verlauf auch Dispositionsauswertungen vollzogen werden.
Einkäufergruppe:
Mit diesem Schlüssel wird dem Material ein Einkäufer (Eine Gruppe von Einkäufern) zugeordnet (vgl. Disponent), der (die) im Folgendem für den Einkauf des jeweiligen Materials zuständig ist. Hiermit ist es möglich, bei einem Planungslauf die Bestellvorschläge fremdbeschaffter Materialien gleich der passenden Einkäufergruppe zuzuordnen.
ABC-Kennzeichen:
Im Anschluss an eine ABC-Analyse, welche auch maschinell ermittelt werden kann, wird das Material mit Hilfe dieses Parameters nach dessen Verbrauchswert klassifiziert. Dieses Kennzeichen dient zum Beispiel im Logistik-Controlling zu Auswertungszwecken verwendet werden.
In der Dispositionssicht 2 können die nachfolgenden Parameter eingestellt werden.
Beschaffungsart:
Die Beschaffungsart ist ein zwingend einzustellender Parameter. Das System schlägt anhand der zuvor festgelegten Materialart eine Beschaffungsart vor, diese ist jedoch überschreibbar. Somit kann festgelegt werden, ob das Material eigengefertigt oder fremdbezogen werden soll. Ist für eine ein bestimmtes Material sowohl Eigenfertigung und Fremdbeschaffung möglich, kann dies ebenfalls über das entsprechende Kennzeichen festgelegt werden.
Sonderbeschaffung:
Die Sonderbeschaffung knüpft an die Beschaffungsart an, um die zuvor zwingend definierte Beschaffungsart genauer festzulegen. Es ist hier beispielsweise möglich, bei der Fremdbeschaffung die Beschaffung über Konsignationsbestellungen abzuwickeln.
Reichweitenprofil:
Das Reichweitenprofil legt Parameter zur Bestimmung des dynamischen Sicherheitsbestandes fest. Mit diesem dynamischen Sicherheitsbestand ist es möglich, einen zusätzlichen Sicherheitsbestand einzuplanen, welcher sich am durchschnittlichen Tagesbedarf orientiert und in voller Höhe dispositiv verfügbar ist. Errechnet wird der dynamische Sicherheitsbestand durch die Formel Durchschnittlicher Tagesbedarf * Reichweite.
Im Customizing der Bedarfsplanung kann das Reichweitenprofil definiert werden, indem man die Parameter für die Reichweiten sowie die Berechnung des durchschnittlichen Bedarfes festlegt.
In der Sicht Disposition 3 können folgende allgemeine Parameter festgelegt werden:
Verfügbarkeitsprüfung:
Dieser Parameter ist neben der Beschaffungsart das einzige zwingend einzustellende Kennzeichen. Mit Hilfe dieses Kennzeichens kann festgelegt werden, ob Kundenaufträge zu einem Einzel- oder Sammelbedarf für die Disposition führen. Des weiteren wird durch diesen Parameter festgelegt, wie die Verfügbarkeitsprüfung für ein Material durch das System durchgeführt werden soll. Im übrigen steuert dieses Kennzeichen, inwiefern Dispositionselemente wie zum Beispiel Bestellungen oder Reservierungen bei der Verfügbarkeitsprüfung durch das System berücksichtigt werden sollen.
Gesamtwiederbeschaffungszeit:
Hierbei wird die Zeit festgelegt, welche für die Fertigung und Beschaffung eines Enderzeugnisses oder einer Baugruppe benötigt wird. Dieser Wert resultiert aus Schätzungen und wird für die Verfügbarkeitsprüfung verwendet.
Mischdisposition:
Das entsprechende Kennzeichen muss gesetzt werden, um die Baugruppenplanung, Bruttoplanung oder die Duale Planung für ein Material durchzuführen.
In der Sicht Disposition 4 kann nur ein allgemeiner Parameter eingestellt werden, der
Einzel-/Sammelbedarf:
Dieses Kennzeichen regelt, ob für den Sekundärbedarf eine Kundeneinzelplanung zulässig ist. Bei dem Kennzeichen für Einzelbedarf weist das System im Falle der Einzelplanung der übergeordneten Stufe die Bedarfsmengen einzeln aus. Im Falle des Sammelbedarfes werden die Sekundärbedarfsmengen der Komponenten zusammengefasst.
3. Bedarfsprognose
Das folgende Kapitel stellt die Grundlagen der stochastischen Prognose dar, sowie die Vorgehensweise innerhalb des SAP-Systems. Es werden u.a. die verschieden Verbrauchsverläufe und Prognosemodelle, die nötigen Vorgaben im Materialstamm sowie die verschiedenen Möglichkeiten der Prognosedurchführung in SAP R/3 beschrieben.
3.1. Prognoseparameter
Die Prognoseparameter sind im Materialstamm unter Prognose hinterlegt. Die wichtigsten vom Prognosemodell unabhängigen Parameter sind:
- Periodenkennzeichen, das angibt, in welchem Zeitabständen das System Prognose- und Verbrauchswerte speichert.
- Anzahl Vergangenheitswerte. Dieser Parameter legt fest, wie viele Perioden das System bei der Prognose berücksichtigt.
- Prognoseperioden. Durch die Anzahl der Prognoseperioden wird bestimmt, für wie viele Perioden das System Prognosewerte ermittelt.
Darüber hinaus gibt es einige vom gewählten Prognosemodell abhängige Parameter, wie Glättungsfaktoren, Saisonindizes, auf die im Rahmen dieser Studienarbeit nicht weiter eingegangen werden kann.
3.2. Prognosemodelle
3.2.1. Verbrauchsverläufe
Der Bedarfs- und Verbrauchsverlauf über mehrere Perioden in der Vergangenheit kann erheblich differieren, und damit auch die Prognostizierbarkeit der zukünftigen Bedarfe. Als Verbrauchsstrukturen können unterschieden werden:
- Konstanter Verbrauch
- Trendförmiger Verbrauch
- Saisonaler Verbrauch
- Trend-Saisonaler Verbrauch
- Unregelmäßiger Verbrauch
Die Verbrauchsverläufe sind in Abbildung 2 grafisch dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 Verbrauchsverläufe, in Anlehnung an: Zahn/Schmid, Produktionswirtschaft, 1996, S.336
3.2.2. Prognosemodelle
Auf Grund der unterschiedlichen Charakteristika der Verbrauchsmodelle werden verschiedene Methoden zur Prognose verwendet:
- Modell des gleitenden Mittelwerts
Erfolgt die Bedarfsvorhersage auf der Grundlage einer gleitenden Mittelwertbildung, kann der Einfluss weit zurückliegender Verbrauchsdaten ausgeschaltet werden. Dies wird erreicht, indem die Zahl der berücksichtigten Verbrauchsmengen konstant gehalten und das arithmetische Mittel der jeweils betrachteten, letzten Perioden gebildet wird.[5]
[...]
[1] vgl. Bertelsmann Lexikon Band 9, 1976, S.254
[2] vgl. Müller, Fremdwörter, 1982, S.191
[3] vgl. Hartmann, Materialwirtschaft, 1993, S.223,
[4] vgl. Arnolds, Materialwirtschaft, 1996, S.95
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Materialdisposition und welche Aufgabe hat sie?
Die Materialdisposition ist die Verfügung über die Verwendung oder den Einsatz von Material, um den Markt oder den Betrieb termingerecht mit den erforderlichen Einsatzstoffen oder Handelswaren zu versorgen. Ziel ist es, Kosten und Kapitalbindung möglichst niedrig zu halten.
Was bedeutet stochastische Disposition?
Stochastische Disposition bezieht sich auf eine an der Wahrscheinlichkeit orientierte Betrachtungsweise bei der Materialdisposition, die zufällige Abweichungen vom empirisch ermittelten Mittelwert berücksichtigt.
Was sind ABC- und XYZ-Analyse und wozu dienen sie?
Die ABC-Analyse klassifiziert Materialien nach ihrem Verbrauchswert (Menge multipliziert mit Stückkosten). A-Güter machen ca. 60-70% des Wertanteils aus, aber nur ca. 20% der Menge. Die XYZ-Analyse klassifiziert Materialien nach der Vorhersagegenauigkeit ihres Verbrauchs. X-Güter haben konstante Bedarfsverläufe, Z-Güter starke Schwankungen.
Was ist der Unterschied zwischen programm- und verbrauchsorientierter Disposition?
Die programmorientierte Disposition plant mengen- und termingerecht, um Kapitalbindung und Lagerhaltungskosten niedrig zu halten. Sie ist zeit- und kostenintensiv. Die verbrauchsorientierte Disposition ermittelt den Bedarf anhand von Verbrauchswerten aus der Vergangenheit und verursacht höhere Lagerhaltungskosten, ist aber weniger zeit- und kostenintensiv.
Wie ist die stochastische Disposition in SAP R/3 integriert?
<Die stochastische Disposition ist in SAP R/3 als Teil der verbrauchsgesteuerten Dispositionsverfahren integriert, neben der Bestellpunktdisposition und der rhythmischen Disposition. Sie nutzt Prognosewerte zur Ermittlung des Bedarfs.
Was ist plangesteuerte Disposition?
Die plangesteuerte Disposition ist ein deterministisches Verfahren, das Produktionspläne und Kundenaufträge nutzt, um den Sekundärbedarf zu ermitteln. Lager- und Auftragsbestände werden vom Bruttobedarf abgezogen, um den Nettobedarf zu berechnen.
Was ist Bestellpunktdisposition?
Die Bestellpunktdisposition arbeitet mit einem Meldebestand, der sich aus Sicherheitsbestand und dem durchschnittlichen Bedarf der Wiederbeschaffungszeit zusammensetzt. Unterschreitet der verfügbare Bestand den Meldebestand, wird ein Bestellvorschlag ausgelöst.
Was ist rhythmische Disposition?
Bei der rhythmischen Disposition wird der Bestand in regelmäßigen Abständen überprüft, und ein Bestellvorschlag wird erzeugt, wenn im Überprüfungszeitraum Material verbraucht wurde. Die Bestellmenge ist die Differenz zwischen tatsächlichem Bestand und einer definierten Bestellgrenze.
Welche allgemeinen Parameter der Materialdisposition gibt es in SAP R/3?
Allgemeine Parameter umfassen Dispositionsgruppe, Disponent, Einkäufergruppe, ABC-Kennzeichen, Beschaffungsart, Sonderbeschaffung, Reichweitenprofil, Verfügbarkeitsprüfung, Gesamtwiederbeschaffungszeit und Einzel-/Sammelbedarf. Diese Parameter werden im Materialstammsatz hinterlegt.
Welche Prognoseparameter gibt es?
Wichtige Prognoseparameter sind Periodenkennzeichen, Anzahl Vergangenheitswerte und Prognoseperioden. Es gibt auch Prognosemodell abhängige Parameter.
Welche Verbrauchsverläufe gibt es?
Verschiedene Verbrauchsverläufe sind konstanter Verbrauch, trendförmiger Verbrauch, saisonaler Verbrauch, trend-saisonaler Verbrauch und unregelmäßiger Verbrauch.
Welche Prognosemodelle gibt es?
Verschiedene Prognosemodelle sind das Modell des gleitenden Mittelwerts.
Was ist eine Dispositionsliste?
Wird im Text noch näher definiert.
Was ist eine Bedarfs-/Bestandsliste?
Wird im Text noch näher definiert.
Was sind Planaufträge?
Wird im Text noch näher definiert.
- Quote paper
- Martin Wagner (Author), Klemm Jochen (Author), Quell Jochen (Author), Weiss Andreas (Author), 2002, Stochastische Disposition (Prognose und Bedarfsplanung) in SAP R/3, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108007