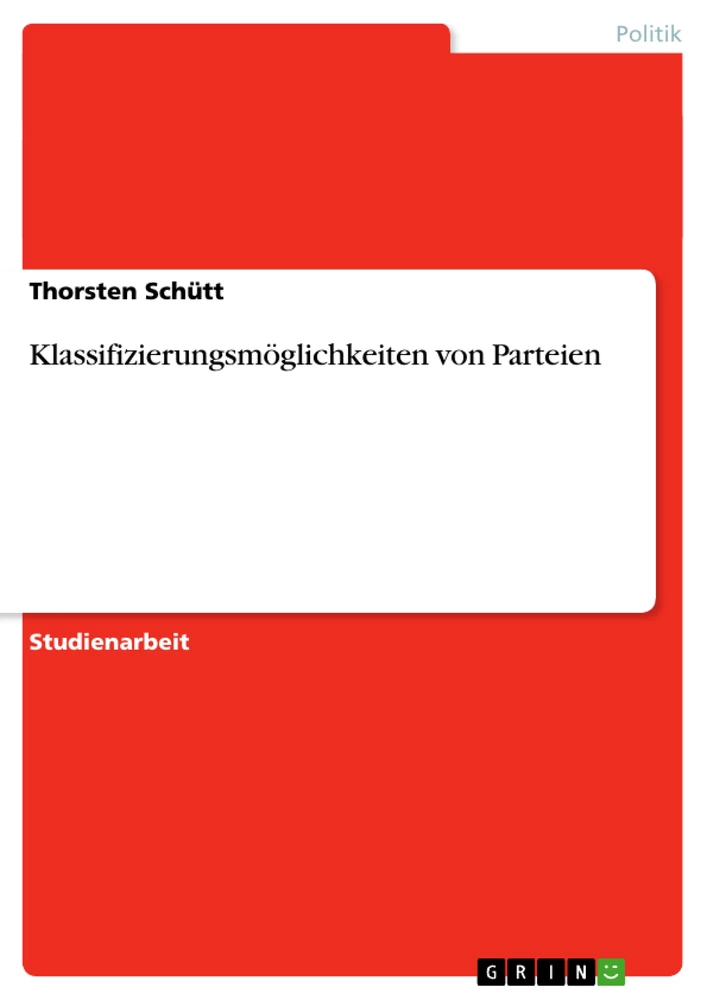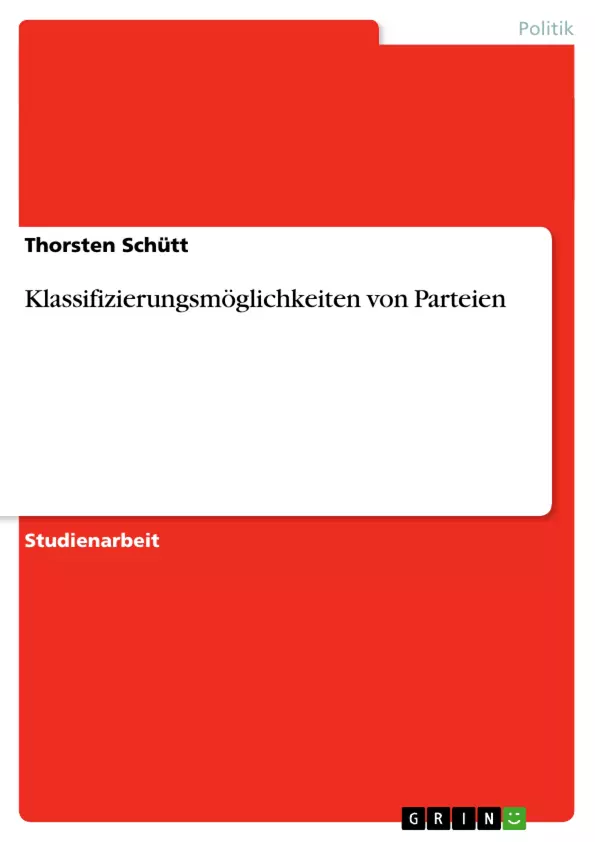Inhaltsverzeichnis:
1 Einleitung
2 Klassifizierung – aber wie?
2.1 Partei – was ist das?
3 Möglichkeiten der Klassifizierung
3.1 Organisatorische Typisierung – Parteienklassifizierung nach Duverger
3.2 Inhaltliche Typisierung
3.3 Entwicklungstypisierung – Parteienklassifizierung durch „Verschlagwortung“
4 Organigramm zur Parteienklassifizierung
5 Fazit
6 Quellen
6.1 weiterführende Literatur
1 Einleitung
Beim Verfassen von wissenschaftlichen Hausarbeiten sollte immer auch die Frage nach dem Sinn – jenem Sinn, der über den reinen Übungscharakter der Arbeit hinausgeht – gestellt werden.
Warum also erscheint es sinnvoll ausgerechnet Parteien zu klassifizieren bzw. nach Möglichkeiten zur Klassifizierung von Parteien zu suchen?
Auch wenn das Gebiet der empirischen Parteienforschung in den vergangenen Jahrzehnten einen regelrechten Boom erlebt hat, so blieb die theoretische Parteienforschung, zu der die Klassifizierung und Typisierung von Parteien mitgezählt werden kann, eher im Schatten des wissenschaftlichen Interesses. Nach Helms[1] entstanden vor allem Partei- und Parteisystemsanalysen und weniger (weil aufwendiger und weniger prestigeträchtig?) Arbeiten zur Parteientheorie bzw. Arbeiten zum allgemeinen Parteienvergleich.
Mit dieser Hausarbeit möchte ich eine „kleine Lanze“ für die „Fußarbeit“ der Parteienanalyse und Parteienforschung brechen: Für die Klassifizierungsmöglichkeiten von Parteien.
Klassifizierung bedeutet immer auch eine Verkürzung und eine Idealisierung von Zuständen, in diesem Fall von Parteien. Dies kann nur durch Betonung einiger Merkmale bei gleichzeitiger Auslassung von anderen Merkmalen geschehen[2]. Ergebnis ist dann ein verfremdetes bzw. ein unvollständiges oder auch idealisiertes Bild des Gegenstandes. Hierdurch wird eine bessere und leichtere Übersicht auf Kosten der Exaktheit erreicht. Damit bewegt sich die Parteienklassifizierung zwischen der Komparatistik und einer normativ-deskriptiven Analyse.
2 Klassifizierung – aber wie?
Die Feststellung, dass Parteien sich klassifizieren lassen, somit eine heterogene Menge darstellen, ist Grundvoraussetzung für die den Versuch der Typisierung. Wie bei den meisten wissenschaftlichen Arbeiten steckt der so genannte „Teufel“ aber wie üblich im Detail. Nicht erst die Einordnung in die verschiedene n Klassen, sondern bereits die Auswahl dieser stellt ein erstes, aber lösbares Problem dar. Denn die Auswahl der Klassifizierungskriterien sowie des Klassifizierungsschwerpunktes[3] bestimmt bereits, wenn nicht das Ergebnis, so doch auf jeden Fall die Richtung der Aussage.
Einführen möchte ich an dieser Stelle drei verschiedene Möglichkeiten zur Typisierung: Den investigativen-, den komparativen- sowie den Identifikationsansatz. Während der investigative Ansatz mit Hilfe einer Aststruktur eine eindeutige Identifizierung einer Partei über das Einschluss/Ausschluss-Prinzip versucht, stellt der komparative Ansatz im Allgemeinen zwei Parteitypisierungen gegenüber und führt die Gegensätzlichkeiten bzw. Gemeinsamkeiten aus . Beim Identifikationsansatz geht es vor allem um die Beschreibung – auch und vor allem um die Neubeschreibung – von Parteitypen. Dieser Ansatz eignet sich sehr gut zur Beschreibung von (evolutionären) Entwicklungen von Parteien und findet häufig in Arbeiten zur Parteientheorie Anwendung. Während die beiden letztgenannten Typisierungsmöglichkeiten bereits Eingang in die Politikwissenshaften gefunden haben, konnte ich keine Beispiele für eine aktuelle Verwendung des investigativen Ansatzes finden. Im Rahmen dieser Hausarbeit möchte ich die Möglichkeit einer solchen Typisierung vorstellen. Eine Bewertung der Tauglichkeit möchte ich anderen überlassen.
2.1 Partei – was ist das?
Was genau ist überhaupt eine Partei? Der Begriff der Partei bezieht sich nicht unbedingt immer auf die politische Partei. So existiert auch der Begriff der juristischen Partei, der Kriegspartei, der Konfliktpartei sowie weiterer.
Damit liegt eine erste Definition vor:
Eine Partei ist eine Interessensvertretung für mindestens eine Person von mindestens einer Person[4].
Bezogen auf politische Parteien führt das Kleine Lexikon der Politik aus:
„Partei meint im allgemeinsten Begriffsverständnis eine Gruppe gleichgesinnter Bürger, die sich die Durchsetzung gemeinsamer polit. Vorstellungen zum Ziel gesetzt haben.“[5]
Darauf aufbauend stellte Greven 1993 fest: „Parteien sind Zusammenschlüsse von Gesellschaftsmitgliedern in unterschiedlicher organisatorischer Form zum Zweck der Interessenvertretung und Beeinflussung der politischen Willensbildung eines Systems. Ihre Gestalt, wie auch ihre Handlungs- und Ausdrucksmöglichkeiten werden durch gesellschaftliche und institutionelle Verhältnisse sowie den Charakter des jeweiligen politischen Systems bestimmt, sie wirken umgekehrt auf diese zurück.“
3 Möglichkeiten der Klassifizierung
Wie bereits zuvor erwähnt schränkt die Wahl der Klassifizierungskriterien das Ergebnis der Untersuchung bzw. Beschreibung ein. Entscheidend ist der Blick auf ein bestimmendes Detail von Parteien. So finden sich in den Politikwissenschaften Klassifizierungsansätze die sich an der Organisationsform, an den Mitgliedern, an den Zielen oder auch der Struktur orientieren bzw. diese als Unterscheidungsmerkmal nutzen. Diese Unterscheidungsmerkmale können immer wieder erneuert, verfeinert, erweitert oder aber auch weiter gefasst werden. Entscheidend ist die Feststellung, dass die Klassifizierung von Parteien immer in einem Kontext geschieht: zumeist in einem zeitlichen Kontext.
3.1 Organisatorische Typisierung – Parteienklassifizierung nach Duverger
Von vielen Politikwissenschaftlern wird die Arbeit von Maurice Duverger6 geradezu in den Rang eines „Klassikers“ der Parteienforschung und Parteientheorie gehoben. Duverger setzte den Schwerpunkt seiner Betrachtungen auf die Grundorganisation der (politischen) Partei. Er unterscheidet zwischen der Komiteepartei, der Ortsgruppenpartei, der Zellenpartei sowie der Milizpartei. Letztere besteht, nach seiner Betrachtung, aus „Kampfeinheiten“. Eine solche Partei besitzt eine paramilitärische Organisationsform. Inhalt und Struktur sind auf Indoktrination und Disziplin bzw. Disziplinierung der Mitglieder ausgerichtet. Diese Parteiform soll „Angst und Schrecken nach außen verbreiten“. Beispiele sind die faschistischen Parteien in Deutschland und Italien7. Eine Zellenpartei definiert Duverger als eine Partei, die Ihre Mitglieder in kleinere Gruppen organisiert und die zumeist stark konspirativ arbeitet. Die Organisation erfolgt an sozialen Orten wie dem Arbeitsplatz oder einem an sich unpolitischen Ort, etwa Orte zur Freizeitgestaltung. Beispiele hierfür sind vor allem kommunistische Kaderparteien. Als Ortsgruppenpartei definiert er eine Partei, deren Mitglieder aufgrund ihrer geographischen Nähe zueinander (vor allem Wohnortsnähe, weniger Arbeitsplatznähe) Parteiarbeit gemeinsam organisieren. Dies geschieht zu definierten Zeiten in definierten Räumlichkeiten (Lokal oder auch Parteibüro). Die Parteiarbeit geht über die reine Kandidatenauswahl und die reine Wahlkampfvorbereitung hinaus. Es gibt eine feste auf Dauer ausgelegte Organisationsstruktur, bezahlte Mitarbeiter der Partei und die Finanzierung erfolgt vornehmlich durch Mitgliederbeiträge.
[...]
[1] Ludger Helms, Die „Kartellparteien“-These und ihre Kritiker, S. 698- 708
[2] Vgl. Kleines Lexikon der Politik, Stichwort: Parteitypen, S. 361
[3] Im Folgenden werde ich noch auf die Unterscheidungen zwischen inhaltlichen, strukturellen, organisatorischen und sonstigen Unterscheidungsmöglichkeiten eingehen.
[4] Erste eigene Definition von Partei
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument zur Parteienklassifizierung?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es handelt sich um eine akademische Analyse verschiedener Möglichkeiten der Parteienklassifizierung, unter Berücksichtigung unterschiedlicher theoretischer Ansätze.
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Die Hauptthemen umfassen die Notwendigkeit und den Sinn der Parteienklassifizierung, verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten (organisatorisch, inhaltlich, entwicklungsbezogen), die Definition des Begriffs "Partei" und die Vorstellung verschiedener Typisierungsansätze (investigativ, komparativ, identifikationsbezogen). Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und Möglichkeiten der Kategorisierung von Parteien.
Welche Klassifizierungsansätze werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt unter anderem die organisatorische Typisierung nach Duverger (Komiteepartei, Ortsgruppenpartei, Zellenpartei, Milizpartei). Es werden auch inhaltliche und entwicklungsbezogene Typisierungen angesprochen. Zudem wird ein investigativer Ansatz zur Parteientypisierung vorgestellt.
Was ist der investigative Ansatz zur Parteientypisierung?
Der investigative Ansatz versucht, eine Partei mithilfe einer Aststruktur und des Einschluss/Ausschluss-Prinzips eindeutig zu identifizieren. Es werden keine Beispiele für eine aktuelle Verwendung dieses Ansatzes in der Politikwissenschaft genannt.
Was versteht Duverger unter einer Milizpartei?
Duverger definiert eine Milizpartei als eine Partei, die aus "Kampfeinheiten" besteht und eine paramilitärische Organisationsform besitzt. Inhalt und Struktur sind auf Indoktrination und Disziplin der Mitglieder ausgerichtet.
Was ist die Bedeutung der Klassifizierung von Parteien?
Die Klassifizierung von Parteien ermöglicht eine bessere Übersicht und ein leichteres Verständnis von Parteienlandschaften, auch wenn dies auf Kosten der Exaktheit geht. Sie bewegt sich zwischen der Komparatistik und einer normativ-deskriptiven Analyse.
Welche Probleme können bei der Klassifizierung von Parteien auftreten?
Ein Problem ist die Auswahl der Klassifizierungskriterien, die das Ergebnis der Analyse beeinflusst. Die Klassifizierung ist immer eine Verkürzung und Idealisierung, da einige Merkmale betont und andere vernachlässigt werden.
Wie definiert das Dokument den Begriff "Partei"?
Das Dokument zitiert verschiedene Definitionen des Begriffs "Partei". Eine erste eigene Definition lautet: "Eine Partei ist eine Interessensvertretung für mindestens eine Person von mindestens einer Person". Weitere Definitionen stammen aus dem Kleinen Lexikon der Politik und von Greven.
Warum ist die theoretische Parteienforschung wichtig?
Obwohl die empirische Parteienforschung in den letzten Jahrzehnten einen Boom erlebt hat, möchte das Dokument die Bedeutung der theoretischen Parteienforschung, insbesondere der Klassifizierung und Typisierung von Parteien, hervorheben.
Was sind die Ziele dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit möchte einen Beitrag zur "Fußarbeit" der Parteienanalyse und Parteienforschung leisten, indem sie verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten von Parteien untersucht und vorstellt.
- Quote paper
- Thorsten Schütt (Author), 2003, Klassifizierungsmöglichkeiten von Parteien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107987