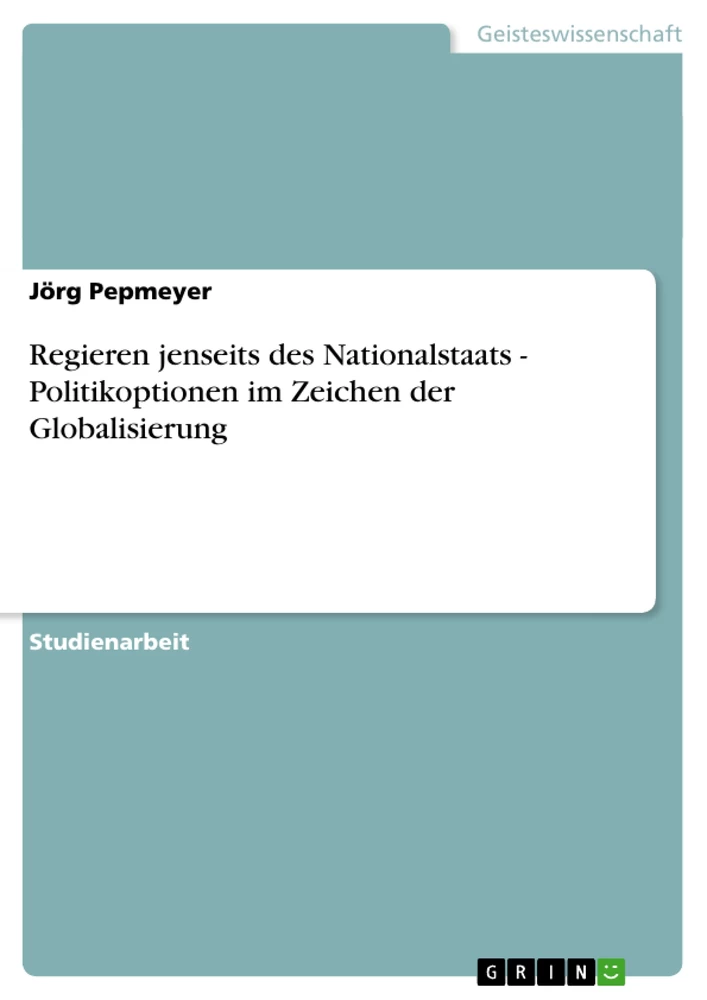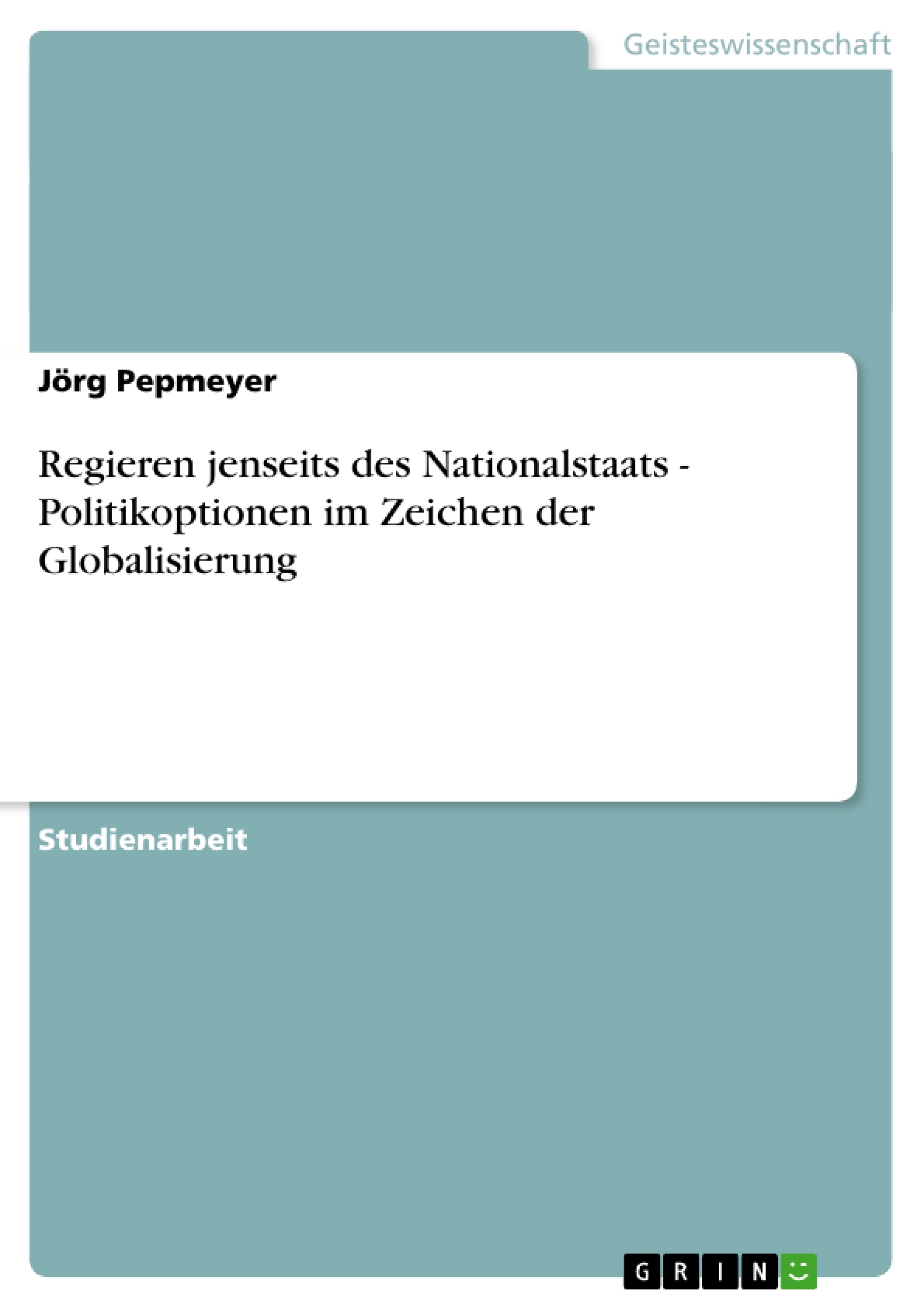Mit dem Schlagwort Globalisierung wird in der gesellschaftlichen Debatte nur allzuhäufig die ökonomische und soziale Dimension der weltweiten Arbeitsteilung und des weltumspannenden Güter- und Kapitaltransfers verstanden. Tatsächlich verbirgt sich hinter diesem Begriff jedoch weitaus mehr.
Vor allem der Einigungsprozeß der europäischen Staaten im Rahmen der EU hat zu einem riesigen Regel- und Gesetzeswerk geführt, das in einem großen Maß die nationalen Politiken der EU-Mitgliedsländer beeinflußt und im Einzelfall sogar das europäische Recht über das nationale Verfassungsrecht stellt.
Die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer stehen auch zukünftig vor einer weiteren Angleichung ihrer Rechts-, Sozial-, Finanz- und Wirtschaftssysteme. Dieser Harmonisierungsprozeß birgt jedoch nicht nur Vorteile sondern auch viele Risiken. In diesem Zusammenhang sollen in dieser Arbeit vor allem die Ausführungen von Michael Zürn genauer betrachtet werden. Michael Zürn hat in seinem Buch "Regieren jenseits des Nationalstaats" die Grundstrukturen einer neuen, global verstandenen Politik skizziert. In seinem Modell geht es sozusagen um die Konturen einer "Weltinnenpolitik". Eine Politik, in der nicht mehr die Nationalstaaten über wesentliche Bausteine ihrer Wirtschafts, Sozial- und Rechtspolitk entscheiden, sondern die globale Netzwerke transnationaler Beziehungen und Institutionen voraussetzt und die Bereitschaft nicht nur außen- und verteidigungspolitische Interessen abzustimmen, sondern auch weltweite Vereinbarungen und institutionelle Regelungen über die Schaffung gemeinsamer Sozial-, Wirtschafts-, und Rechtsstandards zu treffen.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel:
1. Einleitung
2. Globalisierung, Denationalisierung und Regieren
2.1 Globalisierung und Denationalisierung - Definition der Begrifflichkeiten
2.2 Der Prozeß der Denationalisierung
2.2.1 Probleme und Krisenerscheinungen im Denationalisierungsprozeß
2.2.2 Der demokratische Wohlfahrtsstaat und die Ziele des Regierens
2.2.3 Merkmale der Denationalisierung
2.2.4 Denationalisierungsprozeß und Ziele des Regierens
2.2.5 Die Gefahr der Fragmentierung
3. Die unterschiedlichen Formen des Regierens
3.1 Internationale Institutionen und "governance by, with or without government"
3.2 Die Rolle von Verhandlungen bei der Durchsetzung von internationalen Regelungen und Vereinbarungen
3.3 Die Handlungsgrenzen internationaler Organisationen
4. Ziele des "Komplexen Weltregierens"
4.1 Governance by, with and without government
4.2 Neukontextuierung des Nationalstaates
4.3 Komplexes Weltregieren versus Denationalisierung
5. Handlungsvorschläge im Sinne des "Komplexen Weltregierens"
5.1 Nationalstaat und soziale Gerechtigkeit
5.2 Internationale Institutionen und soziale Gerechtigkeit
5.3 Demokratisches Regieren
5.3.1 Demokratisierung der Entscheidungsprozesse und Öffnung der transnationalen Entscheidungsgremien
5.3.2 Stärkung der assoziativen Demokratie durch und mit deliberativen Netzwerken und Entscheidungsverfahren
5.3.3 Ausbau der direkt-deliberativen Demokratie auf lokaler Ebene
6. Chancen und Risiken des "Komplexen Weltregierens"
6.1 Sicherheit
6.2 Legitimität und Demokratie
6.3 Identität
6.4 Soziale Wohlfahrt
7. Resümee
8. Literatur
1. Einleitung
Mit dem Schlagwort Globalisierung wird in der gesellschaftlichen Debatte nur allzuhäufig die ökonomische und soziale Dimension der weltweiten Arbeitsteilung und des weltumspannenden Güter- und Kapitaltransfers verstanden. Tatsächlich verbirgt sich hinter diesem Begriff jedoch mehr.
Der Einigungsprozeß der europäischen Staaten im Rahmen der Europäischen Union hat beispielsweise zu einem riesigen Regel- und Gesetzeswerk geführt, das in einem großen Maß die nationale Politik der EU-Mitgliedsländer beeinflußt. Wie einschneidend das sein kann, beweist das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Klage deutscher Frauen, die den aktiven Dienst an der Waffe in der deutschen Bundeswehr ableisten wollen. Mit seinem Urteil hat der europäische Gerichtshof gegen die Bestimmungen des Grundgesetzes, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland entschieden. In diesem Fall wurde das europäische Recht über das nationale Verfassungsrecht gestellt.
Die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer stehen vor einer weitreichenden Angleichung ihrer Rechts-, Sozial-, und Wirtschaftssysteme. Diese Homogenisierung und Harmonisierung der nationalstaatlichen Rechts-, Sozial,- und Wirtschaftssysteme in der EU, ist zum einen Ergebnis des ökonomischen Drucks, also des Erhalts der Konkurrenzfähigkeit des europäischen Marktes gegenüber den USA und Japan bzw. Südostasien, aber er ist zum anderen von den politischen Entscheidungsträgern gewollt, die sich hiervon eine wichtigere Rolle Europas in der Weltökonomie und -politik versprechen.
Dieser Harmonisierungsprozeß birgt jedoch nicht nur Vorteile sondern auch viele Risiken.
Michael Zürn hat in seiner Arbeit "Regieren jenseits des Nationalstaats" die Grundstrukturen einer neuen, global verstandenen Politik skizziert. Seine Ausführungen sind nicht nur eine Betrachtung der Vorteile einer transnationalen Politik jenseits des Nationalstaats, sondern er beschäftigt sich auch mit den Gefahren und Risiken, die diese in sich birgt. In seinem Modell geht es sozusagen um die Konturen einer "Weltinnenpolitik". Eine Politik, in der nicht mehr die Nationalstaaten über wesentliche Bausteine ihrer Wirtschafts, Sozial- und Rechtspolitk entscheiden, sondern die globale Netzwerke transnationaler Beziehungen und Institutionen voraussetzt und die Bereitschaft nicht nur außen- und verteidigungspolitische Interessen abzustimmen, sondern auch weltweite Vereinbarungen und institutionelle Regelungen über die Schaffung gemeinsamer Sozial-, Wirtschafts-, und Rechtsstandards zu treffen.
2. Globalisierung, Denationalisierung und Regieren
2.1 Globalisierung und Denationalisierung - Definition der Begrifflichkeiten
Entscheidend für Zürns Ausführungen ist die Unterscheidung der verschiedenen Effekte, die auf die Nationalstaaten und ihre Politik einwirken. Zürn unterscheidet hierbei insbesondere die Begriffe "Denationalisierung" und "Globalsierung".
Denationaliserung ist als die immer stärker werdende Einbindung nationaler Sozial-, Wirtschafts-, und Rechtssysteme in größere Systeme, wie z.B. die EU, zu verstehen. Das bedeutet, daß der Handlungspielraum für nationalstaatliche Politik immer enger wird. Politische und wirtschaftliche Entscheidungen auf nationalstaatlicher Ebene können somit nicht mehr ohne den Bezug auf die Regelungen und Gesetzeswerke z.B. der EU und der Interessen ihrer Mitgliedsstaaten getroffen werden. Dies bedingt aber gleichzeitg einen immer stärker werdenden Bedarf an internationalen Institutionen und damit eine weiteres Schwinden nationalstaatlicher Souveränität. Der Prozeß der Denationaliserung wirkt sich gleichzeitig im Rahmen einer Durchdringung aller ökonomischen, gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Beziehungen in den Nationalstaaten aus, erfasst somit alle Dimensionen des gesellschaftlichen Lebens und der sozialen Handlungsräume.
Gesellschaftliche Denationalisierung erfolgt, wenn sich die verdichteten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Handlungszusammenhänge über die nationalstaatlich definierten Grenzen hinweg ausdehnen. Genauso wie die Ausdehnung sozialer Räume im 19 . Jahrhundert zur Auflösung dörflicher Gemeinschaften (gleichsam zur Nationalisierung) geführt hat, überschreiten die verdichteten Handlungszusammenhänge spätestens seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts in beschleunigter Form die nationalen Grenzen.
Globalisierung ist hingegen eher im Sinne eines weltweiten ökonomischen Zwangs zu einer Ausweitung und Verstärkung der internationalen Arbeitsteilung und Zusammenarbeit zu sehen, sowie des verstärkten Austauschs von Gütern, Waren, Geld und Dienstleistungen. Zwar wird auch hier der Bedarf z.B. an einheitlichen wirtschafts- und währungspolitischen Standards und der Herstellung der Rechtssicherheit für Investoren und der Schutz ihres Kapitals mittels konkreter vertraglicher Vereinbarungen (GATT, WTO, IWF etc.) wachsen, dennoch ist Globaliserung in diesem Sinne eher als ökonomisch determinierter Prozeß zu verstehen.
2.2 Der Prozeß der Denationalisierung
2.2.1 Probleme und Krisenerscheinungen im Denationalisierungsprozeß
Die Probleme und Krisensymptome in den OECD-Staaten, insbesondere in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends waren, so Michael Zürn, Ergebnisse einer schlechten und nationalstatlich orientierten Politik der nationalen Regierungen. Diese lassen sich, wie folgt zusammenfassen:
1. Das Externalitätsproblem: Angesichts der Ausweitung sozialer und ökonomischer Handlungszusammenhänge sind marktkorrigierende Eingriffe auf der nationalen Ebene ineffektiv, wenn sie nur einen Teil des betroffenen Handlungszusammenhangs abdecken, da dann die Wirkung einer nationalen politischen Regelung durch soziale Aktivitäten anderswo unterlaufen wird. Denn nationalstaatliche Regelungen zum Schutz der eigenen Wirtschaft oder des Sozialsystems, freizügigere Umweltschutzauflagen etc. können gegenteilige als die erwünschten Effekte auslösen, wenn z.B. ein Land durch die erhöhte Einleitung von giftigen Abwässern in grenzüberschreitende Flüsse und Seen die Interessen des Nachbarlandes verletzt, damit wiederum Konflikte im Bereich der bilateralen Beziehungen entstehen. Andererseits kann auch der umgekehrte Fall, also die Festlegung strenger Umweltstandards in einen Land durch das Verhalten des anderen Landes unterlaufen werden. Ebenso können protektionistische Maßnahmen, wie Schutzzölle und Subventionen für die eigene Wirtschaft eine Spirale des Subventionswettlaufs auch in anderen Ländern in Gang setzen, bei der letztlich alle Beteiligten Nachteile erleiden.
2. Das Effizienzproblem: Viele nationale Regelungen stellen Barrieren für den freien internationalen Austausch von Gütern dar und behindern deren effiziente Verteilung. Dies führte beispielsweise im Automobilbau zu einer Forderung nach Abbau nationaler Handelsbarrieren, da viele Autoteile in unterschiedlichen Ländern der Welt produziert werden.
3. Das Problem des Politikwettbewerbs: d. h. sein eigenes Land als möglichst attraktiven und kostengünstigen Standort zu präsentieren, mit niedrigen Löhnen und Steuern zu locken. Auch hier wird im Grunde genommen wieder eine Deregulierungspirale in Gang gesetzt, bei der tatsächlich jedes Land nur verlieren kann, da u.a. die möglichen innenpolitischen Konsequenzen, Streiks und sozialer Unfriede das politische System ingesamt gefährden können und damit wieder unattraktiv für Investoren machen (Michael Zürn, S. 17ff.).
Alle Beispiele machen deutlich, daß in einer globalisierten und vernetzten Welt Entscheidungen, die ein Nationalstaat trifft, komplexe Auswirkungen auf die eigenen wie auf alle anderen Systeme und Beziehungen des Staates mit anderen Staaten haben. Um Konflikte und Effizienzverluste zu vermeiden, bedarf es immer mehr zwischenstaatlicher Regelungen und Harmonisierungen. Dabei geht es derzeitig vor allem um die Rückgewinnung der politischen Kontrolle über Marktprozesse.
Auffällig ist, daß dieser Prozeß vor allem durch die international operierenden Konzerne angestoßen wurden. Sie sind es, denen im Rahmen einer immer mehr globalisierten und arbeitsteiligen Produktion an harmonisierten Regelungen im Handel, Waren- und Dienstleistungsverkehr außerordentlich gelegen ist, da diese ihre Produktionskosten nachhaltig senken und gleichzeitig den Güter-, Waren-, und Geldverkehr sowie den Austausch von Dienstleistungen enorm beschleunigen. Das, wie die Abschaffung einseitiger Subventionszahlungen für nationale Industriebereiche, soll im Rahmen der internationalen Konkurrenz auf dem Weltmarkt gleiche Ausgangsbedingungen für alle Marktteilnehmer schaffen.
2.2.2 Der demokratische Wohlfahrtsstaat und die Ziele des Regierens
Um den Denationalisierungsprozeß besser verstehen zu können, geht es darum zu untersuchen, wie das derzeitige Verständnis von Regieren aussieht und warum dies so wichtig für den Prozeß der Denationalisierung ist, bzw. welche Auswirkungen diese Verständnis und seine praktische Umsetzung haben. Zürn macht im späteren Verlauf seiner Ausführungen Vorschläge, inwieweit dieses Verständnis als Grundlage für das Modell des komplexen Weltregierens dienen kann.
Das Regieren zielt, so Zürn, heute im wesentlichen auf vier Ziele, die sich in demokratischen Wohlfahrtsstaaten in historischer Abfolge herausgebildet haben:
1. auf den inneren und äußeren Frieden (Sicherheit)
2. auf ein zivil konstituiertes Zusammengehörigkeitsgefühl, das ein politisches Gemeinwesen ermöglicht (Identität)
3. auf demokratische Entscheidungsverfahren (Legitimation)
4. auf eine für alle Seiten akzeptable Balance von wirtschaftlicher Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit (soziale Wohlfahrt) (Michael Zürn, S.13).
Grundlage dieser Ziele ist, so Zürn, das Modell des demokratischen Wohlfahrtsstaates, der in den siebziger Jahren dieses Jahrhunderts alle vier Ziele des Regierens in bis dahin ungekanntem Maße verwirklicht hat. Sicherheit und soziale Wohlfahrt, demokratische Legitimität und kollektive Identität seien gleichzeitig in einer relativ austarierten Weise gegeben gewesen.
Zum einen dient dieser weithin stilisierte demokratische Wohlfahrtsstaat gleichsam als Maßstab für erfolgreiches Regieren heute und in der Zukunft. Zum anderen ist aber die Ausbildung der nationalstaatlichen Fähigkeit zu regieren, in ihrer vollständigen Form historisch gewachsen. Sie ging Hand in Hand mit der Ausbildung nationaler Verkehrswirtschaften und nationaler Kommunikationszusammenhänge. Obgleich mancherorts erst der Staatsapparat die Nation begründete, war die Ausbildung des demokratischen Wohlfahrtsstaates erst nach einer weitgehenden »Nationalisierung« von Wirtschaft und Gesellschaft bzw. der Auflösung von lokalen Handlungszusammenhängen möglich.
Historisch gesehen hat sich dieser Typus des nationalstaatlichen Wohlfahrtsstaates jedoch überlebt, da er immer die eigenen nationalstaatlichen und auf das eigene Wirtschafts- und Sozialsystem bezogenen Interessenlagen im Auge hatte und weniger die weiträumigen und globalen Folgen seiner Politik. Die aus diesem Blickwinkel resultierenden nationalstaatlichen Eingriffe, der Schutz der eigenen Märkte und Sozialsysteme führten jedoch zu Verkrustungen in den meisten Ländern der OECD und, so Zürn, zu der strukturellen und politischen Krise in den OECD-Staaten vor allem zu Beginn der neunziger Jahre.
Notwendig ist daher eine über alle Grenzen hinweg abgestimmte Politik, die Michael Zürn als Projekt des komplexen Weltregierens bezeichnet. In Anlehnung an das Kantsche Modell des Weltbürgertums geht es hier jedoch nicht nur um eine effiziente Gestaltung von wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsprozessen auf supranationaler Ebene, sondern ebenso darum, wie demokratische Spielräume und die Zielsetzungen des demokratischen Wohlfahrtsstaates auch in einer globalisierten und denationalisierten Welt erhalten werden können.
Dies macht, so Zürn, ein Dilemma des derzeitigen Denationalisierungsprozesses deutlich. Zwar entstehen im Verlauf der ökonomischen Denationalisierung neue Handlungsspielräume, währendessen gerät die Idee des demokratischen Wohlfahrtstaates jedoch immer mehr in die Defensive, bleiben Demokratie und soziale Wohlfahrt unter dem Diktat der Ökonomie auf der Strecke.
2.2.3 Merkmale der Denationalisierung
Die gesellschaftliche Denationalisierung nimmt im Gegensatz zur ökonomischen Denationalisierung Bezug auf auf alle gesellschaftlichen Beziehungen, Austauschprozesse, sozialen Handlungsräume und -zusammenhänge.
Zürn beschreibt dies folgendermaßen: "Gesellschaftliche Denationalisierung kann also definiert werden als die Verschiebung der Grenzen von verdichteten sozialen Handlungszusammenhängen über die Grenzen von nationalen Gesellschaften hinaus, ohne gleich global sein zu müssen"(Michael Zürn, S. 73).
In der Praxis bedeutet das, daß die gesellschaftliche Denationalisierung sowohl als grenzüberschreitender Austausch, als auch als grenzüberschreitende Produktion von goods und bads zu sehen ist (Michael Zürn, S.72).
Konkretes Beispiel hierfür ist die EU. Auf einem relativ kleinen Raum gibt es eine Vielzahl von gegenseitigen Austauschprozessen, die sich auf allen Ebenen der gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und sozialen Dimensionen darstellen lassen. Durch die moderne Informationstechnik, durch Verkehr und grenzüberschreitende Produktion ist ein neues Netz von Beziehungen enstanden, das die ursprunglich auf den nationalstaatlichen Raum bezogenen gesellschaftlichen Beziehungen und Austauschprozesse ergänzt oder sogar ersetzt hat.
Hierbei lassen sich fünf Transaktionsbereiche definieren:
- Gewalt = grenzüberschreitender Austausch oder grenzüberschreitende Produktion von Bedrohungen und Waffen,
- Kommunikation und Kultur = grenzüberschreitender Austausch oder grenzüberschreitende Produktion von Zeichen und kulturellen Produkten
- Mobilität = grenzüberschreitende Reisen und Personenwanderungen
- Wirtschaft = grenzüberschreitender Austausch oder grenzüberschreitende Produktion von Gütern, Dienstleistungen und Kapital
- Umwelt = grenzüberschreitender Austausch oder grenzüberschreitende Produktion von Umweltschadstoffen und -risiken.
Für alle beschriebenen Bereiche gibt es jedoch sehr unterschiedliche Intensitätsmerkmale in den jeweiligen Mitgliedsländern der EU. Nicht überall ist die Denationalisierung auf allen Ebenen gleich weit fortgeschritten, gibt es auch weiterhin in einzelenen gesellschaftlichen Bereichen sehr große Unterschiede, kann von einer Homogenität der europäischen Gesellschaften also nicht gesprochen werden. Auch historisch gesehen hat sich der Denationalisierungsprozeß in den einzelnen Mitgliedsländern der EU sehr unterschiedlich dargestellt, stehen die möglichen neuen Mitgliedsländer, wie Polen, Ungarn oder Slowenien erst am Anfang dieser Entwicklung.
Das heißt zusammenfassend, daß der beschriebene Denationalisierungsprozeß nicht abgeschwächt ist, sondern nur, daß er nicht linear, also gleichzeitig und gleichartig in allen Ländern der EU oder der OECD abläuft und gewissen Unterschieden unterliegt. Insgesamt beschleunigte sich die gesellschaftliche Denationalisierung seit den 60er Jahren, breitete sich in den 70er Jahren aus, um vor allem in den 80er Jahren einen deutlichen Schub zu erhalten. Die 90er Jahre waren vor allem durch die Einführung neuer Informationstechnologien geprägt, die den Denationalisierungsprozeß in vorher nicht gekanntem Ausmaß verstärkt haben. Der freie und unzensierte Zugriff auf Informations- und Wissensbestände über internationale Grenzen hinweg, hat zum Schlagwort des "global village" beigetragen; die Welt, ein kosmopolitisches Dorf. Gleichzeitig hat er aber auch die gesamten Finanz- und Währungsmärkte dynamisiert und durch die Nutzung der neuen Informationstechnologien eine enorme Beschleunigung des Kapital- und Zahlungsverkehrs erzeugt..
2.2.4 Denationalisierungsprozeß und Ziele des Regierens
Wie sieht es aber nun im Rahmen des Denationalisierungsprozesses mit den vier formulierten Zielen des Regierens, Sicherheit, Legitimation, Identität und soziale Wohlfahrt aus?
Für den Bereich Sicherheit läßt sich vor allem für die EU und die meisten OECD-Länder konstatieren, daß die Gefahren kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen den Staaten gesunken sind, was nicht bedeutet, daß der Jugoslawien-Krieg grundsätzlich etwas an dieser Tatsache ändern würde. Hinzu kommt, daß die ökonomischen Verflechtungen zwischen den OECD-Staaten einen großen Einfluß auf die Sicherheitslage und die Interessen der Nationalstaaten haben.
Allerdings gibt es sehr wohl Bedrohungen durch innerstaatliche Konflikte, die ETA in Spanien, die IRA in Nordirland und die Separatisten auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika. Die Sicherheitsleistungen des Nationalstaats haben sich daher verlagert, es geht nicht mehr darum, den äußeren Frieden zu erhalten, sondern den inneren. Dies bedeutet, daß zur Abwehr des inneren Feindes, wie auch der organisierten Kriminalität nötigenfalls demokratische Rechte beschnitten werden (RAF und Anti-Terror-Gesetze, Großer Lauschangriff etc). Auf der anderen Seite sind viele Aufgaben der Sicherheit und des Schutzes der Bürger zumindest in Europa von neuen europäischen Organisationen übernommen worden (Europol, Schengener Abkommen) bzw. werden durch eine neue grenzüberschreitende Zusammenarbeit der nationalen Polizeibehörden wahrgenommen. Sie füllen somit die nationalstaatlichen Lücken im Rahmen der Sicherheits- und Schutzaufgaben des Nationalstaats. Ähnlich verhält es sich beim Schutz vor Umweltrisiken.
Einhergehend mit der Denationalisierung verliert der klassische Nationalstaat immer mehr an Legitimationskraft. Da viele Entscheidungen nicht mehr über nachvollziebare demokratische Prozesse im Rahmen des Nationalstaates erfolgen, sondern für viele Bürger unsichtbar z.B. im EU-Parlament, in Brüssel und Straßburg oder in den EU-Kommissionen, leidet die demokratische Legitimation des Nationalstaates. Dies stärkt insbesondere politische Parteien am rechten Rand des Parteienspektrums. Auf der anderen Seite hat es insbesondere in Europa einen Demokratisierungsschub gegeben, Länder wie Spanien, Griechenland und Portugal und selbst die Türkei haben sich seit den siebziger Jahren in weitreichendem Sinne demokratisiert. Die Gefahr neuerlicher Militärputsche oder faschistischer Regimes ist zumindest in den drei erstgenannten Ländern äußerst gering. Die Demokratisierung in anderen Teilen der OECD-Welt ist zunm anderen auch der Tatsache geschuldet, daß es durch die neuen Informationstechnologien einen ständigen weltweiten Austausch von Daten und Informationen gibt, dies fördert Demokratieprozesse und stärkt insbesondere die demokratischen Gruppen und Parteien.
Die neuen Kommunikationsmedien schaffen eine weltweite Tranzparenz der Kulturen, dies erzeugt auf der einen Seite vermehrt kollektive Identitäte, die sich überlagern und eine Vielheit ineinandergeschachteler "Wir"-Identitäten. Auf der anderen Seite schwächt es die nationalen "Wir"-Identitäten.
Die Schwächung dieser "Wir"-Identitäten resultiert aber auch durch den vermeintlichen Bedeutungsverlust der Regionen. In globalisierten Märkten und supranationalen institutionellen Organisationen spielen die Bedeutung der Regionen, ihre historischen und kulturellen Traditionen kaum noch eine Rolle. Dies erzeugt wiederum die Angst des Identitätsverlustes. Diese spiegelt sich u.a. im zunehmenden Regionalismus wieder. Regionalparteien wie die Lega Norte in Italien, sind Ausdruck einer Verunsicherung von Teilen der Bevölkerung, ihre kulturelle und soziale Identität zu verlieren. Der Denationalisierungsprozeß ist für viele Synonym für die Aufgabe kultureller Eigenarten und Traditionen, die wichtig für den Zusammenhalt auch von modernen Gesellschaften sind.
Besonders betroffen vom Denationaliserungsprozeß ist das Regierungsziel der sozialen Wohlfahrt. In fast allen europäischen Ländern hat es den Abbau sozialer Errungenschaften, vor allem aus den siebziger Jahren gegeben, oder den großflächigen Umbau der Sozialsysteme. Dabei hat es angesichts einer hohen Arbeitslosigkeit in vielen Ländern kaum weitreichende Beschäftigungsinitiativen im Rahmen eines zweiten oder dritten Arbeitsmarktes gegeben. Viele Nationalstaaten haben die soziale Sicherung zum Teil in die Verantwortung des Individuums gegeben und die Altersvorsorge in vielen Bereichen privatisiert.
Dennoch gestaltet sich die Situation der Sozialsysteme z.B. in der EU sehr unterschiedlich. Großbritannien hat unter der Thatcher-Regierung die größten Kürzungen im Sozialbereich vorgenommen und vergleichsweise wenig für beschäftigungsfördernde Maßnahmen investiert, was weiterhin zu einer hohen Arbeitslosenquote beiträgt (insbesondere im Westen und Norden Großbritanniens). Die Niederlande, Dänemark, Schweden und auch mit Einschränkungen Frankreich sind einen anderen Weg gegangen und verfügen auch heute noch über ein sehr gut funktionierendes Sozialsystem, bei einer außerordentlich niedrigen Arbeitslosenquote. Das bedeutet, daß nicht per se Denationalisierung und Globalisierung zum Verlust der Sozialsysteme und Arbeitsplätze führen müssen.
2.2.5 Die Gefahr der Fragmentierung
Die bereits oben beschriebenen und angedeuteten Probleme der Denationalisierung beziehen sich insbesondere auf die Bereiche der Demokratie, der Ökonomie, des drohenden Verlustes kultureller Identität und insbesondere der sozialen Verfasstheit der Gesellschaften.
Umschrieben werden diese Probleme mit dem Begriff der Fragmentierung. Diese bedeutet, daß sich bedingt durch den Prozess der Denationalisierung, wie auch der Globalisierung in allen Gesellschaften ganz neue, sehr unterschiedliche und teils auch extrem gegensätzliche Interessenlagen herausbilden, sogar der Verlust des "common sense" droht.
Der im Rahmen der Denationalisierung und Globaliserung ablaufende Modernisierungs- und Harmonisierungsprozess beispielsweise in den europäischen Ländern macht die alten politischen Zielvorstellungen der gesellschaftlichen Gruppen inkompatibel, schafft Verunsicherung und zerschlägt alte soziale Traditionen und Wertmaßstäbe. Dies mußten insbesondere die nationalen Gewerkschaften schmerzlich erfahren, denen es bis heute nicht wirklich gelungen ist, sich einheitlich und europaweit zusammenzuschließen. Zwar gibt es seit Jahrzehnten den Europäischen Gewerkschaftsbund in Form einer lockeren Organisationsstruktur, dennoch kann von einer schlagkräftigen und politisch starken Organisation nicht gesprochen werden.
Gleichzeitig verändern sich auch die politischen und demokratischen Institutionen, wird die Fähigkeit des einzelnen, wie auch ganzer gesellschaftlicher Gruppen immer geringer, auf politische und ökonomische Entscheidungsprozesse einzuwirken, geht die Transparenz dieser Prozesse im Rahmen unüberschaubarer transnationaler Institutionen, wie z. B. der EU verloren. Dieses Demokratiedefizit wird derzeit nicht aufgehoben und begünstigt u.a. die Wahlerfolge rechtspopulistischer Parteien und Gruppen bei nationalen und europäischen Wahlen. Ganz allgemein hinkt die demokratische Kontrolle der Entwicklung internationaler Organisationen sowie der Wirksamkeit ihrer Entscheidungen hinterher
Einhergehend mit dem Denationalisierungsprozeß geht die ökonomische und kulturelle Bedeutung der Regionen zurück, werden die ökonomischen, kulturellen und sozialen Besonderheiten umso mehr zur Rekonstruktion einer neuen "Wir"-Identität genutzt, die den Verlust alter Identitäten auffangen soll. Die Attraktivität solcher Modelle unterstreichen die Lega Norte in Italien, wie auch separatistische Bewegungen in ganz Europa.
Noch stärker wirkt der Denationalisierungs- und Globalisierungsprozeß allerdings auf die soziale Verfasstheit der Gesellschaften. Er hat zu einer weitreichenden Veränderung in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen geführt, hat traditionelle Lebens- und Arbeitsformen zerschlagen. Dabei ist in vielen Gesellschaften die soziale Gerechtigkeit und das Bemühen um sozialen Ausgleich dem Primat der Ökonomie gewichen. Der Verweis auf die stärkere Eigenverantwortlichkeit des Individuums schafft zusätzliche Unsicherheiten und das Gefühl von Überforderung. Gleichzeitig stärkt die angebotsorientierten Wirtschaftspolitik aller nationalen Regierungen zunehmend die Position der Kapitaleigner und weniger die der Arbeitnehmer. Die daraus resultierenden sozialen Verwerfungen, steigende Jugenddelinquenz und psychische und soziale Verelendung breiter Bevölkerungskreise spiegeln dabei die Tiefe dieses Prozesses wieder und können als Teil der gesellschaftlichen Fragmentierung bezeichnet werden.
Der Fragmentierungsprozeß findet somit auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen statt und umfasst ebenso die ökonomische Entwicklung in einzelnen Regionen, beispielsweise der EU. Tatsächlich ist er ein Ergebnis ungleichzeitiger und divergierender Modernisierungs- und Strukturprozesse, in denen die negativen Auswirkungen der Denationalisierung einen der Denationalisierung entgegengesetzten Prozeß auslösen, der sich teilweise sehr stark rückwärtsgewandt darstellt und konservative bis reaktionäre Politikvortsellungen und -optionen aufgreift.
Hinzu kommt, daß der Prozeß der Denationalisierung nicht gleichzeitig und in gleicher Tiefe in allen Staaten erfolgt und es eine Gleizeitigkeit von politischer Fragmentierung und politischer Integration gibt. Diese Fragmentierung bedroht die innere und demokratische Verfasstheit der europäischen Staaten. Sie schafft einen unberechenbaren und gefährlichen Gegenpol zum Denationalisierungsprozeß und impliziert zumindest für Europa das Anwachsen politischer Strömungen, die eher autoritäre, denn demokratische Politikoptionen vertreten. Gleichzeitig führt sie zu einer noch stärkeren Polarisierung und Spaltung aller Gesellschaften und bedroht den Prozeß der Denationalisierung und Globalisierung.
3. Die unterschiedlichen Formen des Regierens
Mit Blick auf die Alternativen nationalstaaatlicher Politik ist es notwendig, die bestehenden Institutionen und die bisherigen Formen des Regierens zu beleuchten. Diese Formen des Regierens gelten jedoch universell und nicht nur für nationalstaatliche Institutionen, sie können genauso auf internationale, wie auch auf nichtstaatliche Institutionen und internationale Organisationen übertragen werden. Dies meint insbesondere eine sog. "regelnde Instanz"(Michael Zürn, S. 169), die von einer hierarchisch übergeordneten Organsisation wahrgenommen werden kann. Dies können NGOs genauso gut sein, wie die KSZE oder z.B. in konkreten politischen oder wirtschaftlichen Handlungzusammenhängen zwischen verschiedenen Parteien ad hoc gebildete Institutionen oder vereinbarte institutionelle Zusammenhänge.
Mit Blick auf die Rolle, die eine hierarchisch übergeordnete Organisation als regelnde Instanz spielt, können drei Grundformen des Regierens unterschieden werden:
1. governance by government: In diesem Fall wird die Regelung von einer übergeordneten Zentralinstanz hierarchisch festgelegt und umgesetzt. Es handelt sich mithin um hierarchisches Regieren. Diese bestimmt bis heute das politische Denken, auch und gerade im demokratischen Wohlfahrtsstaat. Die territorial definierte Nationalgesellschaft ist in der Demokratie zwar bei der Willens- und Entscheidungsfindung beteiligt, und die Handlungsfreiheit unterliegt substantiellen normativen und institutionellen Beschränkungen, das Regieren soll aber durchaus entsprechend der Gesetzgebungsperspektive durch eine hierarchische Organisation erbracht werden.
2. governance with government: In diesem Fall sind zwar Instanzen mit hierarchischen Befugnissen an der Regelung beteiligt, sie setzen die Regelung aber nicht per Dekret durch. Vielmehr entwickeln sie in Abstimmung und Kooperation mit anderen sozialen Akteuren Normen und Regeln, an die sich dann alle Beteiligten zu halten haben. Es kann in diesem Zusammenhang von kooperativem Regieren gesprochen werden. Der einzelne Staat ist in diesen Verhandlungs- und Entscheidungsnetzwerken bestenfalls primus inter pares. Der zu regelnde Handlungszusammenhang kann die nationale Gesellschaft sein - wie bei neo-korporatistischen Arrangements -, er kann sich aber auch jenseits der Grenzen des Nationalstaates erstrecken - wie bei internationalen Institutionen.
3. governance without government: In diesem Fall gelingt es den zu regelnden sozialen Handlungszusammenhängen in einem Akt der Selbstorganisation ohne Rückgriff auf übergeordnete Zentralinstanzen und ohne Beteiligungen von Regierungen Verhaltensregelungen zu befolgen, um wünschenswerte Ergebnisse zu fördern. Die Quasi-Politik der Banken auf der nationalen Ebene, aber auch transnationale Vereinbarungen ohne staatliche Absicherung sind Beispiele dieser Form des Regierens, bei der die regelnde Instanz und der zu regelnde Handlungszusammenhang identisch sind.
Eine entscheidende Rolle für das jeweilige Mischungsverhältnis der unterschiedlichen Formen des Regierens spielt die Reichweite der sozialen Handlungszusammenhänge. Solange die politischen Grenzen des Staates über die sozialen Handlungszusammenhänge hinausreichten - wie im absolutistischen Territorialstaat -, konnte das hierarchische Regieren Wirkung zeigen. Problematisch war lediglich die Regelung der Beziehungen zwischen den Staaten. Governance by government überwog eindeutig.
Als die sozialen Handlungszusammenhänge mit Beginn des 20. Jahrhunderts aber die politischen Grenzen erreichten und sich zunehmend Interdependenzen zwischen Nationalgesellschaften ergaben, folgte daraus der Zwang, das hierarchische Regieren des Nationalstaates durch kooperatives Regieren in internationalen Institutionen zu ergänzen. Governance by government wurde insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg durch governance with government abgestützt.
In dem Maße, in dem sich heute tatsächlich grenzüberschreitende soziale Räume ausbilden, sollten sich hingegen Formen des Regierens jenseits des Nationalstaates entwickeln, in denen hierarchisches Regieren innerhalb der Nationalstaaten nur noch eine abstützende, ergänzende Rolle spielt. Governance by government ordnet sich dann im Extremfall governance with and without government unter (Michael Zürn, S. 169/170)
3.1 Internationale Institutionen und "governance by, with or without government"
Eine sehr wichtige Rolle beim Regieren jenseits des Nationalstaats im Rahmen des "governance by, with or without government" kommt den internationalen Organisationen zu. Im Rahmen der Internationalisierung beispielsweise des Umweltrechtes, des Finanz- und Kapitalverkehrs bilden sie den eigentlichen Schlüssel bei der Einhaltung von internationalen Regelungen und Vereinbarungen. Sie begründen dauerhafte und verfestigte Verhaltensmuster einer angebbaren Menge von Akteuren in sich wiederholenden Situationen . (Michael Zürn, S. 171) Diese Verhaltensmuster beruhen auf Regeln und Normen, die das Handlungsrepertoire bestimmen, da sie entweder etwas verbieten, ermöglichen oder verlangen.
Die Bandbreite der internationalen Institutionen reicht von der EU, der UNO, dem GATT, der WTO bis hin zum Klimagipfel und dem WWF und Greenpeace. Wie unterschiedlich dabei ihr Charakter und ihre Einbindung in internationale oder nationale Politk sein kann, verdeutlicht das Schaubild (Michael Zürn, S. 176):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Insgesamt gibt es mindestens acht verschiedene Typen von internationalen Organisationen, die in ihrer Reichweite sowohl territorial, als auch global sein können. Ihre Aufgaben reichen dabei von der bloßen Einflußnahme bei der Diskussion um verbindliche Umweltrichtlinien oder dem Schutz seltener Tiere, bis hin zur Erstellung völkerrechtlich verbindlicher Regelungen und Vereinbarungen im Rahmen von internationalen Abkommen.
Inwieweit internationale Institutionen positive wie auch negative Regelungen überprüfen und durchsetzen können, hängt immer davon ab, inwieweit alle beteiligten Akteure diese Vereinbarungen und Regelungen als verbindlich anerkennen und befolgen. Die Autorität der internationalen Institutionen ist also gleichzeitig abhängig davon, ob sie in der Lage sind Regelverletzungen zu sanktionieren, aber ebenso, inwieweit sie kompetent sind, im Dialog mit dem jeweiligen Regelverletzer eine für alle Beteiligten konsensfähige Lösung zu finden. Dies setzt voraus: ein administratives Know How der Institutionen; daß das Ausmaß der Regeleinhaltung deutlich gemacht werden muß; die operationalen Regeln an das Machbare angepasst werden müssen, ohne die Prinzipien und Normen außer Kraft zu setzen; die letztlich Betroffenen ein Bewußtsein für das Problem und für die Legitimität der Regelung haben müsssen.
Im Zweifelsfall muß die internationale Institution aber auch die Fähigkeit besitzen, mittels unterschiedlicher Instrumentarien den Regelverletzer zu sanktionieren. Hierbei sollen militärische Sanktionen auf jeden Fall ausgeschlossen werden und auf die Kooperationsbereitschaft der einzelnen Partner gesetzt werden. Hierzu bedarf es im eigentlichen Sinne diplomatischen Handlungsgeschicks und eines "pädagogischen" Verständnisses bei der Bewältigung von möglichen Konflikten. Wie diese Strategien aussehen können und in welchem Maße sie zum Erfolg der Arbeit internationaler Institutioen beitragen können, bedarf folgender Voraussetzungen:
1. die Schaffung eines kooperationsförderlichen »vertraglichen Umfeldes« (contractual environment);
2. ein flexibler Umgang mit (unfreiwilligen) Regelungsabweichungen (compliance management);
3. der Ausbau der Fähigkeiten schwächerer Regierungen, die gesteckten Ziele erreichen zu können (capacity building);
4. die Schaffung von Verständnis für die Regelung bei den Nachzüglern und die relative Stärkung der Position von Gruppen, die die Regelung unterstützen (concern building).
(Michael Zürn,S. 194/195)
3.2 Die Rolle von Verhandlungen bei der Durchsetzung von internationalen Regelungen und Vereinbarungen
Tatsächlich geht es also darum, ein Instrumentarium der unterschiedlichtste Verhandlungsstrategien zu entwickeln. Weiter geht es darum, mittels der internationalen Institutionen den Einfluß staatlicher Regierungen bei der Lösung globaler Probleme auszuschalten und auf die Bereitschaft der Konfliktpartner zu setzen, in einem partnerschaftlichen Dialog zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen, die praktikabel sind und die Möglichkeiten und Fähigkeiten der jeweils Beteiligten berücksichtigen, die neuen vereinbarten Regelungen auch einhalten zu können. Beispiele hierfür gibt es in den unterschiedlichsten Formen wie z.B. die Schaffung einheitlicher Umweltregimes und -vereinbarungen (FCKW- und Kohlendioxid-Reduzierung), sowie einheitlicher Sicherheitsbestimmungen im Seeschiffsverkehr und das Artenschutzabkommen. Auch wenn vielfach die konkrete Durchsetzung dieser Abkommen viel zu wünschen läßt, sind sie dennoch ein Teil der bereits existierenden internationalen Vereinbarungen und Instituionen, die über den Souveränitätsanspruch der einzelnen Staaten hinausgehen und sich in der Praxis bewährt haben.
Um möglichen Regelverletzungen entgegen zu wirken, ist die Schaffung eines transparenten Umfeldes enorm wichtig. Dies geschieht durch Einrichtungen, die über die Umsetzung von Regelungen und beispielsweise im Rahmen von Umweltschutzabkommen über die aktuellen Emissionswerte berichten, sowie durch regelmäßige Treffen von Vertretern der Vertragsparteien. Ein weiteren Part übernehmen in diesem Sinne aber auch die internationalen Medien. Da mögliche Umweltvergehen viel stärker Gegenstand der Medienberichterstattung sind, ist es für Regelverletzer sehr schwierig geworden, Verstöße gegen internationale Abkommen zu verheimlichen oder zu "schummeln".
Internationale Vereinbarungen und Abkommen setzen also auf unterschiedliche Strategien zur Durchsetzung ihrer Ziele. Das Öltankerregime beispielsweise bewerkstelligt die Aufgabe der Kontrolle und Überprüfung des Verhaltens von Hochseeschiffen dadurch, daß nicht Verhaltens- sondern Ausrüstungsvorschriften entwickelt worden sind, die an einigen wenigen, ökonomisch aber wichtigen Häfen überprüft werden können. Generell zeichnen sich darüber hinaus fast alle erfolgreichen internationalen Umweltregime durch Umsetzungs- und Überprüfungsmaßnahmen aus, die sowohl mittels interessengeleiteter als auch lernorientierter Mechanismen die Wirksamkeit der Regelungen erhöhen. Gleiches gilt auch für viele andere internationale Vereinbarungen und kann auch als Beipiel für ein Politikmanagement im Bereich anderer Arbeitsfelder internationaler Organisationen dienen. In diesem Zusammenhang hat die Ausweitung von "governance with government" im Rahmen der internationalen Vereinbarungen und Institutionen in den letzten zwanzig Jahren enorm zugenommen, die Zahl der internationalen Rechtsakte und Abkommen hat zu einem riesigen Netzwerk internationaler Regelungen und Bestimmungen in den verschiedensten Bereichen geführt.
Trotz aller Erfolge der Arbeit internationaler Organisationen muß man dennoch einräumen, daß das Hauptaktionsfeld ihrer Arbeit zum einen die Schaffung globaler Sicherheitsvereinbarungen und -netzwerke zur Verhinderung kriegerischer Konflikte (Rüstungskontrollabkommen, UNO-Sicherheitsratsbeschlüsse und Friedenseinsätze etc.), und zum anderen die Regelung der internationalen Märkte und die Festlegung einheitlicher Rahmenrichtlinien im internationalen Handel und Zahlungsverkehr sind. Wesentlich schlechter sieht es hingegen beispielsweise bei der Vereinbarung für alle Staten verbindlicher Menschenrechte, sozialer Mindeststandards und Umweltschutzregelungen aus.
3.3 Die Handlungsgrenzen internationaler Organisationen
Dennoch gibt es in Michael Zürns Ausführungen einen grundlegenden Aspekt und Widerspruch im Bereich der Durchsetzungsfähigkeit internationaler Institutionen. Im Zweifelsfall, dies ist besonders bei der Regelverletzung internationaler Abkommen über Menschenrechte und Sicherheitsfragen; bei nicht mehr über Verhandlungen konsensfähig zu regelnde Konflikte zwischen zwei Parteien sowie bei militärischen Auseinandersetzungen und bei sog. Handelskriegen (z.B. die Auseinandersetzungen zwischen der VR China und den USA im Rahmen von Plagiatsvorwürfen und Verstößen gegen Markenschutz- und Urheberrechte) zu beobachten, haben internationale Institutionen kaum noch die Möglichkeit einzugreifen, ist eine Hegemonialmacht, in diesem Fall die USA, diejenige, die die Regelverletzer massiv sanktioniert. Das bedeutet, daß internationale Organisationen ausgeschaltet werden können und in diesen Konflikten die Gefahr droht, daß das internationale Vetrauen in ihre Autorität schwindet, wie sich am Beispiel des Jugoslawien-Krieges zeigte. In diesem Fall wurden die Vereinten Nationen von der NATO und speziell den USA regelrecht vorgeführt und bloßgestellt.
Ich halte in Michaels Zürns theoretischen Überlegungen diese Tatsache, daß im Endeffekt die Durchsetzung internationaler Vereinbarungen von der Fähigkeit einer Hegemonialmacht abhängt, den Regelverletzer sanktionieren zu können und vor allem dies auch zu wollen, für den entscheidenden Schwachpunkt. Ob z.B. die Vereinten Nationen, in kommenden, ähnlich gelagerten Konflikten in der Lage sind, sich gegen die Interessen dr USA durchzusetzen, mehr Handlungsfähigkeit und -kompetenz zeigen zu können, wage ich zu bezweifeln.
Tatsächlich hängt es im Sinne des Modells des komplexen Weltregierens aber davon ab, ob eine Hegemonialmcht bereit ist, sich dem Votum einer internationalen Organisation zu beugen. Geschieht dies nicht, könnten sich die USA ihre Vormachtstellung durch die Kontrolle der Entscheidungen internationaler Institutionen und die Herbeiführung der den USA genehmen politischen und wirtschaftlichen Regelungen sichern. Sozusagen mit dem Segen der restlichen Welt.
4. Ziele des "Komplexen Weltregierens"
4.1 Governance by, with and without government
Um die bereits beschriebenen Probleme und Ungleichzeitigkeit im Prozeß der Denationalisierung aufzufangen bedarf es so Michael Zürn ein Projekt des komplexen Weltregierens, das im Sinne von "governance by, with and without government" eine neue Dimension des politschen Handelns und der kollektiven Entscheidungsfindung eröffnen soll und das Kants Idee des Weltbürgertums aufgreifen soll. In diesem Projekt sollten die bereits genannten vier Ziele des Regierens erreicht werden:
- die dauerhafte Reproduktion eines politischen Prozesses
- die Bereitstellung eines symbolischen Bezugsrahmens, der die Gemeinsinnorientierung der Akteure befördert
- die Reduktion von Unsicherheit
- die Ermöglichung sozialer Wohlfahrt, so daß Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit im wirtschaftlichen Prozeß einigermaßen austariert sind
(Michael Zürn, S. 328)
Durch diese Projekt soll der Ausbau internationaler Institutionen so weit wie möglich vorangetrieben und gleichzeitig deren Defizite abgebaut werden.
4.2 Neukontextuierung des Nationalstaates
Dieses Projekt bedeutet jedoch nicht den völligen Abbau des Nationalstaats. Es handelt sich beim Verlust der Effektivität nationalstaatlicher Maßnahmen nur um eine relative Gewichtsverschiebung. Aufgrund bestehender Effiziensvorteile der Nationalstaaten in unterschiedlichen Aufgabenbereichen, geht es also darum, diese Effizienzvorteile weiterhin zu nutzen, die Effizienzdefizite jedoch mit Hilfe internationaler Institutionen abzubauen, das bedeutet also das Zusammenspiel von verschiedenen Entscheidungsebenen, wobei jede einzelne Ebene nicht ohne die andere voll funktionsfähig ist. Zürn schreibt hierzu:
"Die verschiedenen politischen Systeme verbinden sich also zu einem Gesamtarrangement von governance by, with and without government, ohne daß Nationalstaaten spezifische Merkmale wie das Steuerprivileg und das Gewaltmonopol deshalb verlören. Ein idealtypisches Modell der neuen Staatlichkeit könnte sich durch drei Elemente auszeichnen. Als erstes Element legen internationale Regelungen, die zwischen Staaten letztlich vereinbart, aber unter einer fairen und gleichen Beteiligung von transnational organisierten Interessengruppen entwickelt werden, die Ziele in Form von Rahmenrichtlinien fest (Zieldimension). Zweitens setzen entweder nationale oder subnationale politische Einheiten diese Rahmenrichtlinien um. Die nationalen politisch-administrativen Systeme behalten nach wie vor ein legitimes Gewaltmonopol und das Recht, Steuern einzutreiben. Dank dieser Ressourcen besitzen die Staaten die notwendige Sanktionsfähigkeit, um die jenseits des Nationalstaates verabredeten Vereinbarungen durchzusetzen (Ressourcendimension). Als einziger raumdeckender Hoheitsträger besitzt der Nationalstaat demnach seine wichtigste dauerhafte Funktion in einer Art Judikative in der Wahrung und Durchsetzung des Rechts, auch und gerade von anderen Instanzen wie heute bereits der Europäischen Union (vgl. Evers 1997).
Drittens schließlich kontrollieren transnationale SOAs (dies meint die sog. "spheres of authority", hierzu gehören nichtstaatliche Organisationen, wie Greenpeace, Amnesty International etc., die aufgrund ihrer Unbestechlichkeit und Autorität ohne staatliche Anbindung Menschen mobilisieren können, der Autor) die nationalstaatliche Umsetzung der internationalen Richtlinien auf der internationalen Ebene und die Einhaltung grundlegender Rechte (Anerkennungsdimension) " (Michael Zürn, S. 334).
Somit werden die ursprünglich vereinigten drei Dimensionen der Staatlichkeit auf drei unterschiedliche Instanzen übertragen, wobei die erst- und drittgenannte jenseits des Nationalsaats liegen. Der Nationalstaat verliert seine ursprünglich hierarchische Bedeutung bei der Regelung von Konflikten und Interessengegensätzen und wird zum "verhandelnden Staat". Nicht mehr durch Drohungen abgestützte Verbote oder durch finanzielle Mittel angestrebte Ziele kennzeichnen eine erfolgreiche politische Steuerung, sondern kontextbeeinflußende Maßnahmen und die Gestaltung der verhandelnden Netzwerke werden die zentralen Instrumente des Regierens. Hierbei sollten Entscheidungskompetenzen aufgrund besonderer lokaler und struktureller Bedingungen auf dezentrale Einheiten übertragen werden.
4.3 Komplexes Weltregieren versus Denationalisierung
Das Projekt des komplexen Weltregierens setzt so Michael Zürn darauf, "die gesellschaftliche Denationalisierung aufzufangen, Gemeinsinn jenseits der Nationalgesellschaften zu bilden und auch für Mehrebenenpolitik demokratische Qualität zu gewinnen, um damit die substantiellen Ziele des Regierens wieder annäherungsweise zu erreichen"(Michael Zürn, S. 336).
Im Mittelpunkt dieses Projekt stehen dabei:
1. das sozial- und umweltverträgliche Regieren, inclusive des Umbaus des Sozialstaates und der Einbindung internationaler Institutionen
2. das demokratische Regieren, also die Herstellung von Transparenz und Mitwirkungsmöglichkeiten in den politischen Entscheidungsprozessen und die Demokratisierung internationaler Organisationen.
Beides sind also die zentralen Punkte, von denen der Erfolg des Modells des komplexen Weltregierens abhängt. Sie müssen zum einen zu einer ungefährlichen Identitätsbildung beitragen, sowie gleichzeitig die kulturellen, sozialen, ökonomischen und politischen Fragmentierungserscheinungen auffangen. Tatsächlich bedar es hierzu einer veränderten nationalstaatlichen Politik, die den veränderten globalen Rahmenbedingungen Rechnung trägt.
Insofern ist natürlich auch die Bundesregierung gefordert, Fragmentierungserscheinungen mit einer innovativen Wirtschafts-, Sozial-, und Bildungspolitik entgegenzutreten und somit die Effizienzvorteile nationalstaatlicher Politik zu nutzen.
5. Handlungsvorschläge im Sinne des "Komplexen Weltregierens"
5.1 Nationalstaat und soziale Gerechtigkeit
Michael Zürn macht hierzu insgesamt fünfzehn Vorschläge, die ich jetzt zusammenfassend darstellen möchte (Michael Zürn, S. 338 ff.).
Was Punkt 1 und speziell den Umbau des Sozialstaats angeht, macht Michael Zürn insgesamt fünf Vorschläge. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Da sich der verschärfte Standortwettbewerb besonders auf die Sozialpolitik auswirkt, wenn die Sozialkosten in Form von Lohnnebenkosten unmittelbar in die Produktionskosten der Unternehmen einfließen, sei es sinnvoller, die Autonomie der Sozialpolitik über ein einkommens- bzw. mehrwertsteuergestütztes Sozialsystem zu schützen. Zürn verweist hierbei insbesondere auf das dänische Sozialsystem. Die gleichzeitige Steuerreduzierung für Grundgüter und die relativ hohe Besteuerung für Luxusgüter in Dänemark schafft zusätzlich ein Stück praktische Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit ohne ein kompliziertes und aufwendiges Steuersystem.
Da vor allem in den Dienstleistungbereichen ein enormes Arbeitsplatzpotential schlummert, aber andererseits dort nur Niedriglöhne bezahlt werden, sei es notwendig, daß der Staat diese Arbeitsplätze zusätzlich bezuschußt.
Weiterhin sei es notwendig die Arbeitnehmer am Gewinn ihrer Unternehmen zu beteiligen. Dies sei in Form der Beteiligung am Aktienkapital großer Unternehmen möglich.
Um dem Konkurrenz und Innovationsdruck auf den internationalen Märkten zu begnen und die Zukunftsfähigkeit der deutschen Industrie und den Erhalt der Arbeitsplätze zu sichern, sei zum einen eine zukunftsweisende Bildungspolitik wichtig und zum anderen eine innovative Technologie- und Forschungspolitik. Das impliziert auch den vollständigen Umbau des antiqierten Bildungsystems in Deutschland. Zürn setzt hierbei auch auf die Elitenförderung aber gleichzeitig auch auf eine großzügige staatliche Bildungsförderung für Kinder aus Familien mit kleinen Einkommen.
Ein ganz besonderes Moment sei aber die Förderung gesellschaftlich notwendiger im Sozial- oder Umweltbereich, insbesondere der Sektor, in dem Dienste an bedürftigen Menschen und an der Gemeinschaft geleistet werden, sollte stärker über die Zahlung eines Mindesteinkommens gefördert werden.
Einhergehend hiermit verlangt Michael Zürn die Einführung eines staatlich gesicherten Grundeinkommens und Mindestlohns.
5.2 Internationale Institutionen und soziale Gerechtigkeit
Für den Bereich der internationalen Institutionen sind allgemeine Regelungen zur Festlegung von Sozialstandards schwer durzusetzen. Das sie unmittelbare Verteilungsimplikationen besitzen, die einschneidende Auswirkungen auf nationale Gesellschafts- und Wirtschaftsysteme haben, sollten, so Zürn, internationale Institutionen hierfür so ausgestaltet sein, daß sie die schwierigen Interessenkonstellationen und Implementationsprobleme, die sich bei positiven und verteilungswirksamen Regelungen ergeben, angemessen berücksichtigen. Dennoch würde die Festlegung von einheitlichen Sozialstandards in der gesamten OECD-Welt weitreichende Auswirkungen haben, da sie die Weltmarktchancen von Volkswirtschaften mit geringerer Produktivität einschränken würde. Hierzu würde aber auch ein Instrumentarium gehören, um Verteilungsunterschiede zwischen Volkswirtschaften zu minimieren bzw. gerecht auszugestalten. Aufgrund der internationalen Regelungen hätten die Nationalstaaten bessere Möglichkeiten ihre Sozialpolitik zu gestalten, ohne Rückschläge im Standortwettbewerb fürchten zu müssen. Gleichzeitig bedarf es aber auch einer Bereitstellung der nötigen finanziellen Reccourcen für die regelnden Instanzen durch die nationalen Regierungen bzw. die internationalen Organisationen.
Um diese Finanzmittel zur Verfügung stellen zu können, schlägt Zürn im Rahmen internationaler Regimes vor, eine internationale Regelung für die Einführung einer weltweiten Energiesteuer einzuführen, sowie die Festlegung von Rahmenvorgaben für die Steuergesetzgebung in den OECD-Ländern. Dies würde verhindern, daß systematisch die Steuern, die grenzüberschreitend-mobile Bemessungsgrundlagen besitzen, im Rahmen der Standortwettbewerbe gesenkt werden. Weiterhin spricht Zürn sich für die Einführung einer sog. Tobin-Tax aus. Sinnvoll wäre die Besteuerung von internationalen Geldströmen in Höhe von 0,5 Prozent. Das würde zum einen die spekulativen Aktivitäten an den Geld- und Finanzmärkten bremsen und den Nationalstaaten ein Mindestmaß an Autonomie im Bereich der Geldpolitik zurückgeben, ohne die gewünschten Direktinvestitionen zu behindern.
Alle Steuereinnahmen ließen sich zudem für die Finanzierung der Entwicklung in der Dritten Welt einsetzen.
5.3 Demokratisches Regieren
Zu Punkt 2, demokratisches Regieren, macht Zürn insgesamt sieben Vorschläge, die ich nachfolgend ebenfalls zusammenfassend skizziere. Generell sieht Zürn eine nicht ausreichende demokratische Legitimation der internationalen Institutionen. Dabei gibt es zwei wesentliche Momente, die den demokratischen Prozeß insgesamt beschreiben. Zum einen der Prozeß der Willensbildung (Deliberation) und zum anderen den Prozeß der Entscheidungsfindung (Willensaggregation). Beide Prozeße finden sich jedoch nur ungenügend als Teil eines von Individuen oder ihrer gewählten Repräsentanten gesteuerten Poltikformulierung im Rahmen der Denationalisierung wieder. Die Individuen sind somit nicht die geforderten Akteure der Demokratie. Das bedeutet, daß die von der Denationalisierung Betroffenen gleichzeitig keine Möglichkeit haben über demokratische Einflußmöglichkeiten in den internationalen Institutionen Politik mitzugestalten, und sich somit die Legitimationsbasis der interantionalen Institutionen lediglich auf die Dominanz der Interessen von Experten und staatlichen Akteuren stützt. Da die groben politischen Leitlinien der internationalen Institutionen von eben diesen Akteuren und Experten hinter verschlossenen Türen bestimmt werden, können diese Entscheidungen erheblich von gesellschaftlichen Grundforderungen abweichen und schaffen damit eine suprastaatliche Instanz, die jeglicher demokratischer Kontrolle entzogen ist. Gleichzeitig erhöhen sie die Gefahr der politischen Fragmentierung.
5.3.1 Demokratisierung der Entscheidungsprozesse und Öffnung der transnationalen Entscheidungsgremien
Aus diesem Grund fordert Zürn, um die Transparenz bei internationalen Verhandlungen herbeizuführen, der jeweiligen Regierungsdelegation eine kleine, nicht rede- und stimmberechtigte Gruppe zuzuordnen, "die im wesentlichen die Funktion besitzt, die nationale Öffentlichkeit über die Position, das Verhalten und die Verhandlungsstrategie der nationalen Regierung zu informieren. Diese Gruppe könnte sich teilweise aus Parlamentariern der Oppositionsparteien zusammensetzen. Um jedoch den strategischen Informationsmißbrauch durch die Opposition zu verhindern, sollten solche Gruppen auch Experten aus dem jeweiligen Politikfeld mit öffentlichem Bekanntheitsgrad umfassen"(Michael Zürn, S. 352).
Um auch mehr Transparenz in den Entscheidungsprozessen der EU herzustellen, fordert Zürn die Direktwahl für die nationalen Vertreter des Ministerrats. Diese sollten von den nationalen Wählern getrennt von der Bestellung der nationalen Regierung bestimmt werden. Dadurch verkürze sich die Legitimationskette des Ministerrats, und er würde zudem als kollektives Organ legitimiert. Sowohl die nationalen Regierungen als auch die nationalen Vertreter im Ministerrat müßten dann ihre Entscheidungen getrennt voneinander in der nationalen Öffentlichkeit rechtfertigen.
Gleichzeitig schlägt Zürn vor, stärker auf mehrheitsdemokratische Verfahren zu setzen. Dies meint insbesindere die Abhaltung von Referenden zu unterschiedlichen Themen der zukünftigen Politik der EU. Refernden könnten dazu dienen, europaweit vom Ministerrat beschlossen Entscheidungen rückgängi zu machen. Sie könnten ebenfalls die Intransparenz abbauen, stehen aber vor dem Problem, daß man eine Übereinkunft bräuchte, über welche Entscheidungen und Themen tatsächlich Referenden möglich sein sollen und mit welchem Quorum sie mindestens eingeleitet werden sollen. Auch wenn ein Referendum dann nicht stattfinden würde, würde es zumindest einen umfangreichen gesellschaftlichen Diskurs über die europäische Politk geben und die Legitimation der Institutionen und ihrer Entscheidungen stärker hinterfragt. Dies würde den Demokratisierungsprozeß in der EU fördern (Michael Zürn. S. 352).
Zürn stützt sich bei seinen Ausführungen insbesondere auf die Schweiz sowie auf die USA, die auf lokaler Ebene über eine Vielzahl direktdemokratischer Element verfügen. Ihre Vorteile lägen vo allem in den integrativen Leistungen und daß den Stimmbürgern die Möglichkeit gegeben wird, Eigenmächtigkeiten und leeren Aktionismus der politischen Klasse zu bändigen.
Ein weiterer Vorschlag Michael Zürns ist die Stärkung des Europäischen Parlaments. Dies soll durch die Betonung der parteipolitischen gegenüber der nationalstaaatlich Orientierung erreicht werden und würde für die europäischen Parteienverbünde bedeuten, die Listen für die Wahl zum Europäischen Parlament nicht mehr national festlegen zu können. Eine Stimme für die Grünen in Berlin könnte somit auch den Grünen in Athen nützen.
Die Schaffung von solchen mehrheitsdemokratischen Verfahren würde stärker gemeinschaftsgenerierend als -verzehrend wirken und eine Entlastung für den Verhandlungskoloß EU bieten.
5.3.2 Stärkung der assoziativen Demokratie durch und mit deliberativen Netzwerken und Entscheidungsvrfahren
Die letzten drei Vorschläge von Michael Zürn setzen den Schwerpunkt auf den Ausbau der assoziativen Demokratie durch die Erhöhung der Repräsentativität deliberativer Netzwerke. Diese Netzwerke würden insbesondere durch die verschiedensten NGOs, wie aber auch durch unterschiedlichste nicht-staatliche und öffentliche Wissensgemeinschaften von Experten und Politikern sowie möglichen Vertretern der staatlichen oder EU-Politik repräsentiert. Diese Netzwerke könnten zwischenstaatliche Verhandlungen und Entscheidungsfindungen begleitend unterstützen. Ihre Arbeit und die Entscheidungsfindung, bei schwierigen und für die Bevölkerung besonders relevanten politischen Entscheidungen, sollten aber durch mehrheitsdemokratische Verfahren flankiert werden.
Um die Legitimität solcher transnationaler Entscheidungsneztwerke zu stärken, hält Zürn es für notwendig, den Zutritt zu diesen transnationalen Entscheidungsnetzwerke zu regeln. "Demnach dürften all jene Interessengruppen an den Treffen teilnehmen, die zumindest (a) eine Betroffenheit plausibel machen und somit bei der Umsetzung der Regelung hilfreich sein können, (b) in mehreren der betroffenen Länder über eine organisatorische Verankerung verfügen und (c) demokratische und transparente Verfahren im Innern aufweisen"(Michael Zürn, S. 359). Ein weiterer Vorschlag Zürns bezieht sich auf Ausführungen von Philippe C. Schmitter, der vorschlug, daß Interessengruppen, Wissensgemeinschaften und NGOs, die Möglichkeit erhalten sollten, einen semi-öffentlichen Status zu beantragen. Damit würde die Finanzierung dieser Gruppen durch verpflichtende Beiträge, die die EU-Kommission von den Steuerzahlern erhält, möglich. Die hierfür geringen Zusatzsteuern würden in Form von »Gutscheinen«, mit denen die Bürger der EU beliebige, ihnen wichtige Gruppen unterstützen könnten, zugute kommen, sofern sie einen semi-öffentlichen Status besitzen und zu bestimmten Entscheidungsnetzwerken zugelassen sind. Im Ergebnis steigert sich - so die Argumentation von Schmitter - dadurch die Repräsentativität dieser Netzwerke deutlich, ohne daß sie ihre deliberativen Qualitäten verlieren. Darüber hinaus wären diese Verfahren transparenz- und identitätsfördernd (Michael Zürn, S. 360).
5.3.4 Ausbau der direkt-deliberativen Demokratie auf lokaler Ebene
Zürn sieht im Ausbau der direkt-deliberativen Demokratie einer außerordentlich gute Möglichkeit Demokratie- und Entscheidungsfindungsprozesse transparenter zu machen. Dennoch räumt er ein, daß dies bei einer zu großen Zahl von Individuen und wenn die Anzahl der Betroffenen mit der Ausweitung der sozialen Handlungsräume zunimmt, immer schwieriger wird. In diesem Zusammenhang schlägt er vor, insbesondere in Städten, Stadtteilen und Kleinregionen mit ungefähr bis zu 2 Mio. Einwohnern Raum für lokal begrenzte Entscheidungen mit direkt-deliberativen Elementen zu schaffen. In lokalen Foren würden kollektive Entscheidungen durch öffentliche Auseinandersetzungen, an denen alle Betroffenen teilnehmen können, getroffen werden können. Dabei sollten die Möglichkeiten und Grenzen dieses Demokratieelements nicht unterschätzt werden; gerade im Hinblick auf Entscheidungen im Rahmen der europäischen Regional- und Strukurpolitik. Trotzdem fällt der Umgang mit der Komplexität des Regierens dem Einzelnen leichter, wenn es klar erkennbare Bereiche gibt, in denen eine unmittelbare Partizipation und Einflußnahme erfahrbar sei (Michael Zürn, S. 361).
6. Chancen und Risiken des "Komplexen Weltregierens"
Die Verwirklichung der Ziele des komplexen Weltregierens hängt in starkem Maße davon ab, inwieweit es gelingt, die Fragmentierungserscheinungen unter Kontrolle zu bekommen. Da derezeit ein symbolisches Bezugssystem zur Herausbildung kollektiver Identitäten fehlt und die derzeitigen Denationalisierungstendenzen den Fragmentierungsprozeß eher beschleunigen, geht es im Rahmen der Ziele des Regierens, Sicherheit, Legitimation, Identität und soziale Wohlfahrt darum, diesem Prozeß im Sinne von mehr Demokratie im Bereich der Mehrebenenpolitik zu begegnen. Das bedeutet Herstellung der politischen Handlungsfähigkeit im Sinne der Zielerreichung des Regierens und die Herstellung größerer Mitwirkungschancen der Individuen.
Das Projekt des Komplexen Weltregierens setzt aber die Fähigkeit des Individuums zur reflexiven Selbsteuerung voraus und die Bereitschaft Eigeninteressen zurückzustellen, wenn es gute universalistische Gründe für ein gemeinwohlorientiertes Verhalten gibt. Dies gilt ebenso für politische Organisationen und Institutionen.. Dadurch werde dem Individuum mehr an intellektueller Kapazität, normativer Toleranz und Solidarität abverlangt als jemals zuvor in der Geschichte (Michael Zürn, S. 363). Dies setzt gleichzeitig auf seiten des Individuums neben kognitiven auch moralische Kompetenzen voraus. Zürn gesteht ehrlicherweise ein, daß die Realisierungschancen dieser Vision eines Weltbürgertum derzeit eher negativ einzuschätzen sind.
Dieser Einschätzung stimme ich zu, gleichzeitig bin ich der Auffassung, daß die derzeitigen Bedingungen und die Struktur und Handlungsfähigkeit der bestehenden internationalen Organisationen und Netzwerke, wie auch die dominierenden Kräfte der Weltpolitik, sich nur in begrenztem Maße in ein Projekt des komplexen Weltregierens integrieren lassen. Ich möchte das an mehreren Beispielen aufzeigen.
6.1 Sicherheit
Zwar ist die Zahl der kriegerischen Auseinadersetzungen zwischen OECD-Staaten gesunken, das bedeuet jedoch nicht, daß wie im Falle Jugoslawien, Kriege in Europa ausgeschlossen sind. Weiterhin ist zu beobachten, daß die Intensität der Kriegsfolgen für die betroffenen Länder erheblichere Auswirkungen hat, als in früheren Konflikten. Insbesondere die Kriege der NATO und USA gegen den Irak und Jugoslawien waren mit solcherart Zerstörungen verbunden, daß diese Länder für Jahrzehnte nicht mehr in der Lage sein werden, ihrer Bevölkerung einen halbwegs ausreichenden Lebenstandard zu sichern. Tatsächlich wurden die gesamte Infrastruktur, Fabriken, das Gesundheits- und Bildungsystem entweder gleich mit zerstört oder durch die nachfolgenden Embargos in ihrer Funktionsfähigkeit stark geschädigt.
Weiterhin gibt es in Afrika Kriege zwischen Staaten, Bürgerkriege und Genozids in bisher ungekanntem Ausmaß. Im Grunde befindet sich der halbe Kontinent im Kriegszustand.
Es deutet sich im Rahmen der zukünftigen Entwicklungen an, daß zwar in den entwickelten OECD-Ländern Kriege ausbleiben werden, dafür aber in den unterentwickelten Ländern aufgrund globaler Verteilungsungerechtigkeiten und Ressourcenverknappung (Wasser, Naahrungsmittel etc.) die Kriegsgefahr steigen wird. Am Beispiel Liberias ist deutlich geworden, über wie wenig Handlungskompetenz und -fähigkeit die UNO, wie aber auch die afrikanische Friedentruppe verfügt, diesen Konflikt einzugrenzen und einzudämmen.
Auffällig ist dabei, daß die USA immer mehr als Hegemonialmacht auftreten und versuchen gegen die UNO die Rolle der Weltpolizei zu übernehmen. Ihre Interessen sind dabei jedoch sehr einseitig. Es geht ihnen weniger um Menschenrechte, als um ökonomische und geostrategische Interessen. Denn im Falle der afrikanischen Konflikte halten sich die USA (obwohl es anders als im Kosovo in Uganda und Burundi ein millionenfaches Abschlachten von Menschen gegeben hat) sehr bedeckt. Zukünftig besteht die Gefahr, das sicherheitspolitische Vereinbarungen und Verträge nur dann Chancen auf Implementierung haben, wenn sie nicht die sicherheitspolitischen Interessen der USA negativ berühren. Das würde die Rolle der USA als einzige Welt- und Hegemonialmacht zementieren und dürfte das letzte sein, was man den Völkern die Welt wünschen sollte. Wo in diesem Fall internationale Institutionen und Organisationen eine friedensstiftende Rolle spielen sollen, bleibt unklar.
6.2 Legitimität und Demokratie
Die von Zürn geforderten deliberativen und direkt-deliberativen Demokratieelemente haben sicherlich etwas faszinierendes an sich und dürften tatsächlich zu einer Demokratiserung der verschiedenen politischen Enscheidungsebenen und -institutionen führen. Ich sehe aber nicht, daß es derzeit ausreichend starke gesellschaftliche Strömungen gibt, die einen Diskurs in diese Richtung initieren könnten. Hinzu kommt, daß die meisten europäischen wie auch globalen Institutionen sehr klar formulierte Interessen verfolgen, die hauptsächlich ökonomisch determiniert sind. Es geht vor allem darum, wie dem internationalem Kapital die besten Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Akkumulation geschaffen werden können. Dies schließt eine Einflußnahme der davon Betroffenen logischerweise aus. Zum anderen halte ich diese Institutionen für außerordentlich absorbtionsfähig, dies meint, daß selbst wenn beispielsweise NGOs Zugang zu solchen Institutionen hätten, die stille Korrumpierung ihrer Vertreter und der gesamten Organisation drohen kann. Dies hat es bereits mehrfach gegeben und auch die Partei DIE GRÜNEN ist ein Beispiel dafür, wie durch die Einbindung in einen parlamentarischen und institutionellen Prozeß politische Zielforderungen verändert werden. Dies mittels einer noch so demokratischen Kontrolle verhinern zu können, halte ich für schwierig.
Ebenfalls bedeutet die Demokratisierung einer Institution noch lange nicht, daß damit auch ihr Funktionszusammenhang und ihre Zielsetzung verändert werden. Dies läßt sich besonders an Aktiengesellschaften beobachten, deren Funktion es schlichtweg ist, Gewinne für ihre Aktionäre zu erwirtschaften. Letztlich sind diese Organisationen durch und durch "demokratisch", weil die Anteilseigner, nämlich die Aktienbesitzer sehr wohl Einfluß auf die Geschäftspolitik "ihres" Unternehmens nehmen können. Eines werden sie aber sicher nicht tun, einer Geschäftspolitik zuzustimmen, die erwarten läßt, daß die Divendenzahlungen ausfallen und der Kurs der Aktie sinkt. Das bedeutet, bevor es zu einer Demokratissierung von Institutionen kommt, muß der Funktionszusammenhang und die Zielsetzung der Institutionen geklärt werden und einem demokratischen Entscheidungsfindungsprozeß unterworfen werden. Anderenfalls würde die Demokratisierung aufgrund der "Sachzwänge" nur zu einer Akklamationsinstanz bereits feststehender Entscheidungen verkommen.
Ein weiters Problem für direkt-deliberative Demokratieelemente, insbesondere im lokalen Entscheidungsbereich, dürfte die zunehmende Politikverdrossenheit und ein aufgrund der vielen Korruptionsaffären nachvollziehbares Desinteresse des bundesdeutschen Wahlvolks gegenüber ihren Parlamentariern sein. "Die da oben machen doch, was sie wollen", dieser Satz bezeichnet eine Haltung, die zunehmend mehr Bundesbürger einnehmen. Konkret spiegelt sich diese Politikverdrosenheit in einer immer geringeren Wahlbeteiligung, vor allem bei Landtagswahlen, wie auch bei Kommunalwahlen wieder. Das bedeuet, daß viele Bürger selbst auf der kommunalen Ebene, wo man den jeweiligen Politiker meist noch persönlich kennt, und seine Politik stärker kontrollieren und einschätzen kann, das Vertrauen in die Veränderbarkeit politischer Entscheidungsprozese verloren haben und die parlamentarischen und kommunalen Institutionen vom Bürgerinteresse abgelöst agieren. Gegen diese verkrusteten Institutionen direkt-deliberative Demokratie-Elemente setzen zu wollen, halte ich angesichts des Desinteresses vieler Bürger für sinnlos. Auch hier müßte, wie bereits oben beschrieben, der Funktionszusammenhang der kommunalen Institutionen neu geklärt werden, bevor man direkt-deliberative Elemente in die politischen Entscheidungsprozesse einfügt. Man sollte sehr klar formulieren, was geht und was geht nicht. Hinzu kommt, daß es einer ganzen Reihe gesetzlicher Änderungen (Gemeinde-, Kommunal-, und Landesverfassungen) bedarf. Ob die Entscheidungsträger, in diesem Fall Kommunalpolitiker und Landtagsabgeordnete, diesen Änderungen zustimmen würden, wage ich zu bezweifeln.
6.3 Identität
Michael Zürn hat als eine der Folgen der Denationalisierung Regionalismus und Autonomiebewegungen genannt. Ich denke nicht, daß dieses Problem für die Bundesrepublik wirklich relevant ist, dies bestätigte Zürn durch seine theoretischen Überlegungen und eine grafische Darstellung seines Hypothesenmodells zum Regionalismus (Michael Zürn, S. 283). Das besagt jedoch nicht, daß die Bundesrepublik trotz eines föderalen Systems und des Länderausgleichs von solchen Erscheinungen verschont bleibt. Die derzeitige Diskussion um die Neugliederung des Länderausgleichs macht jedoch deutlich, daß die starken Regionen nicht mehr umstandslos bereit sind, den schwächeren zu helfen. Vor allem die Ministerpräsidenten Bayerns, Baden-Württembergs und Hessens haben deutlich gemacht, daß sie das bisherige System abschaffen wollen. Das würde bedeuten, das Bundesländer wie Bremen, das Saarland, Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern erheblich weniger Geld aus dem Länderausgleich erhalten würden. Die Betrebungen der reichen Bundesländer ihren Anteil zuungunsten der ärmeren zu kürzen, kann man sehr wohl als den Anfang einer besonderen Spielart des Regionalismus in Deutschland bezeichnen. Zum anderen gibt es in der deutschen Parteienlandschaft zwei Parteien, nämlich die CSU und die PDS, die sehr wohl eine stark regionalistisch geprägte Politik verfolgen. Auch hiermit werden latente Feindschaften zwischen Bevölkerungsteilen in Nord-, Süd-, und Ostdeutschland verschärft.
Denationalisierung und Globalisierung tragen durch die Zerschlagung bewährter Lebens-, Arbeitsformen und kultureller Traditionen zu einer enormen Zerstörung individueller, wie auch von "Wir"-Identitäten bei. Sie erzeugen Unsicherheit und Vereinzelung und bieten damit neues Terrain für Interessengruppen, die über die Rekonstruktion neuer "Wir"-Identitäten politische Ziele verfolgen, die die Gesellschaft spalten, zur Polarisierung und zur Ausgrenzung gesellschaftlicher Gruppen beitragen. Michael Zürns Modell trägt diesem Umstand insofern Rechnung, daß er die Herstellung der vier Ziele des Regierens für unabdingbar hält, um Fragmentierungserscheinungen wie Rechtsradikalismus oder Regionalismus zu vermeiden. Weiterhin konstatiert er, daß es derzeit keine Aussicht auf die Konstituierung einer Identitätsbildung im Sinne einer philosophisch-moralischen Vision reflexiver Selbststeuerung autonomer Individuen gibt, die er bereits in Kapitel 6. skizziert hat. Konsequenterweise bedeutet das, da ja diese vier Ziel derzeit nicht genügend umgesetzt werden, daß es zu einer weiteren gefährlichen Identitätsbildung in obiger Weise kommen wird. Dies auch deshalb, weil durch die Affäre in Nordrhein-Westfalen um die Flüge des SPD Ministerpräsidenten, den Rücktritt des niedersächsischen Ministerpräsidenten im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen, und das öffentliche Auftreten der des Amtsmißbrauch und Korruption verdächtigten Führungsspitze der CDU, die politische Elite der BRD an Glaubwürdigkeit verloren hat. Auch durch meine eigenen Erfahrungen mit rechtsradikalen Jugendlichen und Geprächen mit Führungsmitgliedern der schleswig-holsteinischen Neonazi-Szene weiß ich, daß dies zu einer enormen Legendenbildung beiträgt, die sich in ernstgemeinten und absurden Verschwörungstheorien äußert, wie aber auch in einem unerhörten Sendungsbewußtsein. "Irgendwann wird der Tag kommen, und dann werden wir den ganzen Sauhaufen ausmisten".
6.4 Soziale Wohlfahrt
Die Sozialpolitik der der einzelnen Mitgliedsstaaten der EU ist durch sehr vielfältige und unterschiedliche Interessenlagen, wie politische Strategien gekennzeichnet. Bei aller Wertschätzung, die ich gegenüber dem Modell von Michael Zürn habe, bleibt jedoch zu konstatieren, daß die entscheidenden Impulse zum Umbau der Sozialsysteme eindeutig aus den Reihen der Wirtschaft und ihrer Interssenverbände kamen und sich die Politik dem unterordnete. Dies hat in einzelnen Berichen zu einer Privatisierung der sozialen Risiken, wie Arbeitsplatzverlust, Gesundheits- und Altersvorsorge geführt und zu einem Rückzug einzelner Nationalstaaten der EU aus der aktiven Arbeitsmarktpolitik (insbesondere Großbritannien und Deutschland).
Insbesonder die Diskussion um die Reformierung des deutschen Bildungssystems macht deutlich, daß es letztlich zu einer Neustrukturierung dieses Systems im Sinne der Wirtschaft kommen wird. Der Stat wird sich auch hier immer mehr zurückziehen und die Verantwortung für die Bildungseinrichtungen und ihre Finanzierung an die Wirtschaft und die Individuen abgeben. Das bedeutet in letzter Konsequenz ein Bildungssystem, dessen Bildungskosten enorm hoch sind und dessen Hochschulsystem nur noch wenigen offenstehen wird und der Elitenföderung vorbehalten ist.
Daß diese beschriebenen Entwicklungen zukünftig durch eine veränderte nationalstaatliche Politik eine andere Richtung nehmen werden, ist derzeit ausgeschlossen. Ebenso werden sie der sozialen Fragmentierung Vorschub leisten.
Auch im Bereich der internationalen Organisationen ist die Bereitschaft, Sozialstandards festzulegen oder sie gar durchzusetzen, nicht sichtbar. Auch hier sind vor allem die ökonomischen Kräfte Bremser für eine Politik des sozialen Ausgleichs, der sich ja nicht nur auf Arbeitnehmer und Kapitaleigner in den OECD-Ländern beschränken sollte, sondern auch auf die Verteilungsgerechtigkeit zwischen den entwickelten und unterentwickleten Ländern dieser Welt. Ich nenne diesen Aspekt die internationale Wohlfahrt. Michael Zürn hat im übrigen diesen Aspekt nicht ausreichend in seinem Modell des komplexen Weltregierens berücksichtigt. Dabei ist die Verteilungsgerechtigkeit ein Schlüssel für die Beziehungen der Menschen und Staaten untereinander. Fragmentierungenerscheinungen werden in diesem Sinne als mögliche oder bereits schwelende Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen insbesondere in der dritten Welt sichtbar (aktuelles Beispiel Äthiopien, Eritrea), sind aber genauso in Ländern wie der Türkei sichtbar, in denen ganze Volksgruppen von der sozialen Entwicklung ausgeschlossen und ausgegegrenzt werden. Gleichzeitig beeinflußt die Verteilungsungerechtigkeit aber auch die Kooperationsbereitschaft der unterentwickelten Länder mit den entwickelten Ländern bei der gemeinsamen Vereinbarung von Sicherheitssystemen, internationalen Regelungen und institutionellen Zusammenhängen. Ein funktionierendes weltweites Sicherheitsnetzwerk muß sehr wohl auch Sorge dafür tragen, daß eine ungleichzeitige und ungleichmäßige ökonomische Entwicklung der Staaten dieser Erde vermieden wird. Dies setzt natürlich auch die Bereitschaft der entwickelten Länder oder einer internationalen Institution zu Transferleistungen in die unterentwickelten Länder voraus. Denkbar wäre ein Modell, wie es Gerd Grözinger in seiner Arbeit "Weltbürgerschaft und Nationalitätslotterie - Zwei Überlegungen zur globalen Verteilung von Reichtum und Bevölkerung" beschrieben hat. Diese Bereitschaft mag ich jedoch zur Zeit nicht ausmachen. Auch hier ist also mit zunehmenden Fragmentierungserscheinungen zu rechnen.
7. Resümee
Die Notwendigkeit des Modells des komplexen Weltregierens erscheint angesichts der beschriebenen Denationalisierungs- und Globalisierungstendenzen einleuchtend. Auch daß die globalen Probleme nur mittels internationaler Institutionen, die demokratisch verankert sein müssen, und einer partnerschaftlichen und dialogorientierten Konfliktlösung verpflichtet sind, gelöst werden können, erscheint ebenfalls notwendig und sinnvoll.
Dennoch scheinen die derzeitigen Bedingungen, die globalen ökonomischen, sozialen und politischen Voraussetzungen nicht geeignet, um die Realisierung solch eines Modells zu gewährleisten. Michael Zürns Modell hat zudem mehrere Schwachpunkte, was die mögliche Durchsetzung und Wirksamkeit angeht. Zum einen sind es die beschriebenen Fragmentierungserscheinungen in vielen OECD-Ländern, wie auch in anderen Ländern dieser Welt, zum anderen stehen der Realisierung des Modells ganz konkrete Interessenlagen entgegen. Insbesondere der Hegemonialabspruch der USA, die einseitige Orientierung auf die Durchsetzung ökonomischer Interessen im Rahmen internationaler Vereinbarungen und Institutionen sowie eine fehlende demokratische Struktur und Tradition in diesen Institutionen erschweren die Realisierung des Modells.
Einen ganz entscheidenden Schwachpunkt sehe ich in der Ausklammerung der dritten Welt und ihrer Probleme, sowie die weltweite Verteilungsungerechtigkeit. Michael Zürn beleuchtet im Großen und Ganzen nur die OECD-Welt, während der Rest der Welt mit immerhin über viereinhalb Milliarden Menschen, in seinem Modell nur ungenügend berücksichtigt wird. Dies führt bei seinen Ausführungen zu einer stark eurozentristischen und teilweise ökonomischen Betrachtungsweise der Denationalisierungs- und Globalisierungsprobleme, wie auch der Fragmentierungserscheinungen. Wenn ihm dabei sicherlich fortschrittliche und den sozialen Ausgleich fordernde Absichten zu unterstellen sind, führt das in der Konsequenz zu einer methoschen Schieflage bei der Beurteilung der zukünftigen Entwicklungstendenzen, die er zudem sehr widersprüchlich schildert.
Faßt man seine Ausführungen und die anderer Autoren zusammen, insbesondere was die Denationalsierungstendenzen und Fragmentierungserscheinungen angeht, so bleibt nur noch ein sehr pessimistisches Bild der Zukunft. Es droht die von Michal Zürn angedeutete und von Polanyi in seiner bahnbrechenden Arbeit "The Great Transformation" beschriebene ungeregelte und chaotische Transformation, der krisenhafte Übergang in ein neues, entweder globalisiertes oder aber "fragmentiertes" Zeitalter.
Auch wenn die Denationalisierung und Globalisierung nicht mehr unumkehrbar sind, bleibt dennoch die Frage, wie können Menschen, die Politik und ihre Institutionen diesen Prozeß noch beeinflussen. Das herauszufinden ist die Herausforderung, der wir uns in den kommenden Jahren stellen werden müssen.
8. Literatur
Beck, Ulrich: Risikogesellschaft - Auf dem Weg in eine andere Moderne; Frankfurt a. M. 1986
Brunkhorst, Hauke; Kettner Matthias (Hrsg.): Globalisierung und Demokratie; Frankfurt a. M. 2000
Bourdieu, Pierre: Gegenfeuer - Wortmeldungen im Dienste des Widerstandes gegen die neoliberale Invasion; Frankfurt a. M. 1999
Forrester, Viviane: Der Terror der Ökonomie; Wien 1997
Grözinger, Gerd: Weltbürgerschaft und Nationalitätslotterie - Zwei Überlegungen zur globalen Verteilung von Reichtum und Bevölkerung, in: Brunkhorst, Hauke (Hrsg.):
Demokratischer Experimentalismus; Frankfurt a. M. 1998; S. 175-200
Link, Werner: Die Neuordnung der Weltpolitik - Grundprobleme globaler Politik an der Schwelle zum 21. Jahrhunder; Frankfurt a. M. 1999
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Dokuments "Komplexes Weltregieren"?
Das Dokument behandelt das Thema der Globalisierung, Denationalisierung und die Notwendigkeit neuer Formen des Regierens jenseits des Nationalstaates. Es untersucht, wie internationale Institutionen agieren, welche Ziele ein "Komplexes Weltregieren" verfolgt und welche Handlungsvorschläge es gibt, um soziale Gerechtigkeit und Demokratie in einer globalisierten Welt zu fördern. Abschließend werden die Chancen und Risiken dieses Ansatzes diskutiert.
Was versteht man unter Denationalisierung und Globalisierung im Kontext dieses Dokuments?
Denationalisierung wird als die zunehmende Einbindung nationaler Sozial-, Wirtschafts- und Rechtssysteme in größere Systeme (z.B. die EU) verstanden, wodurch der Handlungsspielraum für nationalstaatliche Politik eingeschränkt wird. Globalisierung hingegen wird als ein weltweiter ökonomischer Zwang zur Ausweitung der internationalen Arbeitsteilung und des Austauschs von Gütern, Waren, Geld und Dienstleistungen gesehen.
Welche Probleme und Krisenerscheinungen werden im Zusammenhang mit dem Denationalisierungsprozess genannt?
Das Dokument nennt das Externalitätsproblem (nationalstaatliche Regelungen sind ineffektiv, da sie nur einen Teil des betroffenen Handlungszusammenhangs abdecken), das Effizienzproblem (nationale Regelungen behindern den freien internationalen Austausch) und das Problem des Politikwettbewerbs (Länder versuchen, durch niedrige Löhne und Steuern attraktiv für Investoren zu sein).
Welche Ziele des Regierens werden im Kontext des demokratischen Wohlfahrtsstaates genannt?
Die Ziele des Regierens umfassen den inneren und äußeren Frieden (Sicherheit), ein zivil konstituiertes Zusammengehörigkeitsgefühl (Identität), demokratische Entscheidungsverfahren (Legitimation) und eine für alle Seiten akzeptable Balance von wirtschaftlicher Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit (soziale Wohlfahrt).
Welche unterschiedlichen Formen des Regierens werden unterschieden?
Es werden drei Grundformen des Regierens unterschieden: governance by government (hierarchische Regelung durch eine übergeordnete Zentralinstanz), governance with government (kooperative Regelung unter Beteiligung von Instanzen mit hierarchischen Befugnissen) und governance without government (Selbstorganisation ohne Rückgriff auf übergeordnete Zentralinstanzen).
Welche Rolle spielen internationale Institutionen beim Regieren jenseits des Nationalstaats?
Internationale Organisationen spielen eine Schlüsselrolle bei der Einhaltung internationaler Regelungen und Vereinbarungen. Sie schaffen dauerhafte Verhaltensmuster und setzen Normen und Regeln durch, die das Handlungsrepertoire der Akteure bestimmen.
Welche Handlungsvorschläge werden im Sinne des "Komplexen Weltregierens" genannt?
Die Handlungsvorschläge umfassen Maßnahmen zur Förderung sozialer Gerechtigkeit auf nationalstaatlicher Ebene (z.B. ein einkommenssteuergestütztes Sozialsystem, die Bezuschussung von Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich, die Beteiligung der Arbeitnehmer am Gewinn der Unternehmen) sowie internationale Regelungen zur Festlegung von Sozialstandards und zur Einführung einer weltweiten Energiesteuer und einer Tobin-Tax. Bezüglich des demokratischen Regierens werden die Demokratisierung der Entscheidungsprozesse, die Öffnung der transnationalen Entscheidungsgremien, die Stärkung der assoziativen Demokratie und der Ausbau der direkt-deliberativen Demokratie auf lokaler Ebene vorgeschlagen.
Welche Chancen und Risiken werden mit dem "Komplexen Weltregieren" verbunden?
Zu den Chancen gehören die Herstellung politischer Handlungsfähigkeit, die Förderung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit sowie die Eindämmung von Fragmentierungserscheinungen. Zu den Risiken zählen die fehlende Bereitschaft des Individuums zur reflexiven Selbststeuerung, die Dominanz ökonomischer Interessen, eine mögliche Legitimationskrise internationaler Institutionen und die Gefahr der Spaltung der Gesellschaften.
Welche Kritik wird an Michael Zürns Modell des komplexen Weltregierens geäußert?
Es wird kritisiert, dass das Modell die OECD-Welt zu stark in den Fokus nimmt und die Probleme der Dritten Welt und die weltweite Verteilungsungerechtigkeit nicht ausreichend berücksichtigt. Zudem werden die bestehenden Machtverhältnisse und die einseitige Orientierung auf ökonomische Interessen als Hindernisse für die Realisierung des Modells angesehen.
Welche Formen der internationalen Demokratie werden im Text vorgeschlagen?
Vorgeschlagen werden der jeweiligen Regierungsdelegation eine Gruppe zuzuordnen, die im wesentlichen die Funktion besitzt, die nationale Öffentlichkeit über die Position, das Verhalten und die Verhandlungsstrategie der nationalen Regierung zu informieren, die Direktwahl für die nationalen Vertreter des Ministerrats. Diese sollten von den nationalen Wählern getrennt von der Bestellung der nationalen Regierung bestimmt werden und Abhaltung von Referenden zu unterschiedlichen Themen der zukünftigen Politik der EU.
- Citation du texte
- Jörg Pepmeyer (Auteur), 2000, Regieren jenseits des Nationalstaats - Politikoptionen im Zeichen der Globalisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107967