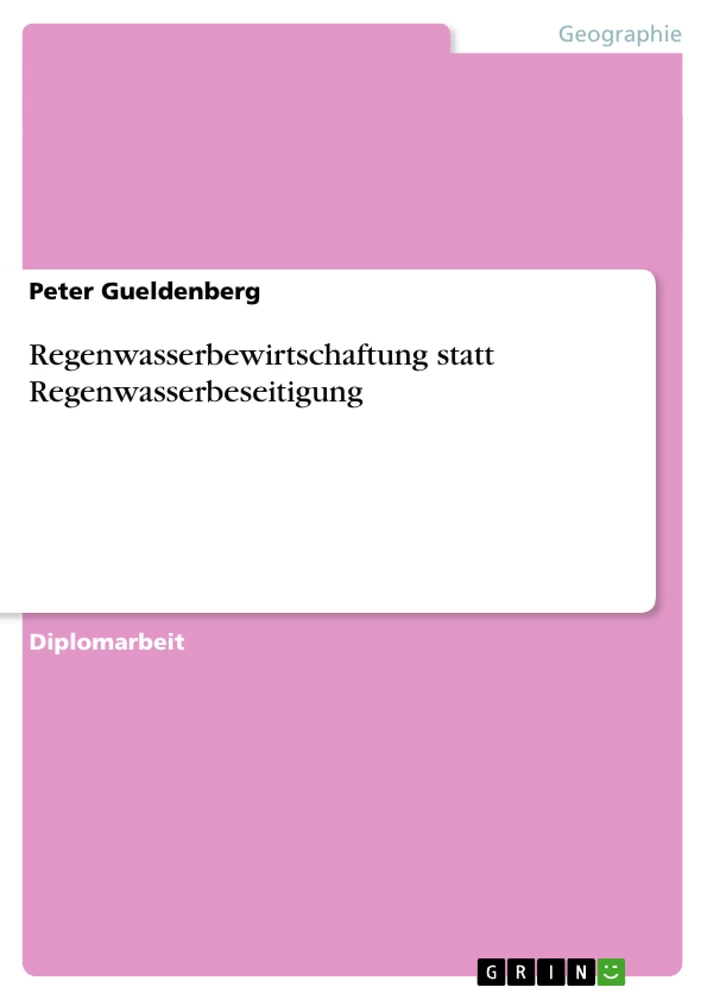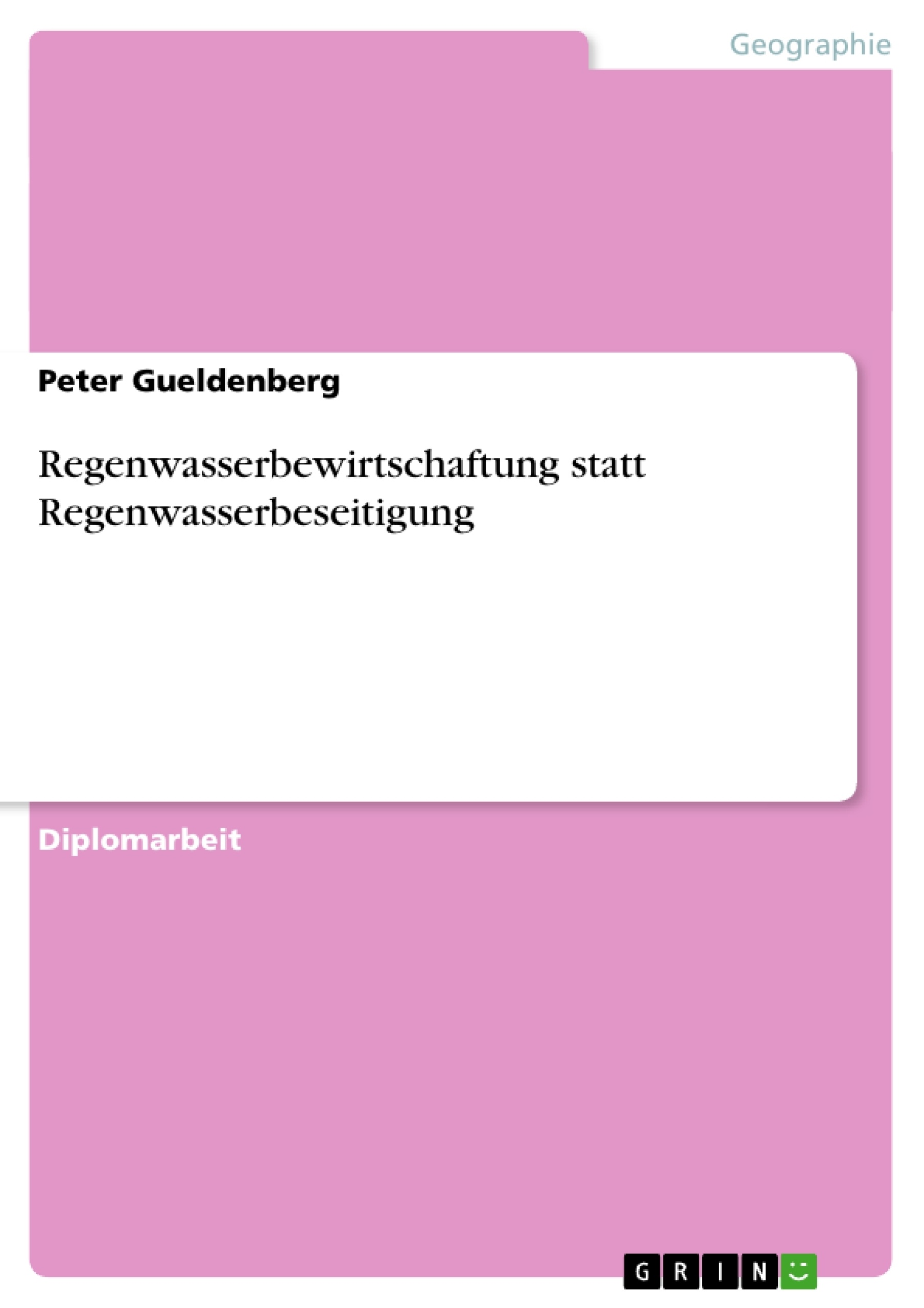Das Grundproblem der Siedlungsentwässerung ist seit Jahrhunderten von allen Kulturen gemeistert worden. Kurios scheint allerdings die sehr aktuelle Überschwemmungsproblematik in Siedlungsgebieten. Warum bekommt eine Hochzivilisation, wie die unsere, die über die nötige geistige Kompetenz sowie die nötigen finanziellen Mittel verfügt, ihre Wasser- und Abwasserbewirtschaftung nicht sicher in den Griff ? Die jüngsten Hochwasser vom 30 Oktober 1998 und den folgenden Tagen zeigten dies noch mal in aller Schärfe. Die Ursachen sind bekannt. Lösungen sind auch bekannt. Aber das Grundproblem scheint darin zu liegen, dass die Schäden nicht am Orte der Ursache entstehen, wo der Leidensdruck nicht so hoch wird, dass er zum Handeln zwingt. Erst durch mittlere und große Katastrophen wird die Akzeptanz der Öffentlichkeit für den Verordneten Abhilfezwang seitens Politik und öffentlicher Verwaltung in Gestalt von Gesetz und Vorschrift erhöht. Es scheint also endlich eine neue Entwicklung der Regenwasserbewirtschaftung Fuß zu fassen. Die Kindertage der Versickerungsanlagen und Regenwassernutzungsanlagen sind vorbei. Es wurde viel geforscht und untersucht. Das Datenmaterial ist aufbereitet. Mehrjährige Betriebserfahrungen liegen in vielen Bereichen vor. Gesetzliche Möglichkeiten für den Einsatz dieser Techniken wurden geschaffen. Jetzt liegt es an den Planenden, den Genehmigenden und den Auftraggebern, die neuen Möglichkeiten sinnvoll auszuschöpfen.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Versicherung
Allgemeine Hinweise zur Diplomarbeit
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Regenwasserbewirtschaftung statt -beseitigung
1.1 Die Probleme erkennen
1.2 Zielvorgaben definieren
1.3 Wege zur Umsetzung verfolgen
1.4 Technik und Gesetz allein reichen nicht aus
2 Grundlagen zur Versickerung
2.1 Definition der dezentralen Versickerung
2.2 Bodenphysikalische Grundlagen der Versickerung
2.2.1 Natürlicher Bodenwasserhaushalt
2.2.2 Anthropogene Beeinflussung des Bodenwasserhaushaltes
2.3 Boden und Grundwasser – Schutz und Gefährdung
2.3.1 Schutzpotential des Bodens
2.3.2 Gefährdungspotential des Grundwassers
3 Verordneter Rigorismus – Gesetz und Stand der Technik
3.1 Wasserrecht
3.1.1 Bundesrecht - Wassserhaushaltsgesetz
3.1.2 Landesrecht - Landeswassergesetze
3.1.3 Veränderungen in Baden-Württemberg
3.1.4 Recht zur Regenwassernutzung
3.2 Standards - (DIN und aRdT) - HOAI
4 Entwicklung in Deutschland
4.1 Verbreitung
4.2 Erfahrungen
4.3 Erkennbare Tendenz
5 Technische und hydrologische Grundlagen
5.1 Niederschlag
5.2 Maßgebliche Regenspende
5.3 Abfluss und Versickerung
5.3.1 Abflussbeiwert
5.3.2 Abfluss
5.3.3 Fließgeschwindigkeit (nach Manning/Strickler)
5.3.4 Versickerungsrate (Berechnung nach ATV 138 A)
5.4 Planungs- Untersuchungsmethodik
5.5 Dachfläche - Dachbegrünung
5.6 Regenwassernutzungsanlagen
5.6.1 Speicherzulauf und Filter
5.6.2 Speicherbehälter (Zisternen)
5.6.3 Blä bä
5.6.4 Speicherüberlauf
5.6.5 Wasserversorgung im Haus
5.7 Entwässerungstechnische Regenwasserversickerungsanlagen
5.7.1 Flächenversickerung
5.7.2 Muldenversickerung
5.7.3 Rohr- und Rigolenversickerung
5.7.4 Schachtversickerung
6 Projektgebiet - Grundlagen
6.1 Lage des Projektgebietes
6.2 Geologie und Hydrologie
6.2.1 Bodenuntersuchungen
6.2.2 Einfluss auf das Trinkwasserschutzgebiet Esslingen-Weil
6.3 Siedlungsstruktur
6.3.1 Beschreibung
6.3.2 Beurteilung hinsichtlich der Regenwasserbewirtschaftung
7 Pläne und Erläuterung
7.1 Planverzeichnis:
7.1.1 ad 1. : (P-1) Entwässerungstechn. Regenwasserversickerung
7.1.2 ad 2. : (P-2) Flächen und Volumina zur Regenwasserversickerung
7.1.3 ad 3. : (P-3) Schnitt von Süd nach Nord, Ansicht Haus 5 u
7.1.4 ad 4. : (P-4) Übersichtsplan, Esslingen – Breite, M 1:
7.1.5 ad 5. : (D-1) Detail Dachbegrünung
7.1.6 ad 6. : (D-2) Detail Rinne/Mulde
7.1.7 Lage des Projektgebietes im Wasserschutzgebiet,
7.2 Sicherungsmaßnahmen für die Bauphase
8 Betrieb und Wartung der Versickerungsanlagen
8.1 Sicherheitsmaßnahmen
8.2 Winterbetrieb
8.3 Pflege und Wartung
9 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Tabellen im Anhang
Anhang
Tabellen der Flächen und Volumenberechnung
Mindestdimensionierung
Flächen und Volumina
Sicherheitsnachweis durch Einbeziehung von Regenstatistik
Mustersatzung (nach Roth 1995)
Allgemeine Hinweise zur Diplomarbeit
Eine Diplomarbeit ist eine Prüfung, die lehrveranstaltungsübergreifend die Kenntnisse in ihrem Zusammenhang am Ende des Hauptstudiums nachweisen soll.
Die Diplomarbeit ist eine Arbeit in eigener Verantwortlichkeit, die zeigen soll, ob der Absolvent die Fähigkeit zu selbständiger wissenschaftlicher/künstlerischer Arbeit erworben hat.
Eine Bearbeitung in Gruppen bis zu 3 Absolventen ist möglich. Einzelleistungen der Gruppenmitglieder müssen erkennbar bleiben. Die Betreuer prüfen und bestätigen die Erkennbarkeit und bewerten die Einzelleistungen.
Aufgrund der hohen Gewichtung der Arbeit im Zeugnis und Übertragung in die Praxis ist die Betreuung nur organisatorischer Art.
Vorwort
Das Grundproblem der Siedlungsentwässerung ist seit Jahrhunderten von allen Kulturen gemeistert worden. Kurios scheint allerdings die sehr aktuelle Überschwemmungsproblematik in Siedlungsgebieten. Warum bekommt eine Hochzivilisation, wie die unsere, die über die nötige geistige Kompetenz sowie die nötigen finanziellen Mittel verfügt, ihre Wasser- und Abwasserbewirtschaftung nicht sicher in den Griff ? Die jüngsten Hochwasser vom 30 Oktober 1998 und den folgenden Tagen zeigten dies noch mal in aller Schärfe. Die Ursachen sind bekannt. Lösungen sind auch bekannt. Aber das Grundproblem scheint darin zu liegen, dass die Schäden nicht am Orte der Ursache entstehen, wo der Leidensdruck nicht so hoch wird, dass er zum Handeln zwingt. Erst durch mittlere und große Katastrophen wird die Akzeptanz der Öffentlichkeit für den Verordneten Abhilfezwang seitens Politik und öffentlicher Verwaltung in Gestalt von Gesetz und Vorschrift erhöht. Es scheint also endlich eine neue Entwicklung der Regenwasserbewirtschaftung Fuß zu fassen. Die Kindertage der Versickerungsanlagen und Regenwassernutzungsanlagen sind vorbei. Es wurde viel geforscht und untersucht. Das Datenmaterial ist aufbereitet. Mehrjährige Betriebserfahrungen liegen in vielen Bereichen vor. Gesetzliche Möglichkeiten für den Einsatz dieser Techniken wurden geschaffen. Jetzt liegt es an den Planenden, den Genehmigenden und den Auftraggebern, die neuen Möglichkeiten sinnvoll auszuschöpfen.
Einleitung
Wie schon im Vorwort angesprochen sind Problematik und Lösungen dem Prinzip nach längst bekannt. Kaum bekannt hingegen ist, dass Wassersparen, Baukosten senken, Umwelt- und Naturschutz betreiben aus Sicht der Regenwasserbewirtschaftung gut vereinbar sind. Intention dieser Diplomarbeit ist, es die Möglichkeiten einer sinnvollen Regenwasserbewirtschaftung so konkret es geht und möglichst kurz zu erläutern und die Vorteile, wie auch die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, doch möglichst vollständig darzustellen. Damit der Bezug zur Planung dabei nicht verloren geht, ist ab Kapitel 6 ein konkretes Bauprojekt untersucht und hinsichtlich der Regenwasserbewirtschaftung überplant worden. Es wurde kein Optimalgebiet, als Spielwiese für Entwässerungsplaner ausgesucht, sondern ein beliebiges Baugebiet, das auch eine Reihe von Konflikten mit sich bringt, wie es am ehesten dem planerischen Alltag entsprechen dürfte. Ziel der Arbeit ist es aber vor allem, den aktuellen Stand der Möglichkeiten, Risiken und natürlich auch die gesetzlichen Vorgaben samt deren Entwicklungspotential zu untersuchen.
1.1 Die Probleme erkennen
Abb.1Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Abb.2Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 Wasserhaushalt „Gewachsener“ Boden, und Abb. 2 Pflaster (aus König 1996, leicht verändert)
Abbildung 1 und 2 zeigen sehr deutlich, wie sich die Komponenten des Wasserhaushaltes verändern. Abfluss und Verdunstung machen bei einer versiegelten Fläche, wie beispielsweise bei einer mit Pflaster versiegelten Fläche 95% des Niederschlags aus; für den Bodenwasserhaushalt bleiben nur noch 5%.
Beim „gewachsenen“ Boden sind es noch 62%. 5% verdunsten noch bevor sie abfließen oder versickern können. 50% verdunsten über die Boden- und Pflanzenoberflächen. Lediglich 17% des Niederschlags führen zur Grundwasserneubildung.
Durch die rigorose Ableitung von Niederschlagswasser auf dem schnellsten Wege im Misch- oder Trennsystem sind nicht nur Probleme gelöst worden, sondern auch eine ganze Reihe neuer entstanden. Dabei darf nicht übersehen werden, dass diese Art der Regenwasserbeseitigung für stark und höchst verdichtete Siedlungsgebiete entwickelt wurde, aber sich unvernünftigerweise auch im nicht so dichten und sogar im ländlichen Raum etabliert hat.
Nicht nur das in den letzten Jahren gestiegene Umweltbewusstsein, sondern auch oder gerade aus wasserwirtschaftlichen und damit verbundenen ökonomischen Zwängen erwachsene Erkenntnisse haben zu einem Überdenken der herkömmlichen Strategien der reinen „Beseitigung“ (WHG BaWü 1997) von Niederschlagswasser geführt. Der Ausdruck „Bewirtschaftung“ scheint aus strikt ökologischer Perspektive noch zu technisch und anthropozentrisch zu klingen, doch darf auf keinen Fall unterschlagen werden, dass die bisherigen Zielsetzungen der Entwässerung weiterhin Bestandteil bzw. Teilmenge eines funktionierenden Konzeptes sein sollten. Siedlungsflächen und Verkehrsflächen sind weiterhin vor Überflutungen zu schützen, unerwünschte Vernässungen von Grundstücken wie auch Gebäuden sollten vermieden und einwandfreie hygienischer Verhältnisse erhalten werden.
Die sich zweifelsfrei ergebenden Nachteile der üblichen Beseitigung müssen allerdings wahrgenommen und durch neue Strategien bewältigt werden.
- So kommt es in Gebieten mit hohem Anteil an versiegelten Flächen zur verminderten Grundwasserbildung bis zum Totalausfall, mit den daraus resultierenden Folgen für den Grundwasserhaushalt.
- Es tritt eine Abflussverschärfung der Gewässer durch Starkregenereignisse auf, und umgekehrt wird der vom Grundwasser beeinflusste Niedrigwasserabfluss vermindert.
- Die Hochwassergefahr steigt ebenso wie die Gefahr des ökologischen „Umkippens“ in Trockenperioden.
- Gewässer werden stärker verschmutzt, weil insbesondere bei Mischwassersystemen (65% in Deutschland) nahezu jeder überdurchschnittliche Regen zu einem Überlaufen der Kläranlagen führt und dabei das Schmutzwasser ebenfalls ungeklärt in die Gewässer gelangt.
- Höhere Wasserstände führen zu höheren Fließgeschwindigkeiten. Das bedeutet hydraulischen Stress für die gesamte Biozönose und den Biotop selbst.
- Milliarden an Steuergeldern werden darauf verwandt, Speicherbecken im Mischwassersystem zu bauen, um ein Überlaufen zu verzögern.
- Schutzmaßnahmen durch wasserbauliche Techniken lindern nur örtlich die Probleme und verschieben sie gewässerabwärts.
- Überschwemmungen von Siedlungsgebieten in Gewässernähe häufen sich.
- In Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung werden für Aufbereitung und Transport (hoher Druck, weite Entfernungen) enorme Energiemengen eingesetzt.
Diese vielfältigen Symptome können auf Dauer nur durch die Behebung ihrer Ursachen am Entstehungsort nachhaltig und mit Erfolg vermindert oder beseitigt werden. Ein Arbeiten an den Symptomen selbst führt nur zu einer zeitlichen oder räumlichen Verlagerung des Problems, wenn nicht sogar zu einer Verschärfung. Deswegen ist es wichtig, klare Zielvorgaben in diese Richtung zu entwickeln. Patentlösungen sind nicht zu erwarten. Die Komplexität der Aufgaben und ihre Gewichtung nach den örtlichen Randbedingungen zwingen zu einer ewig neuen Bewältigung der Problematik (Sieker 1995, Grottke 1995, Schmitt 1995).
1.2 Zielvorgaben definieren
Oberstes Ziel muss es sein, durch Vorgaben für eine Regenwasserbewirtschaftung zu sorgen, die den Abfluss bereits in der Fläche gezielt und kontrolliert vermindert oder dämpft, bevor es zur Ableitung im Trenn- oder Mischsystem überhaupt kommt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3 Abflussspenden bei unterschiedlicher Geländenutzung in l/(s×km²) und die resultierenden Wasserstände (Emscher-Genossenschaft 1993)
Die wesentlichen Vorgaben sind:
- Der bisherige Stand an Sicherheit gegen Überflutungen und Vernässungen und der hygienische Standard müssen erhalten bleiben.
- Die Nachteile des Ableitungssystems sollten weitestgehend gemindert werden
- Die Kosten sollen sich im bisher üblichen Rahmen bewegen.
Das alleinige Ziel der bisherigen Praxis der Regenwasserbeseitigung besteht darin, die Ortsnetze so zu dimensionieren, dass der sogenannte Bemessungsregen ungedrosselt abfließen kann (ATV-A 118). Dabei werden also die Leitungsquerschnitte diesem Bemessungsabfluss vorgegeben.
Diese Zielvorgabe muss dahingehend geändert werden, dass nunmehr eine höchst zulässige Abflussspende festgelegt wird. Sie soll möglichst nahe an dem Wert liegen, der vor der Bebauung des Gebietes aufgetreten ist. Die jeweiligen Abflussspenden unbebauter Gebiete sind im allgemeinen um eine Zehnerpotenz niedriger als die bebauter Flächen. Das bedeutet, sie liegen im Bereich von 2-10 l/s×ha statt 20-100 l/s×ha (Sieker 1995).
Das hat zur Folge, dass das Ableitungssysten, wenn überhaupt noch nötig, in deutlich kleineren Durchmessern gebaut werden kann. Per Gemeidesatzung wird der Grundstückseigner dazu verpflichtet, die zulässigen Abflussspenden einzuhalten. Sihe hierzu: (Roth 1995) Mustersatzung für die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung, Veröffentlicht in: Zeitschrift für Stadtentwässerung und Gewässerschutz, Heft 32/1995. SuG-Verlag Hannover), im Anhang.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Schema der Regenwasserbewirtschaftung vor Ort (Londong 1997)
Ein nicht zu vernachlässigendes Ziel muss eine Beschränkung des Rechtes auf Ableitung der im Regenwasserabfluss enthaltenen Schmutzstoffe sein. In diesem Bereich liegen ausreichende Erfahrungen über den effektiven Einsatz von Bodenfiltern in dezentralen Anlagen vor (König 1996).
Eine weitere Vorgabe sollte darin bestehen, dass eine optimale Bewirtschaftung des Grundwassers in Siedlungsgebieten in direktem Zusammenhang mit dem anfallenden Regenwasser betrachtet werden muss. Der optimale Flurabstand ist dann erreicht, wenn er dem vor der Bebauung möglichst nahe kommt, vorausgesetzt, dass der Grundwasserstand nicht schon vorher durch andere Eingriffe zum Schlechten beeinflusst worden ist, ohne dass dabei Schädigungen hervorgerufen werden. Naturgemäß kann dieses Ziel zuerst da verfolgt werden, wo der Flurabstand schon am größten ist. Die Wirkung einer solchen Maßnahme ist in erster Linie eine Stärkung der Leistungsfähigkeit des Grundwasserleiters zur Wasserversorgung und zur Kompensation der Niedrigwasserabflüsse (Sieker 1995).
In ländlichen Gebieten können weitere Ziele angestrebt werden. Der Anteil von versiegelten Verkehrsflächen, Forst- und Feldwegen sollte so gering wie möglich sein. Die Vegetationsdichte sollte erhöht werden. Sei es durch Gründüngung auf Brachen, Untersaaten zwischen den Feldfrüchten oder anderen Maßnahmen, die den Deckungsgrad der Vegetation erhöhen und somit den Anteil an Verdunstung und Interzeption erhöhen (Abb. 3).
1.3 Wege zur Umsetzung verfolgen
Der Regelungsbedarf liegt bei der Stadt- und Raumplanung, der Entwässerungsplanung sowie in der Land- und Forstwirtschaft. Zur erfolgreichen Umsetzung besteht Handlungsbedarf bezüglich besserer Verständigung und Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen der öffentlichen Verwaltung (Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Naturschutz), den privaten Planungsbüros und den ausführenden Firmen der unterschiedlichen Disziplinen. Ziele können nur erreicht werden, wenn alle Beteiligten sie klar formulieren und an ihrem Erreichen aktiv mitarbeiten. Das klingt plausibel, ist aber weit davon entfernt, Standard in der Planung zu sein (Handschmann 1996). Oft genug werden so einfache Dinge, wie etwa die Führung der Regenfallrohre an der falschen Gebäudeseite zum Problem. Versickert wird meist gartenseitig, und in die Kanalisation wird vor dem Haus zur Straße eingeleitet (Eigene Beobachtung in der Praxis).
Gut geeignet für ökologisch verträgliche Konzepte sind flache oder flachgeneigte Gebiete, auch wenn die Sickereigenschaften des Untergrundes nicht optimal sind. In solchen Fällen ist es immer möglich, dezentrale Versickerungsanlagen ohne eine Gefährdung der Unterlieger zu realisieren.
Bei der Entwässerung von Erschließungen in Hanglagen ist auch bei guter Sickerfähigkeit des Bodens immer die Gefahr von Hangwasseraustritten und Hangrutschungen gegeben und deshalb der Schwerpunkt der Regenwasserbewirtschaftung eher auf eine Regenwassernutzungsanlage zu legen.
Der einfachste Weg Oberflächenabflüsse zu minimieren ist der, auf Versiegelung zu verzichten und so eine flächige Versickerung zu ermöglichen.
Die einzelnen Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung, geordnet nach Vorrangigkeit bei der Planung:
- Flächenversiegelungen vermeidenund verringern durch flächensparende Bebauungs- und Enrschließungsformen. Bei Neubau muss auf wasserdurchlässige Befestigungsmaterialien und bei Sanierung auf Entsiegelungsmöglichkeiten geachtet werden.
- Retention durchDachbegrünungsollte bei Flachdächern bis zu 25% Neigung immer berücksichtigt werden.
- Vegetationsdichteim Gebiet erhöhen, damit Interzeption und Verdunstung auf der Pflanzenoberfläche zunehmen. Hier ist verständlicherweise mit Großbäumen mehr zu erreichen als mit Bodendeckern.
- Schadstoffarme Materialienverwenden, um die Belastung des Regenwassers auf ein Minimum zu beschränken.
- Möglichst alles anfallendeRegenwasser dezentral versickernund hierbei folgende Hierarchie nach der umweltschonendsten Methode beachten:
- Flächenversickerung
- Muldenversickerung
- Muldenrigolenversickerung
- Rigolenversickerung
- Schachtversickerung
- Alternativ oder parallel zur VersickerungDachwasser speichernund nutzen.
- Wasserführung inoffenen Rinnenerleichtert die Wartung, senkt Kosten im Bau und hält zum disziplinierten Umgang mit den Leitungsbahnen an.
- DieEinleitung in oberirdisches Gewässervon minderbelasteten Regenwasserabflüssen ist der Ableitung und der damit verbundenen Vermischung mit Schmutzwasser in der Kanalisation vorzuziehen.
- DasEinleiten in die Kanalisationsollte nur dann geschehen, wenn die Kapazitäten von Regenwassernutzungs- oder –versickerungsanlagen überschritten werden, und als Überlauf kein geeignetes oberirdisches Gewässer zur Verfügung steht.
1.4 Technik und Gesetz allein reichen nicht aus
Erfahrungen in der Arbeit von zahlreichen Modellprojekten haben ergeben, dass die Beschleunigung bisher langwieriger Verfahrensabläufe auf zwei verschiedene Arten erreicht werden kann.
Als Erstes sei hier die Auslobung eines Wettbewerbes, der nicht wie sonst üblich von Einzelnen, sondern in einem interdisziplinären Team bearbeitet wird.
Als Zweites gibt es die Möglichkeit einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe, die regelmäßig zusammentrifft. Dynamisierung durch Kommunikation, Weiterentwicklung und Kurskorrektur beschleunigt das Projekt und erhöht die Qualität der Planung. Wichtig ist dabei nicht nur ein interdisziplinäres Team, sondern auch die Integration aller an der Genehmigung Beteiligten. Nur so ist ein offener Informationsaustausch mit frühzeitiger Abstimmung der Planung von Anfang an zu gewährleisten. Eine so optimierte Planung wirkt umweltschonend und kostendämpfend. Es können bis zu 30% der Erschließungskosten eingespart werden. Der Bauherr spart Kanalgebühren und Kosten für immer teurer werdendes Trinkwasser. Die Gemeinde hat hier außerdem noch die Möglichkeit der Kosteneinsparung durch einen erheblich reduzierten Ausgleichsbedarf (Fischer 1995).
2 Grundlagen zur Versickerung
2.1 Definition der dezentralen Versickerung
Der Begriff der „dezentralen Versickerung“ nach dem Arbeitsblatt A 138 der Abwassertechnischen Vereinigung e.V. (ATV 1990) meint die gezielte und bewusste Einleitung von aus Niederschlägen resultierenden Oberflächenabflüssen befestigter Siedlungs- oder Verkehrsflächen in eine besonders für diese Zwecke geeignete und ausgebildete bodengebundene Anlage oder in einen für diese Maßnahme funktional ausgebildeten Bereich (ATV 1990).
2.2 Bodenphysikalische Grundlagen der Versickerung
2.2.1 Natürlicher Bodenwasserhaushalt
Die wichtigsten Komponenten des Bodenwasserhaushaltes sind:
- Niederschlag
- Evapotranspiration (= Transpiration + Interzeption + Evaporation)
- Versickerung
- Oberflächenabfluss
- kapillarer Aufstieg
Die Bewegung bzw. die Bindung des Wassers im Boden wird vor allem durch zwei bodenhydrologische Basisbeziehungen bestimmt:
1. der Beziehung zwischen Wassergehalt und Wasserspannung,
2. der Beziehung zwischen Wasserdurchlässigkeit und Wasserspannung.
Die unter 1. genannte Beziehung ist umgekehrt proportional. Ist der Boden trocken, geringer Wassergehalt, ist die Wasserspannung hoch und umgekehrt. Das resultiert aus den auftretenden Kapillar- und Adhäsionskräften in den teils mikroskopisch kleinen Poren des Bodens, was auch die Bedeutung der Lagerungsdichte erklärt (Scheffer/Schachtschabel, 1992).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Beziehung zwischen Wasserspannung und Wassergehalt (10³ cm WS = 1 bar) FK = Feldkapazität; PWP = Permanenter Welkpunkt (Scheffer/Schachtschabel 1992)
Die unter 2. genannte Beziehung ist für die Wassermobilität ausschlaggebend. Ist das Gesamtpotential = 0 (Abb2), bedeutet dies, dass die Wasserbindungskraft des Bodens genauso groß ist wie die auf das Wasser wirkende Erdanziehungskraft. Dies ist in der Natur aber nur ein theoretischer Punkt, der beim Wechsel zwischen Verdunstung und Infiltration jeweils überschritten wird. In der Praxis bedeutet das, dass bei negativem Gesamtpotential Grundwasser aufsteigt und bei einem positiven Versickerungen stattfinden. Böden können Wasser halten, ansaugen oder abgeben bzw. leiten.
Die Saugspannung oder Wasserspannung ist die aus dem Gesamtpotential wirkende Kraft ohne Richtung. Sie ist der Betrag ohne Vorzeichen.
Mathematisch ausgedrückt bedeutet dies Yh = Ym + Yz .
Y (das Potential) bezeichnet die Arbeit, die das Wasser verrichten muss, um sich im Boden zu bewegen. Dabei ist Yh das hydraulisch wirksame Gesamtpotential, welches sich aus der Summe von Ym, dem Matrixpotential des Bodens und Yz dem Gravitationspotential ergibt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Abb. 6: (aus BORGWARDT 1995)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7: Beziehung zwischen Wasserleitfähigkeit und Wasserspannung (100 cm/Tag = 1cm/Tag » 10-7 m/s)
(aus Sukopp u. Wittig 1993)
Das Ausmaß der Versickerung (entspricht der Durchlässigkeit K) ist im Wesentlichen von der Korngrößenverteilung beeinflusst. Diese variiert stark je nach Bodenart. Der Oberboden unterliegt also einem ständigen Wechsel zwischen Infiltration und Verdunstung (Borgwardt 1995).
Da bei uns die Menge der Niederschläge höher ist als die der Verdunstung oder des Oberflächenabflusses, bilden sich im Boden dauerhaft wassergesättigte Bereiche. Grund- und Stauwasser werden durch wasserundurchlässige bzw. schlecht leitende Horizonte gehalten. Hier sammelt sich das Sickerwasser und von hier erfolgt kapillarer Aufstieg.Verschiedene Böden weisen je nach Bodenart, Lagerungsdichte und Gehalt an organischer Substanz sehr unterschiedliche Ausprägungen der hydraulischen Eigenschaften auf.
Sehr wichtig für die im Folgenden behandelten Versickerungsvorgänge ist die Wasserdurchlässigkeit. Sie findet Ausdruck im Durchlässigkeitskoeffizienten Kf. Er gibt die Geschwindigkeit in m/s an, mit der sich das Wasser im Boden bewegt.
Tab. 1: Typische Kf –Werte für die verschiedenen Hauptbodenarten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wasserdurchlässigkeit von wassergesättigten Böden (nach Hartge und Horn 1991)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8: Schematische Darstellung der Wasserhaushaltskomponenten urbaner Böden (Renger 1993)
N = Niederschlag, T = Transpiration, I = Interzeption, E = Evapotranspiration, V = Versickerung, kA = kapillarer Aufstieg, DS = Wassergehaltsänderungen, A0 = Oberflächenabfluss
Es gilt die Wasserhaushaltsgleichung: N = T + I + E + V – kA + DS + A0.
Aus ihr wird ersichtlich, dass nahezu alles Wasser aus den Niederschlägen der betrachteten Region stammt und welch starke Veränderung die in Abb. 3 dargestellten Komponenten der Gleichung durch eine urbane Flächennutzung erfahren (Renger 1993).
Tab 2: Wasserhaushaltskomponennten in %, 100% = Niederschlag im Jahr
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(nach Glugla et al. 1987)
V= Versieglungsgrad,Et= Evapotranspiration,Ao= Oberflächenabfluss
GWneu= Grundwasserneubildung (Versickerung und kapillarer Aufstieg)
(Renger 1993).
Hierbei darf nicht vergessen werden, dass Gletscherabflüsse aus den Hochgebirgen, die auch während längerer Trockenperioden die großen Ströme mit Wasser versorgen, einen Ausgleich bewirken und dass Tallagen, die durch Grundwasserströmungen und den Oberflächenabflüssen aus höher gelegenen Gebieten mit Wasser versorgt werden. Dieser Umstand wird mit DS (Abb. 8) berücksichtigt.
Man kann sich sehr gut vorstellen, was hier die Klimaerwärmung durch den Treibhauseffekt bewirkt, wenn die Niederschläge in den Alpen immer häufiger als Regen fallen und sofort in die Täler abfließen. Die Gletscher tauen stärker ab, als sie mit Schnee genährt werden. Mit dem Schwinden der Gletscher schwinden dann auch die Niedrigwasserstände der großen Ströme, weil die Gletscherabflüsse ausbleiben.
2.2.2 Anthropogene Beeinflussung des Bodenwasserhaushaltes
Städtische Böden weisen im Vergleich zu anderen Böden stark veränderte Merkmale auf. Hier sind die wichtigsten, die den Bodenwasserhaushalt beeinflussen:
- Oberflächenversiegelungen
- Verdichtungen
- höhere Steingehalte
- Ablagerungen von technogenen Substraten
- erhöhte Humusgehalte bis in 0,5m Tiefe
- Veränderung des Grundwasserstandes
Das führt zur Veränderung des gesamten Wasserhaushaltes im besiedelten Bereich.
Wichtige Regelgrößen wie Evaporation, Wasserspeicherung, Grundwasserneubildung, kapillarer Aufstieg, oberirdischer Abfluss und Stoffverlagerung werden beeinflusst.
Der Anteil der Siedlungsfläche in den alten Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland beträgt ca. 12%. Es kommen jährlich 400 km² dazu. Etwa ein Drittel dieser Flächen ist versiegelt (Renger 1993). Das Volumen des Oberflächenabflusses vergrößert sich dabei um bis zu 70% allein auf den Verkehrsflächen (Muth 1989).
Diese nahezu wasserundurchlässigen Oberflächen und der damit verbundene Bau von Kanalisation führen zu verminderter Grundwasserneubildung und Evaporation. Der Wärmehaushalt verändert sich durch fehlende Verdunstung. In gleichem Maße verstärkt sich der Oberflächenabfluss und damit der Hochwasserabfluss in den natürlichen Gewässern.
Die höheren Abflussgeschwindigkeiten bedingen eine geringere Reinigung des Wassers, bevor es ein oberirdisches Gewässer erreicht. Es kommt zu einem regelrechten Wasserstoß. Die Gewässerbelastung durch Schad- und Schwebstoffe nimmt zu. Die Kapazitäten der Kläranlagen an Mischsystemen sind schnell überschritten, und die gesamte Schmutzwasserfracht geht ungeklärt in die Gewässer. Das nun in oberirdischen Gewässern schnell abfließende Regenwasser steht nicht mehr zur Grundwasserneubildung zur Verfügung. Der Grundwasserstand sinkt. Außerdem fallen die hierdurch am stärksten belasteten Gewässer auch verstärkt trocken, sobald die Niederschläge ausbleiben. Diese Erscheinungen sind sonst nur in ariden oder semiariden Gebieten zu beobachten (Renger 1993).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 9: Durchlässigkeit von Lockergesteinen (ATV 1990)
2.3 Boden und Grundwasser – Schutz und Gefährdung
Boden und Grundwasser stehen in enger Beziehung zueinander. Verschiedene Böden haben sehr unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Wasserdurchlässigkeit, -speicher- und -reinigungsvermögen.
2.3.1 Schutzpotential des Bodens
Das Grundwasser ist durch das natürliche Rückhalte- und Reingungsvermögen des über ihm liegenden Untergrundes je nach Bodenart und Horizontfolge mehr oder weniger ausreichend gegen Schadstoffe, die von der Oberfläche her in den Untergrund eindringen, geschützt. Das Reinigungsvermögen resultiert aus dem Wirken vieler physikalischer, chemischer und biologischer Reaktionen, die einer starken Beeinflussung durch Transportvorgänge und den hydrologischen Gegebenheiten unterworfen sind. Das Ausmaß der natürlichen Reaktionen im Untergrund ist unterschiedlich. In wassergefüllten Grundwasserleitern oder Stauhorizonten stehen Lösung und Verdünnung im Vordergrund. In den darüberliegenden Bodenhorizonten laufen die anderen Reaktionen, wie Filtration, Adsorption, Ionenaustausch, Fällung, biologischer Abbau mit größerer Intensität ab. Dabei liegt das Leistungsmaximum in den belebten Horizonten, weshalb ein unverletzter Oberboden besonders wichtig für den Schutz des Grundwassers ist (ATV 1990).
Man kann aber keineswegs davon ausgehen, dass das natürliche Reinigungsvermögen in jedem Fall ausreicht, um das Grundwasser vor jeglicher Schädigung zu schützen.
Ein sehr bindiger Boden der Tonfraktion kann nach kurzer Zeit der Infiltration aufquellen und so zu einem oberflächlichen Stauhorizont werden. Er stellt in diesem Zustand einen nahezu vollständigen Schutz des Grundwassers vor belastetem Sickerwasser dar. Bei einem solchen Boden ist nicht nur jegliches Versickern nahezu unmöglich, wodurch hier die Grundwasserneubildung ihr Minimum hat, sondern hier überwiegt der Oberflächenabfluss. Das führt bei einer unzureichenden Vegetaionsdecke zu Erosionsschäden und unwiederbringlichem Bodenverlust. Ein anderes Extrem stellen sandig-kiesige Böden dar. Hier versickert der ganze Niederschlag in kürzester Zeit und erreicht den Grundwasserspiegel sehr schnell. Die Qualität des Grundwassers leidet allerdings unter der geringen Reinigungskraft von solchen Deckschichten, die zu schnell durchdrungen werden, als dass die oben genannten Reaktionen in ausreichendem Umfang ablaufen könnten.
Ein schluffiger Boden oder Horizont liegt genau in der Mitte zwischen den beiden Extremen. Sein Reinigungsvermögen verspricht gute Wasserqualität durch längere Verweildauer in den Deckschichten, und seine mittlere Durchlässigkeit führt auch zu einer ausreichenden Grundwasserneubildung.
2.3.2 Gefährdungspotential des Grundwassers
Durch mit Schadstoffen belastete Niederschlagsabflüsse besteht eine Gefährdung für das Grundwasser. Als Schadstoffe gelten solche Chemikalien, von denen etwa im mg/l-Bereich eine Toxizität für die belebte Umwelt ausgeht. Sie kommen in relevanten Konzentrationen in der Umwelt vor und sind anthropogenen Ursprungs( Birgisson 1988).
.
Tab. 3: Relevante organische Schadstoffe bei der Regenwasserversickerung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(nach Grotehusmann 1995, leicht verändert)
Tab. 4: Relevante Schwermetalle als Schadstoffe bei der Regenwasserversickerung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(nach Grotehusmann 1995, leicht verändert)
Die mit dem Niederschlagsabfluss transportierten Wasserinhaltsstoffe stellen bei ihrer Versickerung ein ernsthaftes Problem dar. Als „nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser“ definiert (nach ATV-A138) ist solches von Dach-, Terrassenflächen von überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken , Verwaltungsgebäuden und ähnlich genutzten Anwesen (auch im gewerblichen Bereich), solange derartige Flächen in nicht durch Emission bzw. Immission besonders beeinflussten Gebieten liegen. Unausgesprochen bleibt hier, dass auch diese Niederschlagsabflüsse schadstoffbelastet sind.
Die stoffliche Belastung resultiert aus der Primärbelastung der Niederschläge und einer zusätzlichen am Abflussbildungsort. Schon auf dem Weg zur Erdoberfläche reichert sich der Niederschlag durch Aufnahme von Feinstpartikeln und Aerosolen aus der Atmosphäre mit Stoffen an. Entscheidend für diese Primärbelastung des Niederschlagswassers ist die großräumige Emissionssituation.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 10: Prozesse bei der Regenwasserversickerung (Grothehusmann 1995)
Dieses Stoffpotential des Niederschlags belastet nicht nur den Oberflächenabfluss in urbanen Gebieten, sondern wird auch in der freien Landschaft vom Wasserkreislauf aufgenommen.
Nur durch Verminderung der Stoffemissionen ist die Primärbelastung und damit die potentielle Gefährdung der Gewässer und des Grundwassers zu vermindern.
Partikelförmige Stoffe sedimentieren als trockene Deposition auf der Erdoberfläche. Dort reichern sie sich an. Hinzu kommen die Emissionen aus Industrie, Hausbrand und Verkehr aus der unmittelbaren Umgebung. Niederschläge tragen diese Stoffe ab und transportieren sie mit ihrem Wasser. Die Einflussgrößen auf die daraus hervorgehende Stoffkonzentration im Abfluss sind die Primärbelastung des Niederschlagswassers: die Stoffmenge und Zusammensetzung auf der Oberfläche, die hydraulischen Eigenschaften der Oberflächen und die Niederschlagsintensität.
Das Wasser sammelt sich in Mulden und kleinsten Vertiefungen (wie auch in entwässerungstechnischen Versickerungsanlagen), wobei ein Teil der Stofffracht durch Sedimentation und Filterwirkung auf der Bodenoberfläche dem Sickerwasser entzogen wird, welches sich weiter Richtung Grundwasser bewegt.
Noch im Oberboden ist die darin enthaltene organische Substanz für den Rückhalt durch Anlagerung der meisten organischen Verbindungen verantwortlich. Damit stellt der humose Oberboden die entscheidende Barriere gegen das Vordringen dieser Stoffe ins Grundwasser dar. Eine weitere Anlagerung organischer Verbindungen, hauptsächlich kationischer Biozide, wenn auch weniger fest, geschieht an Tonmineralen (Scheffer, Schachtschabel 1992).
Tab. 5: Relative Bindungsstärke von Schwermetallen an Humus und Tonmineralboden bei pH-Werten unterhalb des angegebenen Grenz-pH
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(nach DVWK 1988 leicht verändert)
Als wichtigste Einflußgröße für die Mobilität von Schwermetallen im Boden gilt der pH-Wert. Die Schwermetalllöslichkeit und damit ihre Mobilität nimmt bei sinkendem pH nicht gleichmäßig zu, sondern schlagartig bei einem bestimmten Grenz-pH-Wert ab. Neutrale bis leicht alkalische Böden sind daher der beste Schutz gegen Schwermetalle. Sehr saure Waldböden haben einen pH-Wert von 3 (Grotehusmann 1995).
3 Verordneter Rigorismus – Gesetz und Stand der Technik
„Niederschlagswasser von Dach- Hof- und Gehwegen ist nur dann „Abwasser“ im Sinne der Definition und wird deshalb nur dann nach dem Ländergesetz unter die Abwasserbeseitigungspflicht gestellt, wenn es aus Bereichen von bebauten und befestigten Flächen abfließt. Das Versickern von Niederschlagswasser auf Freiflächen ist ein natürlicher Vorgang und unterliegt keinerlei Gesetzen und Vorschriften. Werden Gebäude und Hofflächen so angelegt, dass die Niederschläge direkt an Ort und Stelle auf den vorhandenen Flächen zur Versickerung gebracht werden, ohne dass dabei Wasser aus dem Bereich befestigter oder bebauter Flächen abfließt, so rechnet dieses Wasser nicht zum Abwasser.“(ATV 1997).
Werden für die Versickerung Anlagen geschaffen, um es in den Untergrund und damit ins Grundwasser einzubringen, ist dadurch eine Gewässernutzung gegeben. Eine Gewässernutzung bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis.
Diese kann je nach Bundesland und Gemeinde recht unterschiedlich sein. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass eine ökologisch sinnvolle Regenwasserbewirtschaftung sich mehr und mehr durchsetzen wird und die Phase der allzu skeptischen Betrachtung seitens der Genehmigungsbehörden hoffentlich bald der Vergangenheit angehören wird.
3.1 Wasserrecht
Gesetzte, die Natur- und Umweltschutz beinhalten, legen in Ihren Grundsätzen ganz klar fest, dassvermeidbareBeeinträchtigungen des Naturhaushaltes und der Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu unterbleiben haben.
„Die Gewässer“ (lt. §1 WHG Abs. 1 Satz 2: Grundwasser zu den Gewässern) „sind als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften , dass sie dem Wohl der Allgemeinheit dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen unterbleiben.“ (§ 1a WHG),
„Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern, sparsam zu nutzen; der Verbrauch der Naturgüter ist so zu steuern, dass sie nachhaltig zur Verfügung stehen.“ (§ 2 BnatSchG Abs1 Satz 3,)
Damit ist die Richtung festgelegt. Was aber offen bleibt, ist die Frage der Vermeidbarkeit. Mögliche Antworten geben hier Überlegungen aus dem Bereich der Umweltökonomie. Vermeidbar ist aus dieser Sicht auf jeden Fall die Beeinträchtigung in Höhe jener Kosten, die durch Regulierung der dabei entstehenden Schäden entstehen. Die Kosten entstehen auf jeden Fall. Nur ist Vermeiden meist billiger als Reparieren. Der Bau von Regenrückhaltebecken schien lange Zeit günstiger als die Behebung von Hochwasserschäden. Hochwasser und Regenrückhaltebecken nehmen allerdings heutzutage Dimensionen an, die Grund zur Suche nach anderen Strategien geben.
Weiter gilt die Beeinträchtigung als ausreichend minimiert, wenn nach den sogenannten „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ geplant wird.
Sie finden sich in den Regelwerken der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV) und in den DIN-Normen. Gerade hier ergeben sich die meisten Gründe gegen eine differenzierte Planung der Regenwasserbewirtschaftung.
Grundsätzlich sind bei allen Planungen, die den Wasserhaushalt betreffen, sowie dem Bau und dem Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung die Vorgaben, die im Wasserhaushaltsgesetz (WHG), in den ausführenden Bestimmungen zu den Landesgesetzen (LWG), im Abwasserabgabegesetz (AbwAG) und in den zugehörigen Gemeindeordnungen gefordert sind, einzuhalten.
Praktisch bedeutet das, dass man zuerst nach einer gültigen Gemeindesatzung sehen muss, weil die im Idealfall mit den übergeordneten Gesetzten konform ist und den örtlichen Gegebenheiten angepasst ist.
Leider existiert eine solche Satzung hinsichtlich der Regenwasserbewirtschaftung in den wenigsten Gemeinden. Hier sei nochmals auf die Mustersatzung (Roth 1995, im Anhang, S. 85ff) verwiesen.
Bis vor wenigen Jahren galt Regenwasser generell als Abwasser und war als solches dem Betreiber des örtlichen Kanalnetzes gebührenpflichtig zu überlassen, damit dieser es auf dem schnellsten Weg Richtung Vorfluter (Trennsystem) oder Richtung Klärwerk (Mischsystem) transportiert. Dieser verordnete Rigorismus scheint nun langsam an Intensität zu verlieren.
3.1.1 Bundesrecht - Wassserhaushaltsgesetz
Hier (§ 2 Abs. 1 WHG) wird Folgendes grundsätzlich geregelt:
„Eine Benutzung der Gewässer bedarf der behördlichen Erlaubnis (§ 7 WHG) oder Bewilligung (§ 8 WHG), soweit sich nicht aus den Bestimmungen dieses Gesetzes oder aus den im Rahmen dieses Gesetzes erlassenen landesrechtlichen Bestimmungen etwas anderes ergibt“
Hinsichtlich einer Regenwasserversickerung muss als Erstes geprüft werden, ob es sich um eine Benutzung nach § 2 WHG handelt, wenn Bestimmungen des Landes hierzu keine Aussage treffen. Viele Bundesländer sehen inzwischen eine Regenwasserversickerung als Soll-Bestimmung vor.
In § 3 Abs.1 wird konkret aufgeführt, was eine Benutzung eines Gewässers im Sinne des Gesetzes ist:
1. „Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern,
2. Aufstauen und Absenken von oberirdischen Gewässern,
3. Entnehmen fester Stoffe aus oberirdischen Gewässern,
4. Einbringen und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer,
5. Einleiten von Stoffen in das Grundwasser,
6. Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser“.
Abs. 2 Satz 2 fasst noch einmal alle Auswirkungen zusammen und macht klar, was gemeint ist:
„Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht unerheblichen Ausmaß schädliche Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers herbeizuführen.
3.1.2 Landesrecht - Landeswassergesetze
Erst im Landesrecht taucht der Begriff Niederschlagswasser überhaupt auf.
In Nordrhein-Westfalen z.B. fordert dass Landeswassergesetz bereits seit 1996, dass das Niederschlagswasser „welches auf überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebieten anfällt und ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit versickert, verregnet, verrieselt oder in ein Gewässer eingeleitet werden kann“ auch vom Eigentümer auf diese Art zu „beseitigen“ ist, wenn die Flächen erstmals überbaut werden.
Hier wird also die Verpflichtung zur Überlassung des Niederschlagswassers zur „Beseitigung“ durch die Gemeinde aufgehoben. Der Niederschlagsabfluss gehört auch nicht mehr automatisch, per Definition zum Abwasser. Abwasser ist nur noch, was schädlich verunreinigt ist, oder wenn das Niederschlagswasser mit anderem Abwasser zusammenfließt. In vielen anderen Bundesländern ist das ähnlich geregelt.
Rheinland-Pfalz weist in seinem Landesgesetz vom 5.4.1995 den Grundsatz aus, dass jeder verpflichtet ist , den Anfall von Abwasser zu vermeiden. Niederschlagswasser soll nur in dafür zugelassene Anlagen eingeleitet werden, soweit es nicht bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder versickert werden kann (ATV 1997).
Schleswig-Holstein sieht regelmäßig ebenfalls die Versickerung vor. Thüringen hat eine „Richtlinie zur Beseitigung von Niederschlagswasser“, in der die Regenwasserversickerung einen Schwerpunkt bildet, wobei sich die Empfehlungen eng an die ATV-Arbeitsblätter 138 anlehnen (ATV 1997).
AuchBaden-Württembergwird sich ab 1999 diesem Trend anschließen.
Da heißt es im Gesetzblatt für Baden-Württemberg vom 31. Juli 1998 (S.424):
„§ 45 b wird wie folgt geändert:“ ...
„(1) Die Abwasserbeseitigung obliegt den Gemeinden. Sie haben das Abwasser insbesondere zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten, zu reinigen und die hierfür erforderlichen Kanäle, Rückhaltebecken, Pumpwerke, Regenwasser- und Niederschlagswasser- und Abwasserbehandlungsanlagen herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Die Gemeinden können sich zur Erfüllung dieser Pflicht Dritter bedienen. Das Abwasser ist von demjenigen, bei dem es anfällt, dem Beseitigungspflichtigen zu überlassen.
(2) Die Pflicht der Gemeinden entfällt für
1. Straßenoberflächenwasser, das auf Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen anfällt,
2. in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser, welches im Rahmen des § 8 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht wird, es sei denn, ein Anschluss an die öffentliche Kanalisation ist mit vertretbarem Aufwand möglich,
3. Niederschlagswasser, welches dezentral beseitigt wird und
4. Abwasser, welches nach Absatz 4 von der Beseitigung ausgeschlossen oder für das eine Ausnahme von der Überlassungspflicht zugelassen wurde.
Soweit die Gemeinden nicht zur Beseitigung verpflichtet sind, hat derjenige das Abwasser zu beseitigen, bei dem es anfällt; Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(3) Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1999 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, soll durch Versickerung oder ortsnahe Einleitung in ein oberirdisches Gewässer beseitigt werden, sofern dies mit vertretbarem Aufwand und schadlos möglich ist. Eine schadlose Beseitigung liegt vor, wenn eine schädliche Verunreinigung eines Gewässers oder sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu erwarten ist. Die oberste Wasserbehörde kann durch Rechtsverordnung Anforderungen an eine schadlose Beseitigung nach Art, Menge und Herkunft des Niederschlagswassers und an die Einrichtung zur Beseitigung stellen.“ (Gesetzblatt für Baden-Württemberg 1998)
3.1.3 Veränderungen in Baden-Württemberg
Die Gemeinden sind ab 1999 also von der Pflicht entbunden, jegliches Niederschlagswasser in ihren Kanalisationen zu sammeln. Vielmehr soll nun der Bauherr bzw. Grundstückseigner dafür sorgen, dass er möglichst alles Niederschlagswasser direkt auf seinem Grundstück „beseitigt“. Damit trägt er nicht nur die Kosten für die Errichtung einer solcher Anlage, sondern auch die für Unterhaltung und Betrieb.
Noch bis 1999 sind dezentrale Versickerungsanlagen eine genehmigungspflichtige Ausnahme (in Baden- Würtemberg). Danach könnte sich also vieles ändern.
Außerdem entfällt ab 1999 auch die Genehmigungspflicht für private Abwasser- und Versickerungsanlagen, die der Aufbereitung bzw. Versickerung von häuslichen Abwässern dienen. Diese Anlagen müssen lediglich vor ihrer Inbetriebnahme bei der Wasserbehörde angezeigt werden (§ 45 e Abs. 2, Gbl, 31.8.98).
Damit ist ein wichtiger Schritt zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung getan. Oft scheiterten gutwillige und ökologisch planende Bauherren bei der sinnvollen Regenwasserbewirtschaftung an der Genehmigungspraxis der Kommunen, die eine Genehmigung oftmals nur dann erteilten, wenn nicht der Anflug einer Unwägbarkeit in sichtbar wurde. Sie waren ja ohnehin zur Übernahme der Abwässer verpflichtet und mussten die Kostenlast der Kanalisation tragen. So war es sicher auch in Ihrem Interesse, jeden Anlieger gebührenpflichtig an ihre Kanalisation anzuschließen. Warum sollte eine Gemeinde also ein für sie unnützes Risiko eingehen?
Nun, da sie nicht mehr genehmigen muss, liegt auch die ganze Last der Verantwortung auf dem Anlagenbetreiber. Hier greift § 22 WHG Abs 1 bezüglich der Haftungsfrage: „Haftung für Änderungen der Beschaffenheit des Wassers – (1) Wer in ein Gewässer Stoffe einbringt oder einleitet oder wer auf ein Gewässer derart einwirkt, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, ist zum Ersatz des daraus einem anderen entstehenden Schadens verpflichtet. Haben mehrere die Einwirkungen vorgenommen, so haften sie als Gesamtschuldner.“(WHG 1997)
3.1.4 Recht zur Regenwassernutzung
Wenn einige Punkte beachtet werden, ist die rechtliche Seite der Regenwassernutzung nicht annähernd so umfangreich wie die der Versickerung.
Im Allgemeinen besteht lediglich eine Mitteilungspflicht an das örtliche Wasserversorgungsunternehmen(WVU). Danach kann eine Regenwassernutzungsanlage errichtet werden, ohne auf einen Bescheid des WVU warten zu müssen (AVB Wasser V, 1980, § 3).
Eine andere Frage ist die der Baugenehmigung, die in einigen Fällen eingeholt werden muss. Wann das der Fall ist, richtet sich nach der jeweiligen Landesbauordnung. In Baden-Württemberg ist ein Wasserspeicher beispielsweise erst dann genehmigungspflichtig, wenn er eine Höhe von 3m überschreitet und sein Volumen größer als 50m³ ist. Wird der Überlauf eines Speichers an eine Versickerungsanlage angeschlossen, muss diese den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen (König 1996).
3.2 Standards - (DIN und aRdT) - HOAI
1910 prägte das Reichsgericht den Begriff der Regeln der Baukunst, die einen technischen Mindeststandard sichern sollten. Diese Basis liegt auch heute noch den Landesbauordnungen zu Grunde. Man findet heute „die allgemein anerkannten Regeln der Technik“ (aRdT). Diese ergeben sich aus der Summe aller Erfahrungen im technischen Bereich, deren Bewährung in der Praxis feststeht und von deren Richtigkeit die Fachleute überzeugt sind. Festschreibungen finden sich in den Normen des deutschen Instituts für Normung, den DIN-Normen.
Für die „entwässerungstechnische Niederschlagsversickerung“ verfügt die Abwassertechnische Vereinigung e.V. (ATV) unbestritten über den größten Informationsschatz in Bezug auf Erfahrungen mit Bau und Betrieb. Somit stellen ihre „Arbeitsblätter“ gewissermaßen den Stand der Technik dar. Wichtig und sehr informativ ist Band 07 der ATV-Schriftenreihe, der die Erfahrungen aller deutschen Gemeinden beinhaltet. Ein erstes Regelwerk stellte bisher das Arbeitsblatt 138 zur entwässerungstechnischen Versickerung dar (ATV 1990)“
Hinsichtlich Brauch- und Trinkwasser bietet auch der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) ein reichhaltiges Regelwerk. Seit 1995 existiert die Fachvereinigung für Betriebs- und Regenwassernutzung (FBR), die ebenfalls mit der Erstellung von Regelwerken befasst ist (König 1996).
Der große Nutzen dieser Regelwerke ist zugleich auch ein großer Nachteil. Allzu leichtfertig werden die hier genannten Regeln der Technik zur einzig möglichen Ausführungsform einer technischen Anlage erklärt. Die Regeln sind eben allgemein und nicht speziell. Außerdem stellen sie keinesfalls die neuesten technischen Entwicklungen dar, sondern ganz im Gegensatz dazu nur Altbewährtes.
Dies fällt besonders in Verwaltungen auf, die Genehmigungen erteilen. Diese neigen dazu, die sich stellenden Probleme nicht differenziert zu betrachten, sondern greifen lieber zu den Regelwerken, als eigenverantwortlich individuelle Lösungen zu finden, die oft ökologisch sinnvoller sowie weniger kostenintensiv sind. Das Gleiche gilt für Planungsbüros, die nicht aus freien Stücken eine Regenwasserbewirtschaftung umsetzen, sondern, die hierbei lediglich eine Auflage seitens der Genehmigunsbehörde oder des Bauherrn zu erfüllen haben. Diese arbeiten sich allzu oft nicht in die Materie ein, vielmehr verwenden sie oftmals allzu unreflektiert die allgemeinen Regeln der Technik. Diese Gründe verhindern oft eine optimierte Lösung.
Umweltverbände sehen hier eine der größten Bremsen positiver Entwicklungen individueller und ökologisch verträglicher Planungen im gesamten Abwasserbereich. Das soll natürlich keinesfalls heißen, dass die Regelwerke selbst daran Schuld seien. Vielmehr geht es um diejenigen, die sie anwenden.
„Der Trend zu „Nullachtfünfzehn-Planungen“ wird verstärkt durch die monetären und versicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Ingenieure ihr Geschäft ausführen.
Hier ist zunächst einmal die „Honorarordnung für Architekten und Ingenieure“ (HOAI) zu nennen, die bislang das Honorar in der Regel an die Bausumme gebunden hat: Je höher die Bausumme, desto höher das Honorar für den planenden Ingenieur. Zwar ermöglicht § 5 Abs. 4a der HOAI die Vereinbarung eines Erfolgshonorars für kostengünstige Varianten. Von dieser Möglichkeit wird aber noch viel zu wenig Gebrauch gemacht. In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass nur 2% des Honorars für die Erhebung der Grundlagendaten und die Grundlagenkonzeption verlangt werden dürfen, obgleich hier mit angepassten Maßnahmen 90% des Einsparpotentials ausgeschöpft werden kann. Neben der HOAI sind die bisherigen Ausschlussklauseln der Haftpflichtversicherungspolicen für Ingenieure für kostentreibende Standardlösungen verantwortlich. Wer nicht nach den „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ plant und baut , glaubt zumindest, dass er mit potentiell unkalkulierbaren Schadenersatzforderungen konfrontiert werden könnte, wenn unkonventionelle Lösungen zu Schaden führen.“ (Geiler 1997)
„Somit ist es durchaus verständlich, wenn der planende Ingenieur unter Beachtung der Haftpflichtfrage sich ausschließlich an die veröffentlichten Regeln hält und ein eventuell realisierbares Einsparpotential unberücksichtigt lässt.“ (Illian 1997)
4 Entwicklung in Deutschland
Die Abwassertechnische Vereinigung e.V. (ATV) hat 1995 eine Umfrage hinsichtlich der „Versickerung von Niederschlagswasser“ durchgeführt. Von 2300 angesprochenen Gemeinden beantworteten 661, knappe 30%, die Umfragebögen. Damit wurde ein Gebiet abgedeckt, dass mit 27 Mio. Einwohnern aufwarten kann.
4.1 Verbreitung
In jeder zweiten Kommune existieren Versickerungsanlagen. Eigene Versickerungsanlagen betreiben 23 % der Gemeinden. 44% haben privat Betriebene.
Die am weitesten verbreitete Anlagenbauart ist der Sickerschacht.
Tab 6: Anteilsverteilung der verschiedenen Bauarten in den Gemeinden
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(nach ATV-1997)
Die entwässerten Bauwerke sind zu einem Drittel Verkehrsflächen und zu zwei Dritteln Dachflächen. Die Verkehrsflächen werden meist über Mulden, Erdbecken und Sickerschächte entwässert, die Dachabflüsse über Schächte, Teiche und Mulden. Sonstige Anlagen betreffen die Flächenversickerung über Rasengittersteine, Rasenpflaster und andere durchlässige Beläge.
4.2 Erfahrungen
Bedenklich stimmt die ATV die Tatsache, dass lediglich 20-30% der befragten Kommunen ihre Erfahrungen mit den Versickerungsanlagen in ihrem Zuständigkeitsbereich erläutern. Das zeigt eine großeUnkenntnis der Gemeindenhinsichtlich betrieblicher Aspekte, besonders im Umgang mit privaten Versickerungsanlagen. Die Unterhaltung privater Anlagen ist nicht Sache der Gemeinde und entzieht sich so ihrer Kenntnis.
DieBetriebssicherheiterweist sich in der Mehrzahl der betriebenen Anlagen als gewährleistet. Unterirdische Anlagen sind etwas anfälliger gegen Störungen als oberirdische. Aber die beobachteten Selbstabdichtungen treten nie plötzlich auf, sondern im Laufe von 10-15 Betriebsjahren.
Ein Überlaufen der Versickerungsanlagen bei Starkregenereignissen erfolgt in den wenigsten Fällen in das Kanalnetz. Trotzdem treten kaum Gebäudevernässungen auf.
Zwei Drittel aller Versickerungsanlagen waren ohne jede Betriebsstörung.
Ursachen vorkommender Störungen sind nach Angaben der Gemeinden Selbstabdichtung, mangelnde Sickerfähigkeit, bauliche Mängel, mangelnde Wartung, hydraulische Überlastung, Fehlanschlüsse, falsche Rinnensicherung und Wurzelwachstum.
Der Wartungsaufwand wird als gering eingestuft. Gemeinden warten alle ein bis zwei Jahre, private Betreiber meist nur bei Störungen. Die Wartung bezieht sich meist auf das Entfernen von Sedimenten und Abfällen, die in eine Anlage gelangen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 11: Wartungshäufigkeit von Regenwasserversickerungsanlagen
4.3 Erkennbare Tendenz
60 % der Gemeinden sehen die Notwendigkeit, in Zukunft verstärkt Versickerungsanlagen zu errichten, weil sie der Meinung sind, dass sie in den kommenden Jahren mehr Regenwasser zur Versickerung bringen möchten.
Dabei wird deutlich, dass die Kommunen, die schon Erfahrungen mit solchen Anlagen haben, diese wesentlich positiver bewerten als Gemeinden, die sich damit weniger auskennen bzw. keine Erfahrungen sammeln konnten oder wollten, weil sie es bis jetzt vermieden haben, solche Anlagen auf ihr Gemeindegebiet zu bekommen.
Die Regenwasserversickerung wird sich verstärkt durchsetzen. Sie muss deshalb in naher Zukunft als gleichwertiges Entwässerungsverfahren neben dem Misch- und Trennsystem anerkannt werden. Die bisher eher schleppende Durchsetzung liegt an der mangelnden Akzeptanz und der oftmals mangelhaften Umsetzung. Die Umfrage hat außerdem ergeben, dass kleinere Orte eher zögerlich gegenüber der entwässerungstechnischen Versickerung von Niederschlagsabwässern sind. Mit der Größe der Gemeinde nimmt auch die Aufgeschlossenheit gegenüber diese Entwässerungsart zu. Das Paradoxe daran ist, dass gerade die kleinen Gemeinden eher über den nötigen Platz dafür verfügen.
Die Umfrage zeigt, dass die Betriebssicherheit gegeben ist. Die Wartungsfaulheit der Privatbetreiber gibt allerdings Anlass zur Befürchtung auf Langzeitschäden. Deshalb empfiehlt es sich, Wartungsintervalle vorzuschreiben.
Die von Skeptikern immer noch vorgetragenen Bedenken aus dem betrieblichen und bautechnischen Bereich konnten durch die Umfrage keine Bestätigung finden. Die Probleme der Versickerung liegen im Platzanspruch und im hydrogeologischen Bereich.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 12: Absicht den Anteil der Versickerung von Dachflächenabflüssen zu erhöhen
1 Alle befragten Gemeinden
2 Gemeinden, die Versickerungsanlagen haben
3 Gemeinden, die keine Versickerungsanlagen haben
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 13: Wasserwirtschaftliche Bedeutung der Niederschlagsversickerung
1 Ökologisch sinnvoll
2 Gefahr der Grundwasserverschmutzung
3 Unter Einbeziehung der Kosten auf Privatgrund wirtschaftlich
4 Langfristige Betriebssicherheit
5 Technische und hydrologische Grundlagen
5.1 Niederschlag
Niederschläge können als Hagel, Regen, Schnee, Nebel, Raureif oder Tau die Erdoberfläche mit Wasser in seinen verschiedenen Aggregatzuständen anreichern. Deutschlands Klima entspricht dem der gemäßigten Zone. Das heißt, ein kalter Winter mit Temperaturen im Tagesmittel unter 0° Celsius und ein warmer Sommer mit über 25° sind regelmäßige Abfolge. Weiter wird das Klima als humid bezeichnet, was bedeutet, dass hier mehr Niederschlag fällt als Wasser verdunstet. Die Höhe der mittleren Monatsniederschläge hängt von der Lufttemperatur ab. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen bzw. transportieren, um sie dann bei Abkühlung wieder als Niederschlag abzugeben. Das Temperaturmaximum in Deutschland folgt dem Strahlungsmaximum der Sonne um etwa sechs Wochen zeitlich verschoben. Der höchste Sonnenstand ist am 21 Juni. Folglich sind Ende Juli, Anfang August die meisten Niederschläge zu erwarten. Hier treten auch die größten Starkregenereignisse auf. Ab höheren Mittelgebirgslagen verschiebt sich das Niederschlagsmaximum auf die Monate
Dezember und Januar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 14: Mittlere Monatsniederschläge (mm) in Deutschland (aus König 1996)
Starkregen (Schauer) haben hohe Intensitäten bei vergleichsweise kurzer Dauer. Bei langanhaltendem Regen (Dauerregen) verhält es sich umgekehrt.
Die Niederschläge im Mittleren Neckartal, Raum Stuttgart , betragen 662 mm/a.
Tab. 7: Verteilung der Niederschlgshöhen und -Spenden
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Niederschlagshoehen (mm) und Niederschlagsspenden (l/s×ha), Geltungsbereich: Mittleres Neckartal, Raum Stuttgart (Daten aus LFU Baden-Württemberg 1976)
- JährlicheHäufigkeit= Mittlere jährliche Häufigkeit der Überschreitung der darunter aufgeführten Werte in Jahren (100 Jahre Bemessungszeitraum) z.B. 0,2 = 20 mal in 100 Jahren = alle 5 Jahre
- Niederschlagsdauer =Dauerdes jeweiligen Niederschlages einschließlich Unterbrechungen
- N = Niederschlagshöhe in Millimeter
- R = Niederschlagsspende in Liter pro Sekunde je Hektar
Bsp.: Die Bemessungsregenspende (rT/n) für einen 15 minütiges Regenereignis mit einer Überschreitungshäufigkeit von 1 pro Jahr, r15/1, beträgt 140 l/s×ha.
5.2 Maßgebliche Regenspende
Die Bemessung von Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung geht von einem bestimmten Bemessungsregen aus. Da die Versickerung ein relativ langsamer Vorgang ist, kann mit einer konstanten Intensität über das ganze Regenereignis gerechnet werden (IWH 1988).
5.3 Abfluss und Versickerung
Die Oberflächen, die mit Wasser benetzt werden, können es aufnehmen, auf ihrer Oberfläche halten und seitlich abfließen lassen. Die bodenphysikalischen Eigenschaften, die hier zu Grunde liegen, werden in Kapitel 2 dargestellt. Fällt mehr Niederschlag als versickert, kommt es zum oberflächlichen Abfluss. Oberflächen verschiedener Struktur unterscheiden sich in Ihren Abflusseigenschaften. Für die Abflusswirksamkeit maßgebend ist die Regenspende (l/s×ha), die pro Zeiteinheit tatsächlich fällt, und die Dauer des Regenereignisses.
5.3.1 Abflussbeiwert
Dieser Wert bringt zum Ausdruck wieviel Wasser tatsächlich von einer Fläche abfließt. Er gibt die hydraulischen (Retentions-)Eigenschaften einer als homogen betrachteten Oberfläche an.
Tab. 8: Abflussbeiwerte verschiedener Oberflächen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(nach Geiger 1995)
5.3.2 Abfluss
Für den AbflussQz(in l/s) eines Gebietes mit der Fläche Ared gilt: der Gesamtabfluss ergibt sich aus dem Produkt von Bemessungsregenspende (rT(n)), dem mittleren Abflussbeiwert ym und der Summe aller angeschlossen Flächen Ared in l/m2:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Geiger 1995)
5.3.3 Fließgeschwindigkeit (nach Manning/Strickler)
Die Fließgeschwindigkeitvin m/s des Wassers in Leitungen oder Gerinnen hängt zum einen vom Gefälle der Leitung IE und ihrerOberflächenrauigkeitkst in m1/3/s, zum anderen von ihrem hydraulischen Radius rhy in 1/m ab.
Tab. 9: Oberflächenbeiwerte nach Manning/Strickler
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(aus Geiger, W. 1995)
Die Fließgeschwindigkeit wird wie folgend berechnet:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Derhydraulische Radiusrhyergibt sich aus demFließquerschnittA in m² und dessenbenetztem Umfanglu in m.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das hydraulische Gefälle (oder die Energiehöhe) entspricht demSohlgefälleIs und berechnet sich aus dem Quotienten von Fallhöhe und Fließstrecke (m/m = ohne Dimension). Die Fließstrecke wird in der Waagerechten, Horizontalprojektion, gemessen (Rössert 1969).
5.3.4 Versickerungsrate (Berechnung nach ATV 138 A)
Die VersickerungsrateQs ergibt sich aus der Filtergeschwindigkeit vf und der versickerungswirksamen Fläche. Bei der flächenhaften Versickerung ist die gesamte Fläche der Anlage in gleicher Intensität versickerungswiksam.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Filtergeschwindigkeit vf berechnet sich aus Durchlässigkeitkoeffizienten kf in m/s und dem Hydraulischen Gefälle I in m/m (dimensionslos).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dashydraulische Gefälleergibt sich hier aus dem Flurabstand des Grundwassers und der Höhe des Einstaus z (in m) der Versickerungsanlage.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 15: Darstellung des Sickerweges (ATV 1990)
5.4 Planungs- Untersuchungsmethodik
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 16 Elemente der Regenwasserbewirtschaftung (aus Häßler 1995)
Zum Erreichen der Ziele aus Kapitel 1.2 können je nach Zielrichtung vier grundsätzliche Möglichkeiten der Retentions-Strategien eingesetzt werden. Vor Ort können sie einzeln oder kombiniert betrieben werden.
1. ÜberGründächerkann eine erste Retention bewirkt werden. Die Menge richtet sich nach der Vorsättigung und dem Dachaufbau.
2.Regenwassernutzungführt zur Retention im Umfang der freien Zisternenkapazität und zur quantitativen Abwasserentlastung in Höhe der Brauchwassernutzung. Ebenfalls in dieser Höhe liegt der geminderte Frischwasserverbrauch, der dem Schutz der Ressource Wasser am Ort der natürlichen Vorratsbildung dient.
3.Offene Wasserflächen,seien es auch nur offene Rinnen oder kleine Mulden, mindern bereits durch ihre Anzahl bei einem hohen Grad der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung den hydraulischen Stress im Vorfluter. Eine Verbesserung des Mikroklimas mit der positiven Wirkung eines Temperaturausgleichs durch Verdunstung wird ebenfalls erzielt.
4. DieVersickerungführt zur Retention in Gerinnen, Mulden, Rigolen und zur Grundwasserneubildung.
Wie schon mehrfach erwähnt, sind also Nutzung, Versickerung oder Rückhaltung des Niederschlages vor Ort die Maxime.
Bei der Projektabwicklung muss stets eine stufenweise Bearbeitung erfolgen. Nach jeder Stufe ist eine Erfolgskontrolle zu machen. Sie bezieht sich auf die Erreichbarkeit des gesetzten Zieles. So kann die Untersuchung gegebenenfalls frühzeitig abgebrochen werden, falls die Ergebnisse gegen ein Planziel sprechen.
Vorgehensweise in Anlehnung an (Adams 1996):
Ersteinschätzung
- Veranlassung und Aufgaben- bzw. Zielformulierung
- Abschätzung der hydrogeologischen Gegebenheiten
- Grobauswertung von vorhandenem Kartenmaterial
- Grobabschätzung der möglichen Maßnahmen
- Gebietsbegehung
Voruntersuchung
- Untersuchung von Boden- und (Grund-)Wasserverhältnissen
- Auswertung vorhandener Unterlagen (Bohrprofile, Messstellen... )
- Ergänzung des vorhandenen Kanalnetzes
- Beachtung der ortstypischen Niederschlagsereignisse (Regendaten der Landesämter)
- Untersuchung der Bodeneigenschaften hinsichtlich Versickerungseignung und Grundwasserschutz
Entwurf
- Formulierung der Zielsetzung
- Typisierung und (Gruppierung) der Siedlungsstruktur
- Erarbeitung von Idealtypischen Entwürfen für eine optimale Ausnutzung der Möglichkeiten zur Regenwasserbewirtschaftung
bis zumAbschluss:
- Erfolgskontrolle
- Dokumentation von übertragbaren Erfahrungen und Ergebnissen
5.5 Dachfläche - Dachbegrünung
Hinsichtlich der Regenwassernutzung liefern Dachflächen das qualitativ hochwertigste Wasser. Von Dachflächen sind lediglich Schadstoffe zu erwarten, die sich als Stäube aus der Luft hier abgelagert haben. Geteerte und bituminöse Flächen bergen immer die Gefahr des Auslösens von Farb- und Geruchsstoffen.
Intensive Dachbegrünungen haben eine hohe Retentionfähigkeit und bieten eine Pufferwirkung gegen Schadstoffe. Allerdings können hier Huminstoffe ausgewaschen werden. Diese führen zu einer Färbung des Wassers und können unter Umständen zur Gruchsbildung im Wasserspeicher führen.
Extensive Dachbegrünungen können ebenfalls eine Vorfilterfunktion des Niederschlgwassers übernehmen. Gründächer können, je nach Intensität des Regens und Dachaufbau, 50-90% des Niederschlages zurückhalten (König 1995).
Dachbegrünungen verringern die Temperaturamplitude auf der Dachfläche, verlängern damit die Lebensdauer der Dachabdichtung, befeuchten die Luft und bieten Lebensraum für Pflanzen und Tiere (Kuttler 1993).
5.6 Regenwassernutzungsanlagen
Regenwassernutzungsanlagen dienen dem Zweck, Regenwasser zu sammeln und damit Trinkwasser in allen Bereichen, in denen keine hygienischen Bedenken bestehen, zu ersetzen. Dazu zählen Toilettenspülung, Waschmaschine, Gartenbewässerung sowie Putzwasser. Das sogenannte Brauchwasser ist nicht geeignet für die Körperhygiene, das Zubereiten von Speisen und den menschlichen Genuss im Allgemeinen, weil eine Belastung mit pathogenen Keimen nicht auszuschließen ist.
Die Anlagen bestehen zum größten Teil aus gängigen Komponenten der Installationstechnik. Als Auffangfläche dient in der Regel das Dach (5.4) Ein Speicherzulauf übernimmt den Transport zum Speicherbehälter, der Zisterne. Sie verfügt über einen Überlauf und eine Nachspeisung aus dem Trinkwassernetz. Der Überlauf wird entweder an die Kanalisation angeschlossen oder besser über eine entwässerungstechnische Anlage zur Versickerung gebracht. Mittels Druckerhöhung durch geeignete Pumpen wird das Wasser dann durch ein eigenes Leitungsnetz an den Entnahmestellen zur Verfügung gestellt.
5.6.1 Speicherzulauf und Filter
Fallrohre und Grundleitungen sind nach DIN 1986 Teil 2 für eine Regenspende von ³ 300 l/(s×ha) zu bemessen. Dem entspricht ein Rohr DN100 für 150m² Dachfläche. Als Speicherzulauf dient also ein übliches Regenfallrohr. Beim Material sollte man zwischen PE und glasiertem Steinzeug (teuer) wählen. Metallrohre geben Oxide und Schwermetalle ans Wasser ab und PVC Rohre verbieten sich auf Grund der bekannten Problematik hinsichtlich der Chlorchemie.
Als Filter kommen solche mit Wasserverlust besonders dann in Frage, wenn mit einem Ertragsüberschuss zu rechnen ist und das Geländegefälle ausreicht, die Schmutzfracht sicher in die Kanalisation zu befördern. Sie bieten den Vorteil, dass sie sich fast vollständig selbst reinigen und so nahezu wartungsfrei arbeiten. Die Filterleistung liegt bei 1,7 bis über 2,0 l/s, die Filterfeinheit bei 0,2 mm Partikelgröße. Filter ohne Wasserverlust bieten ebenfalls eine Feinheit von 0,2 mm. Sie eignen sich gut in Verbindung mit einem Gründach als Vorfilter. Es gibt Filterplatten aus Porenbeton, die sich im Zisternenkonus befinden. Wenn genügend Platz vorhanden ist, kann auch ein Filterschacht vorgeschaltet werden, der ebenfalls mit einem Filter aus Porenbeton bestückt ist. Zusätzlich hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, für die Entnahmeleitung einen schwimmenden Ansaugfilter zu benutzen. Die Filterung durch reine Sedimentation im Zisterneninneren führt zu einer Reduktion der abfiltrierbaren Stoffe gegenüber dem Regenwasser um das Sechsfache.
5.6.2 Speicherbehälter (Zisternen)
Zisternen können im Gebäude aus Kunststoff (Recycling PE) oder außerhalb im Untergrund aus Beton bestehen. Die Speichergröße wird nach Bedarf und Niederschlag im Jahresdurchschnitt ermittelt. Eine sinnvolle Größe für Zisternen liegt bei 3-7% des jährlichen Regenwasserertrages. Für den Stuttgarter Raum mit einem jährlichen Niederschlag von 662 mm wären das 6,62 l × 3-7 /m²×a Auffangfläche. Also ca. 20-40l/m²×a. Sind Ertrag und Bedarf verschieden, so sollte das auch bei der Wahl der Speichergröße berücksichtigt werden. Für erste Berechnungen sind 5%, im Stuttgarter Raum 30l/m²×a, realistisch. Leider steht der Planer in der Praxis vor dem Problem, dass eine Volumenveränderung des Speichers nicht stufenlos möglich ist, sondern ein großer Sprung zur nächstmöglichen Zisternengröße oder zum zusätzlichen Speicher gemacht werden muss. Das ist mit entsprechenden Kosten verbunden, und das theoretische Optimum im Bedarfs-Ertrags-Verhältnis ist deshalb oft nicht zu erreichen (König 1996).
5.6.3 Blä bä
5.6.4 Speicherüberlauf
Der Überlauf sollte möglichst zur Versickerung gebracht oder in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet werden. Ist das nicht möglich muss der Überlauf an die Kanalisation angeschlossen werden. Bei einem Anschluss ist unter Umständen Vorsorge gegen einen Rückstau zu treffen. Dieser kann zum Eindringen von Schmutzwasser aus der Kanalisation führen (DIN 1986).
5.6.5 Wasserversorgung im Haus
Zum Heben und Befördern des Wassers zu den Entnahmestellen im und am Haus werden elektrische Pumpen eingesetzt. Sie sorgen für einen konstanten Leitungsdruck. Bei der Dimensionierung stehen Bemessungstabellen der Hersteller und entsprechende Software zur Verfügung.
Das Leitungsmaterial entspricht dem der herkömmlichen Trinkwasserversorgung. Allerdings gilt es zu beachten, dass mehr Wert auf Korrosionsfestigkeit gelegt werden muss, denn das weiche Regenwasser bildet keine schützenden Kalkschichten auf Metallen in Leitungen und Aggregaten.
Damit die Wasserversorgung immer gewährleistet ist, muss eine Nachspeisung der Anlage möglich sein. Hierbei ist darauf zu achten, das an keiner Stelle eine direkte Verbindung mit dem Trinkwassernetz hergestellt werden darf, um eine eventuelle Übertragung pathogener Keime dorthin auszuschließen. Der freie Auslauf muss einen Abstand zur Brauchwasseranlage vom Zweifachen des Innendurchmessers der Zuleitung haben. 20 mm dürfen dabei nicht unterschritten werden. Die Nachspeisung ist vom Prinzip her also ein Wasserhahn des Trinkwassernetzes über einem Trichter, der mit der Zisterne verbunden ist. Die Nachspeisung wird über ein elektrisches Magnetventil, dass von einem Wasserstandsfühler in der Zisterne gesteuert wird, geregelt.
Alle Brauchwasserentnahmestellen müssen mit dem Schild:“Kein Trinkwasser“ kenntlich gemacht werden (König 1996).
5.7 Entwässerungstechnische Regenwasserversickerungsanlagen
Anlagen zur Versickerung haben die Aufgabe, den Niederschlagsabfluss der angeschlossenen Flächen dem Grundwasser zuzuführen. Erfolgt die Versickerung auf dem Grundstück, auf dem auch die Niederschläge anfallen, spricht man von einer dezentralen Versickerung. Werden Abflüsse von mehreren Grundstücken zusammen in einer gemeinschaftlich genutzten Anlage versickert, so gilt diese als semizentrale Anlage. Zentrale Versickerungsanlagen haben ganze Wohngebiete als Einzugsbereich (ATV 1995).
Prinzipielle technische Lösungen nach ATV A -138 sind:
- Flächenversickerung
- Muldenversickerung
- Rohr-, und Rigolenversickerung
- Schachtversickerung
Die Auflistung der einzelnen Versickerungsarten ist absteigend in der Rangfolge der Gefährdungspotentiale, die von ihnen für das Grundwasser ausgehen. (ATV 1990)
Grundwasserschutz steht gegenüber hydraulischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten immer im Vordergrund.
Tab 10: Möglichkeiten der Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser in Abhängigkeit vom Untergrund in Wasserschutzgebieten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fl = Flächenversickerung (mit Vegetationsdecke), Mu = Muldenversickerung (mit Vegetationsdecke), R = Rohrversickerung, Ri = Rigolen-Versickerung, 1) In Einzelfällen in IIIA bzw. III wenn der Abstand zur Fassungsanlage > 1 km ist und die Abstandsgeschwindigkeit < 3 m / d ist (nach ATV, 1990 leicht verändert).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 17: Systemelemente eines Versickerungssystems (aus König 1996)
5.7.1 Flächenversickerung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 18: Aufbau einer durchlässig befestigten Fläche mit Rasenpflaster (nach ATV 1997)
Unter dieser Art der Versickerung versteht man die auf durchlässig befestigten Flächen und die in ebenen Seitenräumen undurchlässiger Flächen.
Eine Speicherung des Niederschlagswassers findet nicht statt. Die Versickerungsfähigkeit der Fläche muss der Intensität des Bemessungszuflusses der angeschlossenen Flächen und dem Niederschlag auf die Versickerungsfläche selbst entsprechen.
Wasserdurchlässig befestigte Flächen, Terrassen, Stellplätze, Fuß- und Fahrwege können verschiedener Bauart sein. Gebräuchlich sind wasserdurchlässiger Asphalt, wassergebundene Wegdecken, Rasenpflaster und andere durchlässige Pflasterungen mit einem Fugenanteil von 30-40%. Schotterflächen sowie Abdeckungen aus Rindenmulch sind ebenfals durchlässig. Flächen temporärer Nutzung können auch aus Schotterrasen bestehen.
Werden Flächen, die neben undurchlässig befestigten Bereichen liegen, zur entwässerung Entwässerung genutzt, so bieten sich leicht abgeböschte Randstreifen als Versickerungsflächen an. Gras bzw. Rasenflächen sind hierfür besonders geeignet, da die dichte Durchwurzelung stets für eine gute Durchlässigkeit im Oberboden sorgt. Eine nicht unerhebliche wesentliche Reinigung des Wassers findet in dieser stark belebten Bodenzone statt (Kap. 2.3), (Grotehusmann et al. 1995).
Berechnung der Versickerungsfläche (ATV A-138, 1990):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.7.2 Muldenversickerung
Versickerungsmulden sind flache, meist mit Gras bewachsene Vertiefungen, in denen das Regenwasser kurzzeitig zwischengespeichert werden kann. Der Flächenbedarf beträgt zwischen 5- und 20 % der angeschlossenen Fläche.
Mulden lassen sich gut in Grünanlagen oder Straßenbegleitgrün integrieren. Bei der Bepflanzung kann aus einer Vielzahl von Gräsern, Stauden und Gehölzen gewählt werden, die gut feuchte oder zeitweilig nasse Böden vertragen.
Die Muldentiefe sollte 10-40 cm betragen, damit die Einstauzeiten nicht zu lang werden. Eine bis zum Rand eingestaute Mulde soll sich innerhalb von ein bis zwei Tagen völlig entleeren können. Das hängt stark von der Versickerungsrate (Kap. 5.4.3) ab. Zu große Nässe oder Dauerstau erhöht das Verschlämmen und damit die Selbstdichtung. Außerdem schadet dies der Begrünung. Die Muldensohle sollte idealerweise möglichst eben und horizontal sein, um einen gleichmäßigen Einstau und damit eine gleichmäßige Versickerung zu gewährleisten.
Aus diesem Grunde sollten lange schmale Mulden möglichst unterbrochen werden, um eine Höhendifferenz der Sohle zu vermeiden. Dies lässt sich oft mit den baulichen Gegebenheiten, wie Grundstückseinfahrten, Wegquerungen u. ä. kombinieren (Grotehusmann et al. 1995).
In der Praxis hat sich herausgestellt, dass besonders Gräser mit ihren zum Teil behaarten Blattoberflächen Feinstpartikel aus dem Sickerwasser herausfiltern, womit sie eine Selbstdichtung durch Verschlämmung erheblich verzögern (ATV 1997).
Der belebte Oberboden ist auch hier entscheidend für die Reinigungskapazität des Wassers verantwortlich. Die Lebewesen und Pflanzenteile sorgen für eine ständige Regeneration der Durchlässigkeit. Die oberirdische Art der Versickerung lässt sich gut in Funktion und Zustand überprüfen, weil alle Anlagenteile gut sichtbar sind. So erkennt man etwaige Verschmutzungen und Betriebsstörungen schnell, was bei Schächten und Rigolen, die unterirdisch sind, nicht der Fall ist (Grotehusmann et al. 1995).
Berechnung des Muldenvolumens (ATV A-138, 1990):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Volumen ergibt sich aus der Differenz zwischen Niederschlagsvolumen S(Q z × T) und Versickerungsvolumen S(Qs × T). (T× 60 entspricht der Umrechnung von min in s). Damit errechnet sich das Volumen wie folgt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Muldenversickerung kann hinsichtlich des Grundwasserschutzes als besonders günstig eingestuft werden, weil in stark belebten Bodenhorizonten die größte Reinigungswirkung auf das Sickerwasser ausgeübt wird (Kapitel 2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 19: Schematischer Quer- und Längsschnitt eines Mulden-Rigolenelementes
(aus Grotehussmann et al. 1995, leicht verändert)
5.7.3 Rohr- und Rigolenversickerung
Eine Rigole ist ein ober- oder unterirdischer mit Kies gefüllter Graben, der die Aufgabe hat, Wasser zwischenzuspeichern und über seine versickerungswirksame Öberfläche an den Boden der Umgebung abzugeben. Es handelt sich um das Gegenteil einer Drainage. Verläuft in der Kiespackung noch zusätzlich ein perforiertes Rohr, handelt es sich um eine Rohrrigole. Das Rohr hat die Aufgabe, das anfallende Wasser gleichmäßig und schnell in der Rigole zu verteilen. Der Flächenbedarf ist weitaus geringer als der einer Mulde. Allerdings besteht die Gefahr der Selbstabdichtung durch das Einschlämmen, da die Rigolen oft tiefer gehen als der durchwurzelbare Raum, der eine selbständige Regeneration der Durchlässigkeit ermöglicht. Damit die Rigole vor Einschlämmung von außen geschützt ist, wird der Graben mit einem Geotextil ausgekleidet.
Sinnvoll ist vor allem die Kombination von Mulden-, Rohr- und Rigolenversickerrung in einer Anlage. Ein sogenanntes Muldenrigolenelement verbessert das Verhältnis von Versickerungs- sowie Zwischenspeicherleistung bezüglich der Muldenfläche und wird oft als platzsparende Alternative eingesetzt.
(Grotehusmann et al. 1995)
5.7.4 Schachtversickerung
Versickerungsschächte sind in Deutschland stark verbreitet und dienen als Sickeranlagen für Niederschlagswasser und gereinigtes Schmutzwasser aus Kläranlagen (DIN 4261). Das Wasser wird in einen Schacht mit durchlässiger Wand und Sohle geleitet, dort zunächst gespeichert und schließlich in den Untergrund versickert. Die Wand besteht aus handelsüblichen Brunnenringen (DIN 4034) mit Konus und luftdurchlässigem Deckel. Das Volumen wird durch Grundwasserabstand und Ringdurchmesser (1m) bestimmt. Einzelschächte eignen sich daher nur zum Anschluss kleinerer Flächen im Einfamilienhausbereich. Sind Feststoffe im Nierdeschlagsabfluss zu erwarten, muss eine Absetzmöglichkeit vorgeschaltet werden.
Die Schachtversickerung ist trotz ihrer weiten Verbreitung aus Gründen des Grundwasserschutzes eher abzulehnen, weil hier die Passage der belebten oberen Bodenhorizonte, wo die eigentliche Reinigungsleistung liegt, ausbleibt. Das bedeutet, dass Schadstoffe hier direkt in den Grundwasserleiter gelangen können (Grotehusmann et al. 1995).
6 Projektgebiet - Grundlagen
6.1 Lage des Projektgebietes
Das Projektgebiet liegt im Stadtteil Pliensauvorstadt der Stadt Esslingen am Neckar und gehört zum Großraum Stuttgart. Die Höhe über NN beträgt 234-235 m, und das Gelände ist dementsprechend nahezu eben. Der Neckar fließt 250m nördlich Richtung Westen. Die Gemarkung trägt den Namen Breite. Überplant werden die Flurstücksnummern 16414, 16429, 16436, 16446. Im Norden verläuft die Stuttgarter Straße, im Süden die Weilstraße. Östlich wird das Gelände von der Eberhard-Bauer- Straße begrenzt. Die Fläche beträgt 3,6 ha.
6.2 Geologie und Hydrologie
Der Untergrund besteht aus Sedimenten und stellt einen typischen Auenboden dar, der aus Quartärablagerungen des Neckar entstand.
Tab. 10 : Bodenprofil einer Grundwassermessstelle, an der Eberhard Bauer Straße, 200m nordwestlich Plangebiet
(Gutachten der Firma Dr. Jungbauer und Partner vom 10.02.1998)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Erhebliche schwankungen Schwankungen des Grundwasserspiegels sind durch die starke Regulierung des Neckars, der mit dem Grundwasser in Verbindung steht, nicht zu erwarten. Die Wasserläufe der Bäche Champagnebach und Auchtbächle werden schon im Hangbereich, oberhalb der Straßen Geuernrain (Champangnebach) und Hohestraße, verdohlt und vollständig der Kanalisation zugeführt.
Der schluffige Oberboden hat eine Mächtigkeit von 40 cm. Die Fingerprobe ergab deutlich die Bodenart leicht sandiger Schluff (slU). Daraus resultiert ein Tongehalt von < 8 %, Schluffgehalt 50-80% und Sandgehalt < 12-50%. Die Wasserdurchlässigkeit ist als mittel bis gering enizustufen (AG-Boden 1996). Der Grundwasserflurabstand am 22.01.1998 betrug lt. Gutachten der Firma Dr.Jungbauer und Partner 2,70m. Ein selbst durchgeführter Sickerversuch am 18.08.98 ergab einen Wasserdurchlässigkeitswert, kf von 4 × 10-5 m/s. Eine durchgeführte Untersuchung des pH-Wertes des Oberbodens ergab einen pH von 7,15.
6.2.1 Bodenuntersuchungen
1. pH-Wert:
Nach dem Prinzip der elektrometrischen Messung der H-Ionenaktivität in einer Bodensuspension in 0,01 m CaCl2 (Calciumchlorid) wurde einpH-Wertvon7,15bei einer Temperatur von20.04 °Cgemessen. Zuvor wurde das Messgerät mit einer Pufferlösung en geeicht.
Für die Analyse wurden 10g einer Probe des Oberbodens aus dem Projektgebiet mit 20 ml 0,01 m CaCl2 – Lösung versetzt. Nach einer Stunde und zweimaligem umrühren Umrühren wurde mit der Glaselektrode gemessen.
2. kf-Wert:
Für die Durchführung eines einfachen Sickerversuchs (SEG 1996) zur Bestimmung der Versickerungsleistung von Böden wurde zunächst eine quadratische Grube mit 20 cm Kantenlänge und 40cm Tiefe ausgehoben. Die Sohle der Grube wurde völlig eben hergestellt. Um ein verschlämmen Verschlämmen der Sohle zu vermeiden, wurde eine Schicht von 3 cm Sand eingebracht. Um Damit ein realistisches Ergebnis zu erziehlen, erzielt werden konnte, wurde die Grube eine Stunde lang bis zum oberen Rand hin eingestaut und versicker n des Wasser kontinuierlich nachgefüllt. Nach der Vorbewässerungszeit wurde ein Meterstab in der Grube fixiert, der ein Verfolgen des Wasserstandes im oberen Bereich der Grube ermöglichte. Dann wurde erneut bis ca. 3 cm unter den oberen Rand mit Wasser aufgefüllt. Der Wasserstand wurde zusammen mit der Uhrzeit notiert. Nach einem Absinken des Wasserspiegels um 4 cm, wurden erneut Wasserstand und Uhrzeit notiert. Die Messung wurde drei mal an drei verschiedenen Stellen
Stellen durchgeführt. Messstelle 3 war im westlichen Randbereich, Eberhard Bauer-Straße, Messstelle 2 im Hofbereich und Messstelle 1 am östlichen Rand der Bebauung in Nähe der angrenzenden Gärtnerei.
Messtelle 2 ergab kein verwendbares Ergebniss. Hier wurde mit stark dränierendem Substrat zwischen den Häusern aufgefüllt, sodass sofort alles Wasser in diesen unterirdischen im Dränagekörper ver sickerte. Ein Einstauen war auch für kurze Zeit nicht möglich.
Messstellen 2 und 3 ergaben eine Durchschnittliche durchschnittliche Versickerungsrate von 0,001 cm / 60s.
Messstelle 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Messstelle 3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Messzeit gesamt = 99 min ; Messzeitdurchschnitt 16,5 min
Es versickerten also durchschnittlich 4 cm im 16,5 min. in 16,5 Minuten. Das entspricht 0,0024m / 60s.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.2.2 Einfluss auf das Trinkwasserschutzgebiet Esslingen-Weil
Die Pumpwerk Esslingen Weil liegt 1,2 Kilometer östlich des Projektgebietes auf Höhe von Flusskilometer 191. Das Projektgebietliegt liegt in der Wasserchutzzone III b. Die Grenze zwischen Zone III a und III b verläuft in 660m oberstromig zur Fassungsstelle (Wasserwirtschaftsamt Esslingen). Ein Plan hierzu folgt auf der nächsten Seite.
Die Wasserfassung Esslingen Weil ist seit 1982 nicht mehr an das Trinkwassernetz angeschlossen, weil die Grenzwerte für Nitrat seitdem überschritten werden. Grund für den zu hohen Nitratgehalt ist die intensive Landwirtschaft im Bereich der quartären Talfüllung und damit im Schutzgebiet selbst. Außerdem besteht ein Problem mit Altlasten im Boden von Industriestandorten der näheren Umgebung (Wasserwirtschaftsamt Esslingen).
6.3 Siedlungsstruktur
Die Baustruktur in Esslingen Pliensauvorstadt ist deutlich städtisch geprägt.
Der Stadtteil ist durch die neuere Vogelsangerbrücke, die Esslingen an die B10 anschließt, und die historische Pliensaubrücke, nur für Fußgänger und Radfahrer, mit dem Stadtkern verbunden.
6.3.1 Beschreibung
Eine dichte Blockrandbebauung, die sich deutlich zur alten Pliensaubrücke hin orientiert, spiegelt die städtische Situation der gegenüberliegenden Neckarseite. Der Fluss und die vierspurige B10 trennen vom Stadtzentrum. Die städtische Prägung findet ihre Zäsur in der Karl-Pfaff-Straße, östlich derer eine deutliche Verlandschaftlichung der Baustruktur einsetzt. Diese findet zum einen Ausdruck in der offenen Bauweise, Zeilenbau der 50er und 60er Jahre, die ab hier das Bild beherrscht. Zum anderen bildet hier ein Industriegebiet, Spiegelung der Bahnanlagen auf Esslinger Neckarseite, kenntlich durch die Straßennamen, Bosch-,Daimler, Otto-, Dieselstrtaße einen Abstand der Wohnzeilen zu Bundesstraße und Fluss. Grenze ist hier der Verlauf der Stuttgarter Straße. Östlich von Zeilenbau und Industrie wird nun endgültig der Übergang zur freien Landschaft vollzogen. Die Aktuelle Siedlungsgrenze bildet das Gelände der Firma Bauer-Antriebstechnik, der Schulkomplex der Albert-Stifter-Waldorfschule und im Süden davon der Sportplatz des VFL Post. Auf dem Projektgelände selbst greift das Architekturbüro Kohlhoff und Kohlhoff, Stuttgart, mit seinem städtebaulichen Entwurf das Thema Stadt durch eine Kombination von Zeilenbauweise, Weilstraße und Blockrandbebauung, langer Gebäudekörper, Stuttgarter-Straße erneut auf. Der abrupte Übergang zur offenen Landschaft soll durch einen achtgeschossigen „Turm“, das Thema Stadtmauer zitierend, geschaffen werden.
6.3.2 Beurteilung hinsichtlich der Regenwasserbewirtschaftung
Neben hydrogeologischen und gesetzlichen Aspekten spielt die Siedlungstruktur eine wesentliche Rolle. In Betracht kommen hier Nutzungsstrukturen und bauliche Gegebenheiten. Zitiert werden in diesem Zusammenhang immer wieder die Typisierungen der Emschergenossenschaft (1993). Danach liegt das Projektgebiet mit verschiedenen GRZ von 0,25 - 0,3 und seiner Kombination aus Blockrand- sowie offener Zeilenbebauung zwischen den Typen „Innerstädtische Wohn- und Mischgebiete“ und Geschosswohnungsbau der 60er-70er Jahre. Der Versiegelungsgrad solcher Gebiete mit überwiegender Zeilenbebauung beträgt durchschnittlich 30 - 50%. Die Nutzungsform ist im Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet festgeschrieben. Die Freiflächen werden als Mietergärten und große Abstandsgrünflächen genutzt.
Die strukturellen Voraussetzungen einer optimierten Regenwasserbewirtschaftung sind demnach als überdurchschnittlich gut einzustufen.
Das reichliche Abstandsgrün ermöglicht ein hohes Maß an gestalterischer Freiheit. Grundstücksübergreifende Maßnahmen sind problemlos möglich. Versickerung des Regenwassers auf Verkehrs- und sonstig versiegelten Flächen ist bei Beachtung des Grundwasserschutzes möglich. Einzelmaßnahmen wie Dachbegrünung und Regenwassernutzung sind möglich. Auf Grund der reichlich vorhandenen Flächen und der Durchlässigkeit ist die Versickerung über flächenhafte Anlagen und flache Mulden möglich.
Die homogene Eigentümerstruktur erleichtert darüber hinaus das konsequente Planen (Uhl 1995).
Die Summe versiegelter Flächen für hohe Zeilenbebauung liegt durchschnittlich bei 41% (Ranft 1991). Das mögliche Abkopplungspotential dieser Versiegelung beträgt bei diesem Siedlungstyp 70% (Adams 1996).
Da im Gebiet der Oberboden einen pH-wert von 7 aufweist und der Kf-wert bei 4×10-5 liegt, ist eine Gefährdung des Grundwassers durch Schwermetalle und anders Schadstoffe weitestgehend auszuschließen (Kapitel 2.3, S. 23 u. 6.2, S. 59 ). Der ausreichende Grundwasserflurabstand von 2.6m (Jungbauer 1998) wird zudem durch eine Aufschüttung zwischen den Baukörpern um 2m auf ca. 4,5m erhöht.
Die Bewirtschaftung des Regenwassers aus Dach-, Hofflächen und minderbelasteten Zuwegungen durch Versickerung in begrünten Mulden sowie auf Grünflächen, ist somit auch im Bereich des Trinkwasserschutzes der Zone III-B als unproblematisch anzusehen.
Die Wohnwege können mit geeigneten wasserdurchlässigen Pflasterbelägen befestigt werden, die zusätzlich noch die Möglichkeit haben, in die ausreichend vorhandenen angrenzenden Grünflächen zu entwässern. Terrassen und Balkone können über Wasserspeier auf die intensive Dachbegrünung der Tiefgarage entwässern.
Eine Regenwassernutzung ist im Projektgebiet nicht vorgesehen. Die Entscheidung beruht einerseits darauf, dass die Dachbegrünung die Regenwassererträge um 50-70% (Zinco 1998) vermindert und andererseits darauf, dass durch den Eintrag von Huminstoffen aus der Vegetationsschicht eine Verfärbung des Wassers nicht auszuschließen ist. Dadurch ist es für die Speisung von Waschmaschinen ungeeignet. Betrachtet man den Aspekt der Amortisation, so ist auch dieser ungünstig, da Wasserertrag und Bedarf stark differieren. Im Idealfall sollte der Ertrag den Bedarf decken. Aus diesen Gründen wird von einer Regenwassernutzung abgesehen. Der Ertrag entspricht dem Niederschlagswasser, das im Jahresdurchschnitt über die Fallrohre zum Abfluss kommt.
Das wären für Haus 5 und 6 (s. Plananlage) mit einer Dachfläche von 912 m² bei einem Abflussbeiwert von 0.5: (912,5 m² × 662 l/m²× a) × 0,5 = 302 l × 10³ / a = 302 m³ / a. Der Bedarf bei 70 Bewohnern entspricht 70 ×15 m³ / a = 1050 m³ / a (nach König 1996). Bei Eigentumswohnungen besteht hier die Möglichkeit, etwa nur die Wohnungen im Parterre mit Regenwassernutzungsanlage zu verkaufen, aber beim Mietwohnungsbau besteht das Problem der gerechten Kostenumlage der Regenwassernutzung.
7 Pläne und Erläuterung
7.1 Planverzeichnis:
(Die Pläne 1.-6. befinden sich in der Plananlage, 7. im Textteil)
Die Zeichengrundlage für P-1,2 u. 3 war der Bebauungsplan für das Projektgebiet im Maßstab 1:500 stammt vom Stadtplanungsamt Esslingen. Die Höhenangaben in P–1 bis 3 sind dem Kanallisationsplan des Tiefbauamtes Esslingen entnommen worden bzw. basieren darauf.
Die Grundlage von P-4 wurde von mir im gleichen Maßstab übernommen, ebenfalls vom Stadtplanungsamt Esslingen. Das Detail D-1, Dachbegrünung, basiert auf einer Zeichengrundlage des Architekturbüros Kohlhoff & Kohlhoff, ebenfalls im gleichen Maßstab.
1. P-1: Entwässerungstechnische Regenwasserversickerung, M 1:250
2. P-2: Flächen und Volumina zur Regenwasserversickerung, M 1:250
3. P-3: Schnitt von Süd nach Nord, Ansicht Haus 5 u. 6 ,M 1: 250
4. P-4: Übersichtsplan, Esslingen – Breite, M 1:2500
5. D-1: Detail Dachbegrünung, M 1: 10
6. D-2: Detail Rinne/Mulde M 1: 20
7. Lage des Projektgebietes im Wasserschutzgebiet,
Im Textteil (s. S.62a) M 1: 10000
7.1.1 ad 1. : (P-1) Entwässerungstechn. Regenwasserversickerung
M 1:250, 90 x 150cm, koloriert
Der Plan zeigt das gesamte Plangebiet. Deutlich erkennbar ist die Aufschüttung hinter der Blockbebauung sowie neben und zwischen den Zeilen mit der daraus resultierenden Böschung. Die Aufschüttung ergibt sich aus der relativ hoch liegenden Tiefgarage mit intensiver Dachbegrünung jeweils vor dem Baukörper. Die Substratmächtigkeit beträgt 50 cm. Das Niveau der Aussenanlagen liegt deshalb ca. 2 m höher als das der Stuttgarter Straße. Da das Gebiet Richtung Weilstraße (Süd) leicht ansteigt, beträgt der Höhenunterschied hier nur noch ca. 1,5m (vergl. hierzu auch Plan P-3).
Das Wegenetz erschließt alle Flächen im Projektgebiet. Alle Wege sind aus wasserdurchlässigem Pflaster (vergl. S. 54 u. D - 2) herzustellen. Die Stellplätze entwässern konventionell in den Rinnstein angrenzender Straßen.
Aufgrund des Trinkwasserschutzes wurde hier auf einen versickerungsfähigen Belag verzichtet, obgleich die Möglichkeit besteht, das Wasser der Parkflächen unterirdisch in einem Rigolensystem zu sammeln, das direkt in die Kanalisation entwässert. Ein Durchdringen der Sickerwässer in den Grundwasserleiter würde dann durch eine eingebrachte Dichtung aus verdichtetem Lehm oder Ton erreicht werden. Dieser Aufwand steht allerdings in keinem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis und wäre lediglich Ausdruck eines unflexiblen Festhaltens an Prinzipien.
Die Dachflächen der Häuser 1-12 sind zu begrünen (vergl. Plan: D-1). Sie entwässern über die eingezeichneten Regenfallrohre (DN –100) in offene Pflasterrinnen (vergl. Plan D-2). Diese leiten das Regenwasser oberirdisch der stets parallel zum Haus liegenden Versickerungsmulde zu.
7.1.2 ad 2. : (P-2) Flächen und Volumina zur Regenwasserversickerung
M 1 : 250, 90 x 150 cm, teilkoloriert
Zunächst ist die Mindestdimensionierung der Mulden, die das Regenwasser der Gründächer aller Häuser aufnehmen sollen, festzustellen. Dies ist im Anhang S. 81 und in den folgenden Tabellen dargestellt.
Die geplanten Volumina und Flächen sind in die einzelnen Muldenflächen eingetragen worden, um eine visuelle Zuordnug der einzelnen Größen herzustellen.
Aus gestalterischen Gründen sollte sich die Versickerungsanlage in das Gesamtbild einfügen. Zweckmäßig wäre, dass die Mulden nah an den zu entwässernden Flächen liegen und hierbei nicht unnötige Nutzungskonflikte, etwa mit Mietergärten, provozieren.
Deshalb bietet es sich hier besonders im Bereich der Häuser 5 - 12 an, die Mulden im halböffentlichen Raum parallel zu den Erschließungswegen anzulegen. Um sie nicht als Barriere mit steilen Böschungen erscheinen zu lassen, sollen sie möglichst flach und offen, damit unauffällig sein. Eine Breite von 3 m gibt die Möglichkeit zur Anlage von Böschungen im Verhältnis 1:5, bei einer Tiefe von 0,2 m. Die waagerechte Sohle der Mulde ist demnach 1 m breit. Damit geraten sie nicht näher als 5 m an den Baukörper und lassen noch Platz für eine Sickerläche von 0,5 m Breite entlang der Wohnwege. Desweiteren gerät die Pflege, sprich das Mähen mit Maschinen nicht zum Problem.
Wo Kreuzungen mit Wegen, wie in den Eingangsbereichen oder etwa den Tiefgarageneinfahrten nicht zu umgehen sind, sind die Mulden mit offenen, aber sicher querbaren Rinnen zu verbinden. Dies kann durch Abdeckgitter geschehen. Die Mulden vor den Häusern 1-4 sind ebenso bemessen.
Ein Überlauf in die Kanalisation ist nicht vorgesehen da sie mehr als ausreichende Kapazitäten aufweisen(vergl. Kap. 8.1, S. 71).
7.1.3 ad 3. : (P-3) Schnitt von Süd nach Nord, Ansicht Haus 5 u. 6
M 1: 250, 75 x 30 cm
Der Schnitt verläuft durch das gesamte Projektgebiet von Süd nach Nord, von der Weilstraße zur Stuttgarter Straße. Der schnitt verläuft durch die Mulde vor den Häusern 6 und 5. Hier werden die Niveauverhältnisse, die in der Beschreibung von P-1 bereits angesprochen wurden deutlich. Entwässerungstechnisch herschen hier geradezu Idealbedingungen. Durch die tiefgaragenbedingte Aufschüttung ergibt sich eine ebene Fläche, die extrem lange und schmale Versickerungsmulden zulässt. Da das Baugebiet höher als die Umgebung liegt, kann im Falle einer Überlastung der Versickerungsanlagen das Niederschlagswasser in die Grünanlagen und die Flächen der Stellplätze auf Weil- und Stuttgarter Straße fließen. Insgesamt fällt das Gelände nach Norden, Richtung Neckar leicht ab. Durch die geringen Einstauzeiten von weniger als maximal 1,5 h ist ein Bepflnzen der Mulden mit feuchtetoleranten Pflanzen möglich und erwünscht. der Schnitt zeigt eine pflanzung von Allebäumen.
7.1.4 ad 4. : (P-4) Übersichtsplan, Esslingen – Breite, M 1:2500
M 1 : 2500, DIN A3
Der Übersichtsplan lässt wesentliche Teile der auf S. 62 erläuterte Siedlungsstruktur erkennen. Gut zu erkennen sind industriegebiet im Norden, Zeilenbau der 50er und 60er Jahre im Süden, Schulzentrum und Sportplatz im Osten und die verdichtete Blockrandbebauung im Westen. Im Nordosten sind B1 u. Neckar zu erkennen.
7.1.5 ad 5. : (D-1) Detail Dachbegrünung
M 1 : 10, DIN A3
Dargestellt ist hier der Randbereich ein eines Daches der Häuser 1-12. Die Attika aus 20 cm Stahlbeton ist 80 cm hoch. 10 – 12 cm Mineralsubstrat bewirken einen Abflussbeiwert von 0,3 –0,5 (Zinco 1998). Das bedeutet, dass bei durchschnittlichen Regenereignissen nur 30 – 50% des Wassers überhaupt über das Fallrohr zum Abfluss gelangen. Wichtig ist, dass die Dachdichtung mit einem schadstoffarmen Material hergestellt wird. Bituminöse Dichtungsschichten emittieren organische Verbindungen, Luft und Wasser auf dem Dach werden zusätzlich zur Primärbelastung mit Schadstoffen belastet. EPDM - Kautschuk verhält sich hier weitestgehend neutral. Flachdachgully und Fallrohr sollten aus PVC freiem Kunststoff, zB. PE oder keramischem Werkstoff sein. Filtervlies und Trenngitter minimieren das Ausschwemmen von Kleinpartikeln.
7.1.6 ad 6. : (D-2) Detail Rinne/Mulde
M 1: 20, DIN A 3
Die Wasseraustrittsöffnung der unteren Fallrohrenden ist 10 – 15 cm über der Pflasterrinne anzubringen um ein Verstopfen und Vereisen der Rohröffnung durch Schnee und Eis zu vermeiden. Die Pflasterrinnen sollen das anfallende Regenwasser mit einem Gefälle von 3% den Versickerungsmulden zuleiten. Nach 6 m Rinnenweg ist die Muldensohle bis auf 2 cm Höhenunterschied erreicht. Drei bis vier leicht ansteigende (2-3%) Pflasterreihen verringern die Fließgeschwindigkeit beim Einlaufen des Niederschlagswassers. Damit wird die hydraulische Belastung der Sohle im Einlaufbereich verringert.
Die 20 cm tiefen Mulden sind 5 m entfernt vom Haus. Die Böschungen sind im Verhältnis 1:5 herzustellen. Die Böschungskanten sind abzurunden. Bei allen Mulden ist unbedingt darauf zu achten, dass ein mindestens 40 cm starker Bodenhorizont mit einem kf- Wert von 4 × 10-5 m / s eingebaut wird. Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die das Bodenleben der oberen cm fördern. Als Vegetationsdecke ist ein Extensivrasen einzusähen. Bestens bewährt hat sich (nach ATV 1997) eine Saatmischung der Firma HESA.
7.1.7 Lage des Projektgebietes im Wasserschutzgebiet,
Im Textteil (S.62) M 1: 10000, DIN A3
Erläuterung s. S.62.
7.2 Sicherungsmaßnahmen für die Bauphase
Verdichtungen des Untergrundes mindern die Wasserdurchlässigkeit des Bodens erheblich. Ein lehmig-schluffiger Boden, wie hier im Planungsgebiet ist dadurch besonders gefährdet. Während der Bauphase muss darauf geachtet werden, dass die Versickerungsflächen nicht zum Lagern von Baustoffen und Bodenaushub genutzt werden. Ein Befahren mit schweren Baufahrzeugen ist zu verhindern. Sinnvollerweise werden Absperrungen errichtet, die eine Beeinträchtigung der Anlagenflächen verhindern. Ein zusätzliches Hinweisschild macht den Zweck der Absperrung kenntlich. Wird der Boden trotzdem befahren oder auf andere Weise verdichtet, muss eine tiefgründige Lockerung, in Extremfällen sogar ein Bodenaustausch erfolgen.
8 Betrieb und Wartung der Versickerungsanlagen
8.1 Sicherheitsmaßnahmen
Bei Regenspenden über dem Bemessungsregen kann im Extremfall ein Überlaufen der Versickerungsanlage eintreten. Der planmäßige Anschluss von Überläufen an das öffentliche Kanalnetz ist nicht sinnvoll. Der städtische Mischwasserkanal stößt bereits beim Eintreten eines Regenereignisses mit jährlicher Überschreitungshäufigkeit an seine Kapazitätsgrenzen. Da die Versickerungsmulden aber für Regenspenden mit fünfjähriger Überschreitunshäufigkeit ausgelegt sind, läuft die Kanalisation bis dahin auch über.
Es ist vielmehr darauf zu achten, dass ein freier Ablauf des Wassers in benachbarte Flächen erfolgen kann, damit eine Schädigung der Gebäude vermieden wird (ATV 1997). Der Überlauf der Häuser 1-4 erfolgt demnach in die Grünflächen längs der Stuttgarter-Straße und schließlich auf die Stellplätze, der Häuser 5-12 in die Grünanlagen längs der Weilstraße.
Die Mulden stellen auch im wassergefüllten Zustand keine besondere Gefährdung dar. Diese ist erst ab einer Tiefe von 40cm gegeben. Kleinkinder sind hier also nicht in besonders gefährdet.
8.2 Winterbetrieb
Unterirdische Versickerungsanlagen sind durch die Lage der Versickerungsebene im frostfreien Bereich unanfällig. Zu- und Überläufe sind allerdings von Schnee und Eis freizuhalten. Offene Anlagen wie Versickerungsmulden sind zwar durch Gefrieren des Bodens, Bildung von Eisschichten und Akkumulation von Schnee in ihrer Funktion bis zum Totalausfall der Versickerungsleistung beschränkt. Hierdurch ist aber keine Gefahr für die Entwässerung zu sehen, da Starkregen mit gleichzeitig gefrorenem Boden in der Regel nicht vorkommen (Adams 1997).
8.3 Pflege und Wartung
Die Dauer der Funktionstüchtigkeit von Versickerungsanlagen ist in hohem Maße von der sorgfältigen Herstellung und regelmäßigen Wartung abhängig. Bei Rohrrigolen empfiehlt es sich die Rohrleitungen einmal im Jahr auf Verunreinigungen zu überprüfen, die dann ggf. über Revisionsöffnungen gespült werden können.
Wenn der Oberboden von Mulden entsprechend sorgfältig modelliert wurde, beschränkt sich die Wartung auf das Mähen der Gras und Krautschicht sowie das beseitigen von Grobstoffen und Abfällen, die in die Mulde gelangt sind. Die starke Durchwurzelung der Oberfläche bedingt eine weitgehende Selbstregeneration der Wasserdurchlässigkeit. Eine Verschlämmung ist auch wegen der kurzen Einstauzeiten nicht zu befürchten. Bei kurzgeschnittenen Rasenflächen kann durch Vertikutieren die Oberflächendurchlässigkeit weiter verbessert werden.
Sollte nach vielen Jahren dennoch eine zunehmende Selbstabdichtung beobachtet werden, so ist eine tiefgründige Auflockerung des Bodens mit geeignetem Gerät durchzuführen. In sehr seltenen Fällen muss die verdichtete Fläche abgeschält, gelockert und neu eingesät werden. Das hört sich drastischer an als es ist, denn hiervon sind nur die oberen 5-10 cm betroffen (Adams 1997).
9 Zusammenfassung
Die entwässerungstechnische Regenwasserversickerung bietet gegenüber der herkömmlichen schnellstmöglichen Ableitung zahlreiche Vorteile, die nicht nur im ökologischen Bereich zu finden sind. Sie wirkt kostendämpfend hinsichtlich der Abwasserkosten, des Baus von Siedlungen des Erhalts sowie des Betriebs der Anlagen. Regenwassernutzung trägt ebenfalls dazu bei, die Schäden durch Hochwasserwellen einzudämmen und die Kosten zu senken, da in dem Maße, in dem Brauchwasser benutzt wird, auch Trinkwasser- samt Abwassergebühr eingespart werden. Die Anlagen werden optimalerweise dezentral erstellt.
Das hält den kostspieligen Aufwand von unterirdischen Leitungen gering. Kurze Wege ermöglichen Leitungen in offenen Rinnen. Das Abwasserproblem wird zudem am Ort des Entstehens gelöst. Interdisziplinäres Planen erhöht den erfolg der Projekte. Die Akzeptanz einer sinnvolleren Regenwasserbewirtschaftung steigt erfreulicherweise und wird bald so selbstverständlich sein, wie heute die Abfalltrennung, auch wenn zur Zeit die Risiken von denjenigen, die noch keine Erfahrungen mit derartigen Anlagen sammeln konnten, bei weitem überschätzt werden.
Literaturverzeichnis
Adams, R. (1996): Dezentrale Versickerung von Niederschlagsabflüssen in Siedlungsgebieten – Umsetzung von Maßnahmen und Anlagen in die Praxis In: Sieker, F. (1996), (Hrg.): Schriftenreihe für Stadtentwässerung und Gewässerschutz – Nr. 14
Adams, R. (1997): Betriebserfahrungen mit Versickerungsanlagen. In: ATV, (1997): ATV-Schriftenreihe 07 - Versickerung von Regenwass er. 1. Aufl.,Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik e.V. (GFA), St. Augustin
ATV - Abwassertechnische Vereinigung e.V. , (1997): ATV-Schriftenreihe 07 - Versickerung von Regenwasser. 1. Aufl.,Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik e.V. (GFA), St. Augustin
ATV (1977): ATV Arbeitsblatt A 118 - Richtlinien für die hydraulische Berechnung von Schmutz-, Regen- und Abwasserkanälen. GFA, St. Augustin
ATV (1990): ATV Arbeitsblatt A 138 – Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser. GFA, St. Augustin
AVB Wasser (1980): Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser vom 20. Juni 1980. Bundesgesetzblatt, Bonn.
Birgersson, B., Sterner, O., Zimmerson, E. (1988): Chemie und Gesundheit. VHC Verlagsgesellsch. , Weinheim Basel Cambridge New York.
Borgwardt, S. (1995): Die Versickerung auf Pflasterflächen als Methode der Entwässerung von minderbelasteten Verkehrsflächen. Schriftenreihe des Fachbereichs Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung der Universität Hannover – Beiträge zur räumlichen Planung, H. 41, Hannover.
DVWK (1988): Filtereigenschaften des Bodens gegenüber Schadstoffen Teil 1, Beurteilung der Fähigkeit von Böden zugeführte Schwermetalle zu immobilisieren, DVWK-Merkblatt 1988, Nr. 212.
Fischer H. (1995): Ökologisch orientiertes Planen und Bauen – Modellvorhaben „Wasser“ des Ministeriums für Umwelt und Forsten Rheinland Pfalz. In: Technische Akademie Südwest e.V. der Universität Kaiserslautern(TAS): ut95 - 4. Umwelttage Kaiserslautern: Neuer Umgang mit Regenwasser in Siedlungen. TAS, Kaiserslautern.
Geiger, W., Dreiseitl, H. (1995): Neue Wege für das Regenwasser. R. Oldenbourg, München, Wien.
Geiler, N. (1997): die Entwicklung der Deutschen Wasserwirtschaft in den letzten vier Jahren – vier verlorene Jahre. Referat auf der Tagung „Wasser“, Berlin `97. http://www.freiburg.toplink.net/abwasser/wirtschaft/referat.htm
Gesetzblatt für Baden- Württemberg (31.08.1998): Gesetz zur Vereinfachung und Beschleunigung wasserrechtlicher Verfahren (Wasserrechtsvereinfachungs- und –beschleunigungsgesetz) S. 422-435. Staatsanzeiger Baden-Württemberg, Stuttgart.
Gluga, G. Eyrich A., König B., Fürtig G. (1987): Wasserhaushaltsuntersuchungen im Raum Berlin. Wasserwirtschaft-Wassertechnik Nr. 37, S. 113-116
Grotehusmann, D. (1995): Versickerung von Niederschlagsabflüssen unter Berücksichtigung des Grundwasserschutzes. SuG-Verlagsgesellschaft, Hannover.
Grotehusmann, D., Schiedt, L. und Uhl, M. (1995): A138+, Programm zur Bemessung von Versickerungsanlagen nach ATV-Arbeitsblatt 138. Ingenieurgesellschaft für Stadthydrologie (ifs), Hannover.
Grottker, M. (1995): Regelungsbedarf zur Regenwasserbewirtschaftung – Ziele und Inhalte. In: Technische Akademie Südwest e.V. der Universität Kaiserslautern (TAS): ut95 - 4. Umwelttage Kaiserslautern: Neuer Umgang mit Regenwasser in Siedlungen. TAS, Kaiserslautern.
Handschmann W. (1996): Projektmanagement, Skript zur Vorlesung: „Arbeitspädagogik/Projekt- und Teammanagement“ an der Fachhochschule Nürtingen
Hartke, K.-H., Horn R. (1991): Einführung in die Bodenphysik. Enke, Stuttgart.
Häßler, D. (1995): Elemente der naturnahen Regenwasserentsorgung in ländlichen Siedlungen. In: Technische Akademie Südwest e.V. der Universität Kaiserslautern(TAS): ut95 - 4. Umwelttage Kaiserslautern: Neuer Umgang mit Regenwasser in Siedlungen. TAS, Kaiserslautern.
IFS, Ingenieurgesellschaft für Stadthydrologie (1995): Seminarunterlagen-Programm zur Bemessung von Versickerungsanlagen nach ATV-Arbeitsblatt A138. IFS, Hannover.
Illian, H. (1997): Realisierung von zukünftigen Abwasserkonzepten bei knappen Kassen aus der Sicht eines Ingenieurbüros. In: Korrespondenz Abwasser 2/97, S. 309-315.
Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und Landwirtschaftlichen Wasserbau (Hrg.), (1988): Alternative Methoden der Regenwasserentsorgung (dezentrale Retention). In: Sammelwerk „Hydrologie der Stadtentwässerung“. IWH, Hannover.
IWH siehe Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und Landwirtschaftlichen Wasserbau
Jungbauer und Partner (1998): Bodenprofile der Grundwassermessstellen auf dem Firmengelände der Firma Bauer Antriebstechnik vom 22.01.1998. Dr. Jungbauer & Partner, Stuttgart.
König, W. (1996):Regenwasser in der Architektur: Ökologische Konzepte, 1. Aufl., Ökobuch Verlag, Staufen bei Freiburg
Kuttler W. (1993): Stadtklima. In: Sukopp, H., Wittig, R. (Hrg.).: Stadtökologie. Fischer, Stuttgart 113-153.
Muth, W. (1989): Sickerfähige Beläge aus Betonpflaster. Tiefbau, Ingenieurbau, Straßenbau (TIS)31. Heft 6, S.349-356.
Ranft, U. (1991): Tabelle - Summen versiegelter Flächen für verschiedene Siedlungstypen. In: Adams, R. (1996): Dezentrale Versickerung von Niederschlagsabflüssen in Siedlungsgebieten – Umsetzung von Maßnahmen und Anlagen in die Praxis
Renger, M. (1993): Bodenwasser- und Grundwasserhaushalt. In: Sukopp, H., Wittig, R. (Hrg.).: Stadtökologie. Fischer, Stuttgart 173-182.
Rössert, R. (1969): Grundlagen der Wasserwirtschaft und Gewässerkunde. Oldenbourg Verlag, München, Wien.
Roth, V. (1995): Mustersatzung für die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung, veröffentlicht in: Zeitschrift für Stadtentwässerung und Gewässerschutz, Heft 32/1995. SuG-Verlag, Hannover
Scheffer, F., Schachtschabel P. (1992): Lehrbuch der Bodenkunde. 13. Aufl., Enke, Stuttgart.
Schmitt, T., Zimmermann J. (1995): Möglichkeiten der Regenwasserversickerung im Saarland – Gesamtbetrachtung und Beispiele. In: Technische Akademie Südwest e.V. der Universität Kaiserslautern(TAS): ut95 - 4. Umwelttage Kaiserslautern: Neuer Umgang mit Regenwasser in Siedlungen. TAS, Kaiserslautern.
SEG – Stadtentwässerung Schwerte GMBH (1998): Sickerversuch. Internet : http://www.stadt-schwerte.de/SEG/RegenSicker7.htm
Sieker, F. (1995): Szenarien für eine naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung. In: Technische Akademie Südwest e.V. der Universität Kaiserslautern(TAS): ut95 - 4. Umwelttage Kaiserslautern: Neuer Umgang mit Regenwasser in Siedlungen. TAS, Kaiserslautern.
Stecker , A. (1995): Möglichkeiten der Regenwasserversickerung im Rahmen neuer Entwässerungskonzeptionen. Wasser, Abwasser, Praxis 2/95. Bertelsmann, Gütersloh In: (König, W. 1996)
TAS (1995) Technische Akademie Südwest e.V. der Universität Kaiserslautern: ut95 - 4. Umwelttage Kaiserslautern: Neuer Umgang mit Regenwasser in Siedlungen. TAS, Kaiserslautern.
Uhl, M. (1995): Umsetzung der Regenwasserbewirtschaftung im städtischen Bereich. In: Technische Akademie Südwest e.V. der Universität Kaiserslautern (TAS): ut95 - 4. Umwelttage Kaiserslautern: Neuer Umgang mit Regenwasser in Siedlungen. TAS, Kaiserslautern.
Zinco, (1998): Planungshilfe - für Gründächer. 6. Aufl. Nürtingen, Zinco GmbH
Abbildungsverzeichnis
Abb.- 1: Wasserhaushalt „Gewachsener“ Boden aus König W. 1996, S18, leicht verändert
Abb.- 2: Wasserhaushalt „Pflaster“ aus König W. (1996), S18, leicht verändert.
Abb.- 3: Abflussspenden bei unterschiedlicher Geländenutzung in l/(s×km²) und die resultierenden Wasserstände aus König W. (1996), S. 26 (urspr. aus Emschergenossenschaft (1993): Wohin mit dem Regenwasser - Arbeitshilfe für einen ökologischen Umgang mit Regenwasser in Baugebieten , Heft 7, Emschergenossenschaft, Essen.)
Abb.- 4: Schema der Regenwasserbewirtschaftung vor Ort: Longdong, D. (1997) in: Entsorgungspraxis, 1997, Nr. 10, Bertelsmann Fachmagazin für Kreislaufwirtschaft, Abwassertechnik und Luftreinhaltung, S. 43.
Abb.- 5: Beziehung zwischen Wasserspannung und Wassergehalt aus Scheffer/Schachtschabel (1992), S. 130.
Abb.- 6: Verschiedene Zustände des hydraulischen Potentials im Boden aus Borgwardt, S. (1995), S.15, (in Anlehnung an Scheffer/Schachtschabel (1992))
Abb.- 7: Beziehung zwischen Wasserleitfähigkeit und Wasserspannung aus Renger, M. (1993), S.174.
Abb.- 8: Schematische Darstellung der Wasserhaushaltskomponenten urbaner Böden, Renger, M. (1993), S. 175.
Abb.- 9: Durchlässigkeit von Lockergestein, ATV (1990), S. 5
Abb.-10: Prozesse bei der Regenwasserversickerung, Grotehusmann (1995), S. 7
Abb.-11: Wartungshäufigkeit von Regenwasserversickerungsanlagen, ATV (1997), S. 20
Abb.-12: Absicht den Anteil der Versickerung von Dachflächen zu erhöhen, ATV (1997), S. 22
Abb.-13: Wasserwirtschaftliche Bedeutung der Niederschlagsversickerung, ATV (1997), S. 23
Abb.-14: Mittlere Monatsniederschläge in Deutschland, König, W. (1996), S. 14
Abb.-15: Darstellung des Sickerweges, ATV (1990), S.9
Abb.-16: Elemente der Regenwasserbewirtschaftung, Häßler, D. . In: TAS (1995), S. 172
Abb.-17: Systemelemente eines Versickerungssystems, Strecker, A. . In: König, W. (1996), S. 147
Abb.-18: Aufbau einer durchlässig befestigten Fläche mit Rasenpflaster nach ATV (1997)
Abb.-19: Schematischer Quer- und Längsschnitt eines Mulden-Rigolenelementes , IFS (1995), S. 12
Tabellenverzeichnis
Tab.-1: Typische Kf –Werte für die verschiedenen Hauptbodenarten nach Hartke, Horn 1991
Tab.-2: Wasserhaushaltskomponenten in % Niederschlag/Jahr, nach Gluga et al. , 1987. In Anlehnung an Sukopp und Wittig 1993, S. 176.
Tab.-3: Relevante organische Schadstoffe bei der Regenwasserversickerung nach Grotehussmann, 1995, S.11.
Tab.-4: Relevante Schwermetalle bei der Regenwasserversickerung nach Grotehusmann, D. , 1995, S.12
Tab.-5: Relative Bindungsstärke von Schwermetallen an Humus- und Tonmineralboden bei pH-Werten unterhalb des angegebenen Grenz-pH nach DVWK, 1988. In: Grotehusmann, D. , 1995, S. 43.
Tab.-6: Anteilsverteilung der verschiedenen Bauarten in den Gemeinden nach ATV, 1997.
Tab.-7: Verteilung der Niederschlgshöhen und –Spenden. LFU, Baden-Württemberg, 1976.
Tab. -8: Abflussbeiwerte verschiedener Oberflächen nach Geiger, W. ,1995.
Tab. -9 : Oberflächenbeiwerte nach Manning/Strickler aus Geiger, W. ,1995.
Tab.-10: Möglichkeiten der Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser in Abhängigkeit vom Untergrund in Wasserschutzgebieten nach ATV, 1990.
Tabellen im Anhang
Tab. A1: Tab. A1: Mindestdimensionierung nach ATV
Tab. A2: geplante Werte
Tab. A3: Ergebnis fürGruppe1(Häuser 1-4)
Tab. A4: Ergebnis fürGruppe2(Häuser 5, 7, 9,11)
Tab. A5: Ergebnis fürGruppe 3(Häuser 6, 8, 10, 12)
Anhang
Tabellen der Flächen und Volumenberechnung
Mindestdimensionierung
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse nach einer einfachen Dimensionierung. Dabei wird zunächst die an die Mulde angeschlossene Fläche, mit dem Abflussbeiwert y (hier Ared × (0,7) multipliziert. Mit einem zunächst angenommenen Flächenbedarf von Ared/5 für die Muldenfläche As wird mit der Formel:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
das Volumen der Mulde errechnet. Volumen, geteilt durch gewünschte Tiefe, ergibt dann den minimalen Flächenbedarf As (vergl. Kapitel 5.7.2, S.55).
Tab. A1: Mindestdimensionierung (nach ATV 1990)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der tatsächliche Abflussbeiwert der Dachbegrünung mit einer Substratstärke von >= 10cm, wie im Projektgebiet geplant, liegt nach Angaben der Firma Zinco GmbH in Nürtingen zwischen 0,3 und 0,5. Die Rechnung enthält also bereits einen Sicherheitsspielraum.
Flächen und Volumina
Tab. A2: geplante Werte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Sicherheitsnachweis durch Einbeziehung von Regenstatistik
Für die Sicherheitsberechnung wurde das Computerprogramm „A138 +“ des Institutes für Stadtentwässerung Hannover (IFS) benutzt. Es ermittelt den kritischen Belastungsfall aus folgenden Daten:
1. der Regenstatatistik (für den mittleren Neckarraum (vergl. S. 42-44))
2. der angeschlossenen Fläche (x× m²)
3. der verfügbaren Versickerungsfläche (x × m²)
4. dem kf-Wert (4×10-5 m/s)
5. der maximalen Entleerungszeit der Mulde (24h)
Als Ergebnis erhält man eine Auflistung der Belastungen in Bezug auf die einzelnen Regenspenden.
Da alle Mulden der Häuser 1-4 in einer Ebene liegen und in der Lage sind, sich gegenseitig hydraulisch zu entlasten, wurden sie additiv zu einer Gruppe zusammengefasst. Die Häuser 5, 7, 9, 11 und ihre Mulden sind identisch. Desgleichen Häuser 6, 8, 10 ,12.
Gruppe 1 = Mulden der Häuser 1-4
Gruppe 2 = Mulden der Häuser 5, 7, 9,11
Gruppe 3 = Mulden der Häuser 6, 8, 10, 12
Die Zeilen, die die Mindestanforderungen an die Dimensionierung durch den kritishen Belastungsfall, wiedergeben sind fett gedruckt. Der Abflussbeiwert wurde gleich 1 gesetzt um ein wassergesätigtes Substrat auf dem Dach zu simulieren.
Tab. A3: Ergebnis fürGruppe1(Häuser 1-4):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. A4: Ergebnis fürGruppe2(Häuser 5, 7, 9,11) :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab A5: Ergebnis fürGruppe 3(Häuser 6, 8, 10, 12):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mustersatzung (nach Roth 1995)
Im Originalexemplar der Diplomarbeit ist die in einigen Teilen abgeänderte Satzung auszugsweise mit abgedruckt.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Das Dokument behandelt die Bewirtschaftung von Regenwasser, insbesondere die dezentrale Versickerung, im Kontext von Siedlungsentwässerung, Umweltschutz und gesetzlichen Vorgaben in Deutschland, mit Fokus auf Baden-Württemberg. Es beinhaltet Grundlagen, technische Aspekte, Gesetze, Erfahrungen und eine konkrete Projektplanung.
Was sind die Hauptziele einer Regenwasserbewirtschaftung laut diesem Dokument?
Die Hauptziele sind die Reduzierung des Abflusses, die Minimierung der Nachteile traditioneller Ableitungssysteme, die Aufrechterhaltung der Sicherheit gegen Überflutungen und Vernässungen, die Wahrung hygienischer Standards und die Vermeidung übermäßiger Kosten.
Welche Gesetze und Vorschriften werden im Zusammenhang mit der Regenwasserbewirtschaftung genannt?
Das Dokument erwähnt das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die Landeswassergesetze (LWG) (insbesondere die Änderungen in Baden-Württemberg ab 1999), das Abwasserabgabegesetz (AbwAG), die Gemeindeordnungen, DIN-Normen, die HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) und die Arbeitsblätter der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV), insbesondere das Arbeitsblatt A 138.
Welche technischen Aspekte der Regenwasserversickerung werden behandelt?
Es werden Bodenphysikalische Grundlagen, Definition der dezentralen Versickerung, Niederschlag, Abflussbeiwerte, Fließgeschwindigkeiten, Versickerungsraten, verschiedene Versickerungsanlagen (Flächenversickerung, Muldenversickerung, Rohr- und Rigolenversickerung, Schachtversickerung), Dachbegrünung und Regenwassernutzungsanlagen (Speicher, Filter) behandelt.
Was sind die verschiedenen Arten von Regenwasserversickerungsanlagen, die in diesem Dokument genannt werden?
Die verschiedenen Arten von Regenwasserversickerungsanlagen, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind: Flächenversickerung, Muldenversickerung, Rohr- und Rigolenversickerung und Schachtversickerung. Die Muldenversickerung wird hinsichtlich des Grundwasserschutzes als besonders günstig eingeschätzt.
Welche Erfahrungen mit Versickerungsanlagen in Deutschland werden beschrieben?
Eine Umfrage der ATV aus dem Jahr 1995 wird zitiert, die zeigt, dass Versickerungsanlagen in vielen Gemeinden existieren, der Sickerschacht die am weitesten verbreitete Bauart ist und die Betriebssicherheit in der Mehrzahl der betriebenen Anlagen als gewährleistet gilt. Probleme sind Selbstabdichtung, mangelnde Sickerfähigkeit, bauliche Mängel, mangelnde Wartung, hydraulische Überlastung, Fehlanschlüsse, falsche Rinnensicherung und Wurzelwachstum.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der Umfrage zur Regenwasserversickerung?
Die Umfrage zeigt, dass die Kommunen, die schon Erfahrungen mit solchen Anlagen haben, diese wesentlich positiver bewerten als Gemeinden, die sich damit weniger auskennen bzw. keine Erfahrungen sammeln konnten. Die Regenwasserversickerung wird sich verstärkt durchsetzen.
Welche Rolle spielt der pH-Wert des Bodens bei der Versickerung?
Der pH-Wert des Bodens ist eine wichtige Einflussgröße für die Mobilität von Schwermetallen im Boden. Neutrale bis leicht alkalische Böden sind der beste Schutz gegen Schwermetalle. Sehr saure Waldböden haben einen pH-Wert von 3.
Welche Faktoren beeinflussen die Wahl der Versickerungsanlage?
Die Wahl der Versickerungsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von den hydrogeologischen Eigenschaften des Bodens, der Lage des Gebietes (z. B. Wasserschutzgebiet), dem Grad der Versiegelung der Flächen, den gesetzlichen Anforderungen und den verfügbaren Platzverhältnissen.
Was beinhaltet die Projektplanung in dem Dokument?
Die Projektplanung beinhaltet eine Beschreibung des Projektgebiets in Esslingen, geologische und hydrologische Aspekte, die Siedlungsstruktur, Pläne zur Entwässerung und Regenwasserversickerung, die Dimensionierung der Versickerungsanlagen sowie Maßnahmen für den Betrieb und die Wartung der Anlagen.
Welche Sicherungsmaßnahmen werden für die Bauphase empfohlen?
Um Verdichtungen des Untergrundes zu vermeiden, wird empfohlen, die Versickerungsflächen nicht zum Lagern von Baustoffen und Bodenaushub zu nutzen und ein Befahren mit schweren Baufahrzeugen zu verhindern. Es sollen Absperrungen errichtet werden, die eine Beeinträchtigung der Anlagenflächen verhindern.
Wie sollten Versickerungsanlagen gewartet werden?
Versickerungsanlagen sollten regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Bei Rohrrigolen wird empfohlen, die Rohrleitungen einmal im Jahr auf Verunreinigungen zu überprüfen. Bei Mulden beschränkt sich die Wartung auf das Mähen der Gras- und Krautschicht sowie das Beseitigen von Grobstoffen und Abfällen.
- Quote paper
- Peter Gueldenberg (Author), 1998, Regenwasserbewirtschaftung statt Regenwasserbeseitigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107867