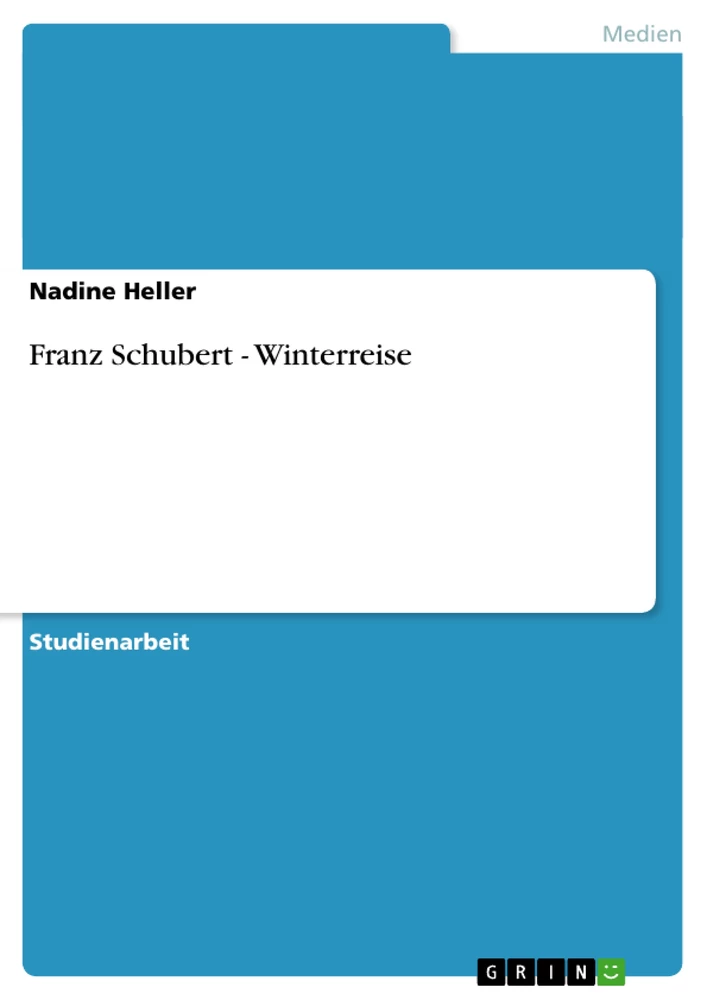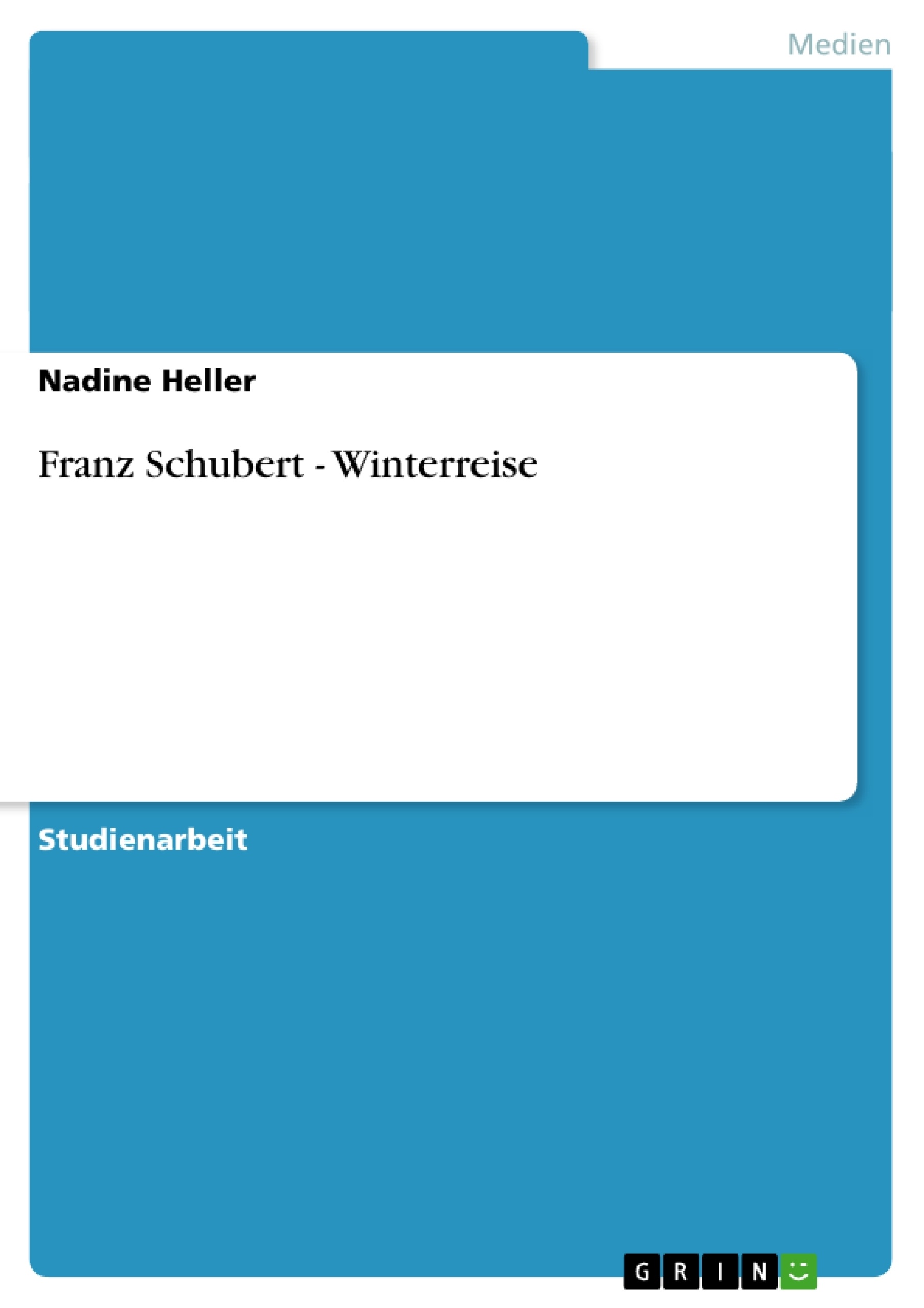Der Text handelt von einem einsamen Wanderer, der seine Heimat verlassen hat, und sich nirgends mehr zu Hause fühlen kann (=> fremd). Er erinnert sich an eine glückliche Zeit im Mai mit einem Mädchen, das sehr starke Gefühle für ihn hegte. Es war von Liebe und sogar von Heirat die Rede. Doch ehe es soweit kommen konnte, zog ihn das Fernweh weiter, und er verließ sie. Man bekommt fast den Eindruck, dass er diese Entscheidung angesichts der Kälte des Winters nun bereut.
In der zweiten Strophe bringt der Dichter zum Ausdruck, dass der Wanderer von einer unbestimmten Sehnsucht zu Wandern getrieben wird. Der Mond ist sein einziger Gefährte, mit dessen Hilfe er im Schnee die Spuren des Wildes, und somit einen geeigneten Weg finden kann.
Wieder schweifen seine Erinnerungen zurück zu dem Mädchen. Er versucht seine Entscheidung zu begründen und rechtfertigt sich vor sich selbst in dem er die Schuld der Liebe an sich zuschiebt: sie sei nichts beständiges und wandere von „Einem zu dem Andern“; fast willkürlich, wie es ihr gefällt. In Gedanken verabschiedet er sich von seiner Liebsten, um endgültig mit dem Thema abzuschließen.
Doch wie so oft siegt das Gefühl und die Erinnerung: er beschreibt, wie er sich heimlich davongemacht hat, ganz leise, aus Sorge, dass ihn jemand erwischt. Doch er konnte seine Liebste nicht verlassen, ohne ihr wenigstens einen kleinen Gruß zu hinterlassen: Er schrieb ans Tor „Gute Nacht“, damit sie sehen konnte, dass er an sie gedacht hat.
Hausarbeit von Nadine Heller „Gute Nacht! “aus „Winterreise“
I.)Text des Liedes
Die Texte des Zyklusses stammen von Wilhelm Müller.
Fremd bin ich eingezogen,
Fremd zieh ich wieder aus.
Der Mai war mir gewogen
Mit manchem Blumenstrauß:
Das Mädchen sprach von Liebe,
Die Mutter gar von Eh`-
Nun ist die Welt so trübe,
Der Weg gehüllt in Schnee.
Ich kann zu meiner Reisen
Nicht wählen mit der Zeit,
Muss selbst den Weg mir weisen
In dieser Dunkelheit.
Es zieht ein Mondenschatten
Als mein Gefährte mit,
Und auf den weißen Matten
Such ich des Wildes tritt.
Was soll ich länger weilen,
Dass man mich trieb` hinaus?
Lass irre Hunde heulen
Vor ihres Herren Haus.
Die Liebe liebt das Wandern –
Gott hat sie so gemacht –
Von Einem zu dem Andern –
Fein Liebchen, gute Nacht!
Will dich im Traum nicht stören,
Wär´schad um deine Ruh;
Sollst meinen Tritt nicht hören –
Sacht, sacht, die Türe zu!
Schreib im Vorübergehen
An`s Tor dir [:]G u t e N a c h t,
Damit du mögest sehen,
Ich hab an dich [An dich hab ich] gedacht.
II.) Analyse des Texts/ Gedichts
Das Gedicht ist in 4 Strophen gegliedert. Jede Strophe besteht aus 8 Versen.
Das verwendete Metrum ist der Trochäus, allerdings endet jeder 2. Vers auf einer unbetonten Silbe. Das bedeutet, dass die Kadenzen abwechselnd männlich und weiblich sind.
Die Reimform ist der in Gedichten am häufigsten auftretende Endreim, genauer gesagt der Kreuzreim „abab“.
Der Großteil der Reime sind reine Reime. Allerdings gibt es einige wenige Ausnahmen:
- Strophe I, Vers 5 und 7: Liebe – trübe
- Strophe III, Vers 1 und 3: weilen - heulen
Bei diesen Reimen handelt es sich um konsonantische Halbreime, auch unreine Reime genannt.
III.) Ausdeutung des Textes
Der Text handelt von einem einsamen Wanderer, der seine Heimat verlassen hat, und sich nirgends mehr zu Hause fühlen kann (=> fremd). Er erinnert sich an eine glückliche Zeit im Mai mit einem Mädchen, das sehr starke Gefühle für ihn hegte. Es war von Liebe und sogar von Heirat die Rede. Doch ehe es soweit kommen konnte, zog ihn das Fernweh weiter, und er verließ sie. Man bekommt fast den Eindruck, dass er diese Entscheidung angesichts der Kälte des Winters nun bereut.
In der zweiten Strophe bringt der Dichter zum Ausdruck, dass der Wanderer von einer unbestimmten Sehnsucht zu Wandern getrieben wird. Der Mond ist sein einziger Gefährte, mit dessen Hilfe er im Schnee die Spuren des Wildes, und somit einen geeigneten Weg finden kann.
Wieder schweifen seine Erinnerungen zurück zu dem Mädchen. Er versucht seine Entscheidung zu begründen und rechtfertigt sich vor sich selbst in dem er die Schuld der Liebe an sich zuschiebt: sie sei nichts beständiges und wandere von „Einem zu dem Andern“; fast willkürlich, wie es ihr gefällt. In Gedanken verabschiedet er sich von seiner Liebsten, um endgültig mit dem Thema abzuschließen.
Doch wie so oft siegt das Gefühl und die Erinnerung: er beschreibt, wie er sich heimlich davongemacht hat, ganz leise, aus Sorge, dass ihn jemand erwischt. Doch er konnte seine Liebste nicht verlassen, ohne ihr wenigstens einen kleinen Gruß zu hinterlassen: Er schrieb ans Tor „Gute Nacht“, damit sie sehen konnte, dass er an sie gedacht hat.
IV.) Umsetzung des Textes in der Komposition
Bei dieser Komposition handelt es sich um ein variiertes Strophenlied. Diese Kompositionsart lässt dem Komponist nur sehr wenig Spielraum, den Text auf seine ganz eigene Art und Weise auszudeuten. Trotzdem hat Schubert es geschafft, diesem Lied eine ganz besondere Note zu geben. Er hat die begrenzten Mittel, die ihm zur Verfügung stehen optimal genutzt, und zeigt uns so, wie er diesen Wanderer sieht.
Die formale Gliederung des Gedichts hält Schubert auch in seiner Vertonung ein:
- Nach jeder Strophe schiebt er ein Zwischenspiel ein.
- Jeder Vers beginnt mit einem Auftakt.
- Immer 2 Verse ergeben eine Einheit, die durch eine Viertelnote und eine Pause vom Folgenden getrennt ist.
- Das Metrum des Gedichts wird mit Hilfe von betonten und unbetonten Taktteilen eingehalten.
Im Text der Winterreise wird nicht eine bestimmte Handlung, sondern vielmehr eine Art „Befindlichkeit“, ein ganz bestimmtes Gefühl vermittelt. Schubert setzt dieses Gefühl in einer ganz besonders intensiven Art und Weise um: er führt die Bewegung der Musik nicht nur vorwärts, sondern gleichsam im Kreise.
Das erste Lied „Gute Nacht“ trägt zwar die Anmerkung „in gehender Bewegung“, doch wird die eigentliche Handlung nicht etwa vorwärtsgetrieben, sondern dreht sich um eine einzige Emotion, die über das ganz Stück hinweg beschrieben wird. Die Situation scheint ausweglos. Zu dieser Wirkung tragen mehrere Elemente bei: Die Nachspiele wiederholen die Vorspiele, als ob inzwischen nichts geschehen sei und also der Wanderer auch nicht vom Fleck gekommen sei. Die Wanderschaft hat kein konkretes Ziel. Die zweite Zeile des ersten Liedes: „fremd zieh ich wieder aus“, gibt keine Richtung vor. Sie ist kein Wort des Aufbruchs, ihre Aussage ist vielmehr von derselben Art wie das eröffnende „Fremd bin ich eingezogen“. Das Lied „Gute Nacht“ schließt im diminuendo, und das ist bei Schubert in der Regel: langsamer und leiser werdend. Das Lied schließt, als sollte alles stehen bleiben. Das Motiv, das die Schritte des Wanderers imitieren soll, ist nur sehr schwach angedeutet. Zwar ist das ganz Lied mit dieser Bewegung ununterbrochen unterlegt, doch erweckt sie nicht den Eindruck von Tatendrang oder Motivation. Sie entspricht eher einer Art Grundstimmung oder Grundbewegung, die sich über den ganzen Zyklus mehr oder weniger intensiv hinzieht.
Indessen sollten wir noch einmal über „Gute Nacht“ und seine Vorschrift „Mäßig, in gehender Bewegung“ nachdenken. Allerdings muss man dabei beachten, dass die Tempoangabe nur über dem Manuskript steht; für den Druck hat Schubert die nähere Bezeichnung im zweiten Teil der Angabe getilgt, wohl weil er befürchtete, sie werde gar zu wörtlich genommen.
Zu dieser Musik wirklich zu gehen, ist unmöglich. Die Achtel gehen dafür zu schnell, die Viertel zu langsam. Und doch ist die Wirkung beeindruckend: wir haben nicht irgendeinen Eindruck allgemeiner Art, sondern die Vorstellung des Gehens in der musikalischen Realität.
Man mag im Zusammenhang mit „Gute Nacht“ kaum von einem Klaviersatz reden; vielmehr handelt es sich um die Begleitung, die einfach fortläuft. Die Oberstimme und der Gesang setzen nachträglich mit derselben Melodie ein. Der Zeitpunkt des Einsatzes ist jedoch nicht klar definiert. Es scheint, als könne der Einsatz jederzeit erfolgen, ohne dem Ganzen einen Abbruch zu tun. Weil der Einsatz nicht fest an das vierte Achtel des jeweils ersten Taktes gebunden ist, kann der Sänger durchaus auch später einsetzen – und jeder Pianist wird selbstverständlich so lange die Achtel des ersten Taktes fortsetzen, bis der Einsatz kommt. Das heißt, es passiert nichts anderes, als dass die Achtel weiterlaufen. Die Wirkung ist die eines Abwartens. Es ist für jeden Zuhörer spürbar, dass die Klavierbegleitung unbedingt der Ergänzung einer Singstimme bedarf.
Entsprechend ist der Schluss gebildet: Das Nachspiel ohne die Oberstimme verstärkt die Wirkung eines Nachhalls und die fortgehenden Achtel der immer tiefen sinkenden Stimme des Sängers.
Vokal- und Instrumentalpart laufen während das ganzen Lieder mehr nebeneinander her als wirklich miteinander, und man mag sich fragen, ob sie wirklich einen Satz bilden. Doch der Schein trügt: man muss festhalten, dass Instrumental- und Vokalpart zusammenwirken, wenn auch auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise.
Die Ausdeutung des Textes innerhalb der Melodie:
Strophe I:
Die Verse 1 und 2 ergeben eine Einheit, die Schubert durch eine tendenziell abwärts gerichtete Bewegung untermalt. Er beginnt dabei auf dem f`` und endet auf d`. Die Verse 3 und 4 bilden die nächste Einheit. Erstaunlicherweise verwendet Schubert für diesen Textteil dieselbe Tonfolge wie zuvor. Währen der erste Abschnitt keinerlei konkrete Aussage macht, beschreibt der 2. Teil eine Erinnerung an frühere Zeiten.
Die Verse 5 und 6, also die dritte Einheit werden wiederholt. Die vier Achtel im ersten Takt drücken eine Art Ungeduld oder Unzufriedenheit aus. Das Verweilen auf demselben Ton treibt die Handlung nicht weiter voran. Dasselbe geschah zwischen dem Wanderer und dem Mädchen: es wurde zwar von Liebe und Heirat gesprochen, doch wurde dies niemals in die Tat umgesetzt.
Die Wiederholung dieser Verse geschieht durch eine Sequenz: der Beginn der Tonfolge wurde um eine Quarte nach oben verschoben, was auf die Wichtigkeit dieser Textzeilen hindeutet. Es wäre für den Wanderer ein entscheidender Einschnitt in seinem Leben gewesen, wenn er dieses Mädchen geheiratet hätte: dadurch wären ihm die Strapazen einen winterlichen Reise erspart geblieben.
Die letzten 2 Verse der 1. Strophe sind in der Komposition ganz klar von den anderen getrennt: durch ein 2-taktiges Zwischenspiel. Auch diese Verse werden fast notengetreu wiederholt. Der Schluss ist zugunsten der Kadenz ein wenig verändert, was jedoch der Wirkung keinen Abbruch tut. Der Text wird mithilfe von Moll-Dreiklängen und kleinen Sekunden untermalt. Dies zeigt die Traurigkeit des Wanderers angesichts seiner verpassten Chance und des kalten Winters.
Nachdem der letzte Ton der Strophe verklungen ist, setzt ein Zwischenspiel ein, das notengetreu das Vorspiel des Stückes ist. Man könnte also den Eindruck bekommen, dass das Lied von vorne beginnt, nur eben mit einem anderen Text. Es findet keine Verbindung zwischen den Strophen statt.
Strophe II:
Die zweite Strophe ist die notengetreue Wiederholung der ersten Strophe. Sie werden sogar durch Wiederholungszeichen gleichgesetzt.
Dies wird möglich, da die Stimmung der ersten Strophe sich in die zweite Strophe hinüberträgt. Zwar handelt der Text jetzt nicht mehr von dem Leid, das durch den Verlust des Mädchens ausgelöst wurde, doch von den Strapazen und Qualen der Wanderung an sich. Der Wanderer wird von unbändigem Fernweh getrieben, gegen das er sich nicht zur Wehr setzen kann. Trotzdem ihm dies schon viele glückliche Situationen kaputtgemacht hat, kann er sich nicht länger an einem Ort aufhalten. Er ist sehr unzufrieden mit dieser Situation, immer allein zu sein, mit dem „Mondenschatten“ als einzigem Begleiter.
Zwischen den Strophen II und III erklingt wieder das Zwischenspiel, das gleichzeitig auch das Vorspiel des Stückes war.
Strophe III:
Die 3. Strophe bekommt eine neue Melodie, die aber sehr deutlich an die der ersten zwei Strophen angelehnt ist. Der erste Takt ist notengetreu gleich, doch dann wird die dauernde Abwärtsbewegung unterbrochen und gegen einen aufwärtsgerichteten Dreiklang ausgetauscht. Die zweite Einheit ist wiederum die genaue Wiederholung der ersten. Schubert bleibt seiner Linie also treu, und verändert nur Kleinigkeiten.
Der zweite Teil der Strophe, also die Verse 5 und 6 entsprechen notengetreu ihrem Pendant in Strophe I und II. Dann allerdings geschieht etwas Unerwartetes: statt wie gehabt diese 2 Verse zu wiederholen, nimmt Schubert zwei andere Verse, nämlich die Verse 7 und 6. Die Noten bleiben allerdings dieselben.
Es folgen die obligatorischen 2 Takte Zwischenspiel, die die letzten Verse vom Rest der Strophe trennen, doch auch danach stellt Schubert die Reihenfolge um. Anstatt der nun eigentlich folgenden Verse 7 und 8 setzt Schubert die Verse 5 und 8, die in der Wiederholung durch die Kombination von 7 und 8 ausgetauscht werden.
Durch diese auf den ersten Blick willkürliche Vertauschung der Verse macht Schubert die Willkür Gottes und der Liebe deutlich. Trotzdem es gewisse Regeln gibt, setzen sich beide regelmäßig darüber hinweg. Und genau die macht sie so unberechenbar.
Nach Beendigung der Strophe folgt wiederum das 5-taktige Vor- und Zwischenspiel.
Strophe IV:
Die vierte Strophe bekommt von Schubert eine neue Tonart: D-Dur. Der Wechsel ist ganz deutlich gemacht: Zwischenspiel, Doppelstrich, neue Vorzeichen. Die Grundzüge der Komposition bleiben die gleichen. Schubert verwendet wiederum eine nach unten gerichtete Bewegung (Verse 1 und 2) und die notengetreue Wiederholung für die Verse 3 und 4. Die Verse 5 und 6 enthalten ebenfalls die gleiche kompositorischen Mittel wie in den Strophen I und II, und auch die Sequenzierung findet statt, allerdings nicht um eine Quarte, sondern um eine Quinte. Auch die Textverteilung wird verändert. Statt der sofortigen Wiederholung der Verse 5 und 6 erfolgt erst die Vorstellung der Verse 7 und 8. Nach 2 Takten Zwischenspiel werden dann die letzten vier Verse der Strophe wiederholt, allerdings mit anderem Tonmaterial.
Zum Abschluss des Liedes kehrt Schubert in die Ausgangstonart d-moll zurück. Dazu benutzt er den Vers 8 der vierten Strophe.
Als Nachspiel erklingt nicht, wie vielleicht zu vermuten wäre, wiederum das Vorspiel. Vielmehr lässt Schubert die gehenden Achtel der Klavierstimme ausklingen. Das Ende ist mit pianissimo und diminuendo gekennzeichnet, d.h. das Ende ist nicht klar gekennzeichnet. Die Wirkung ist folgende: der Wanderer entfernt sich, und seine Schritte werden immer leiser.
V.) Besonderheiten innerhalb des Liedes
Besonders auffällig ist, dass die 2. Strophe notengetreu die Wiederholung der 1. Strophe ist.
Eine Besonderheit ist auch der auftaktige Beginn des Liedes. Solche Auftaktigkeit ist bei Schubert viel seltener, als man gemeinhin vermutet: von den 24 Liedern der Winterreise beginnen nur 8 auftaktig. Diese Tatsache verdient allein deshalb Beachtung.
Auffällig für den Zuhörer ist dieser Auftakt allemal. Dem Auftakt der Oberstimme der rechten Klavierhand zu Takt 2 gehen drei Achtel der Unter- und Mittelstimme voraus. Ehe die Oberstimme des Klaviers und die Singstimme einsetzen, hat bereits die Begleitung der scheinbar unendlich fortgehenden Achtel begonnen. Es geht bereits etwas während der Sänger mit seinem Text beginnt: „Fremd bin ich eingezogen...“
VI.) Tonartverlauf
Die Tonart des Liedes dient natürlich dazu, den Text zu verstärken.
Die ersten 3 Strophen stehen in d-moll mit einigen Ausweichungen nach F-Dur.
In Zusammenhang mit dem Text macht uns Schubert klar, dass wir uns in der rauhen Realität eines kalten Winters befinden. Die Moll-Tonart zeigt das ein wenig unheimliche, die dauernde Dämmerung, die einen im Winter nie verlässt.
Die 4. Strophe allerdings steht in D-Dur. Der Tonartwechsel ist ganz explizit gekennzeichnet: durch ein langes Zwischenspiel von 5 Takten, einen Doppelstrich und neue Vorzeichen.
Schubert macht damit seine Absicht ganz deutlich. In der letzten Strophe flüchtet sich der Wanderer in eine Traumwelt (Signalwort: Traum) und verlässt somit das unschöne Jetzt und Hier. Die Tonart D-Dur steht für die schönen Erinnerungen und die sommerliche Wärme, denen der Wanderer insgeheim nachtrauert.
Die letzte Phrase des Liedes führt ihn allerdings wieder zurück nach d-moll. Die Erinnerungen sind verblasst, und der Wanderer findet sich zurück in der Realität.
VII.) Gliederung des Liedes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
VIII.)Verwendete Literatur
1.) Arnold Feil: Franz Schubert, Die schöne Müllerin, Winterreise
Philipp Reclam jun. Stuttgart 1975
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit von Nadine Heller „Gute Nacht!“ aus „Winterreise“
Was ist der Inhalt des Liedes „Gute Nacht!“ aus der „Winterreise“?
Das Lied handelt von einem einsamen Wanderer, der seine Heimat verlassen hat und sich nirgends mehr zu Hause fühlt. Er erinnert sich an eine glückliche Zeit mit einem Mädchen, das ihn liebte, aber er verließ sie und bereut diese Entscheidung angesichts der Kälte des Winters. Er wird von einer unbestimmten Sehnsucht zu wandern getrieben und verabschiedet sich in Gedanken von seiner Liebsten.
Wie ist das Gedicht aufgebaut und welche Reimform wird verwendet?
Das Gedicht besteht aus vier Strophen mit jeweils acht Versen. Das Metrum ist der Trochäus, wobei die Kadenzen abwechselnd männlich und weiblich sind. Die Reimform ist ein Kreuzreim (abab).
Welche Reimarten kommen im Gedicht vor?
Der Großteil der Reime sind reine Reime. Es gibt aber auch wenige unreine Reime (konsonantische Halbreime), wie z.B. "Liebe – trübe" oder "weilen - heulen".
Wie wird der Text in der Komposition umgesetzt?
Schubert verwendet ein variiertes Strophenlied. Er hält sich an die formale Gliederung des Gedichts, indem er nach jeder Strophe ein Zwischenspiel einfügt und jeder Vers mit einem Auftakt beginnt. Schubert setzt die Emotionen des Textes intensiv um, wobei die Musik nicht nur vorwärts, sondern gleichsam im Kreise verläuft.
Welche Rolle spielt die Klavierbegleitung im Lied?
Die Klavierbegleitung läuft einfach fort und begleitet den Gesang. Die Oberstimme und der Gesang setzen nachträglich mit derselben Melodie ein. Es scheint, als könne der Einsatz jederzeit erfolgen, ohne dem Ganzen einen Abbruch zu tun. Die Klavierbegleitung erweckt den Eindruck eines Abwartens.
Wie interpretiert Schubert den Text in der Melodie der ersten Strophe?
Schubert untermalt die abwärts gerichtete Bewegung in den ersten beiden Versen. Die Verse 3 und 4 verwenden dieselbe Tonfolge wie zuvor, beschreiben aber eine Erinnerung an frühere Zeiten. Die Verse 5 und 6 werden wiederholt und drücken eine Art Ungeduld oder Unzufriedenheit aus. Die letzten zwei Verse sind durch ein Zwischenspiel getrennt und die Traurigkeit des Wanderers wird mithilfe von Moll-Dreiklängen und kleinen Sekunden untermalt.
Was passiert in der zweiten Strophe musikalisch?
Die zweite Strophe ist die notengetreue Wiederholung der ersten Strophe.
Wie unterscheidet sich die dritte Strophe in der Melodie von den ersten beiden?
Die dritte Strophe bekommt eine neue Melodie, die aber deutlich an die der ersten beiden Strophen angelehnt ist. Schubert verändert die Reihenfolge der Verse, um die Willkür Gottes und der Liebe deutlich zu machen.
Wie wird die vierte Strophe musikalisch umgesetzt und welche Tonart wird verwendet?
Die vierte Strophe steht in D-Dur und symbolisiert eine Traumwelt, in die sich der Wanderer flüchtet. Die Grundzüge der Komposition bleiben die gleichen, aber es gibt Veränderungen in der Textverteilung. Zum Abschluss kehrt Schubert in die Ausgangstonart d-moll zurück.
Welche Besonderheiten gibt es im Lied?
Besonders auffällig ist, dass die 2. Strophe notengetreu die Wiederholung der 1. Strophe ist, sowie der auftaktige Beginn des Liedes.
Wie verläuft die Tonart im Lied und welche Bedeutung hat sie?
Die ersten drei Strophen stehen in d-moll, was die rauhe Realität eines kalten Winters verdeutlicht. Die 4. Strophe steht in D-Dur und repräsentiert eine Traumwelt. Die letzte Phrase führt wieder zurück nach d-moll.
Welche Literatur wurde für die Analyse des Liedes verwendet?
Verwendete Literatur sind: Arnold Feil: Franz Schubert, Die schöne Müllerin, Winterreise (Philipp Reclam jun. Stuttgart 1975) und Joachim Kupsch: Winterreise: Ein Schubert-Roman (Henschelverlag Berlin 1989).
- Quote paper
- Nadine Heller (Author), 2002, Franz Schubert - Winterreise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107863