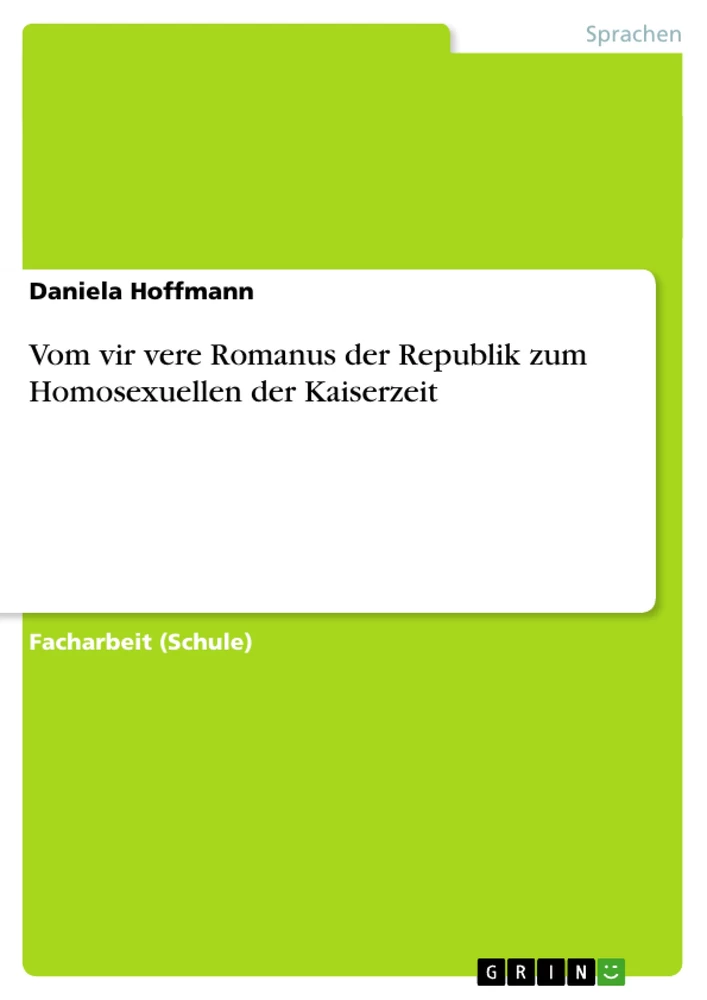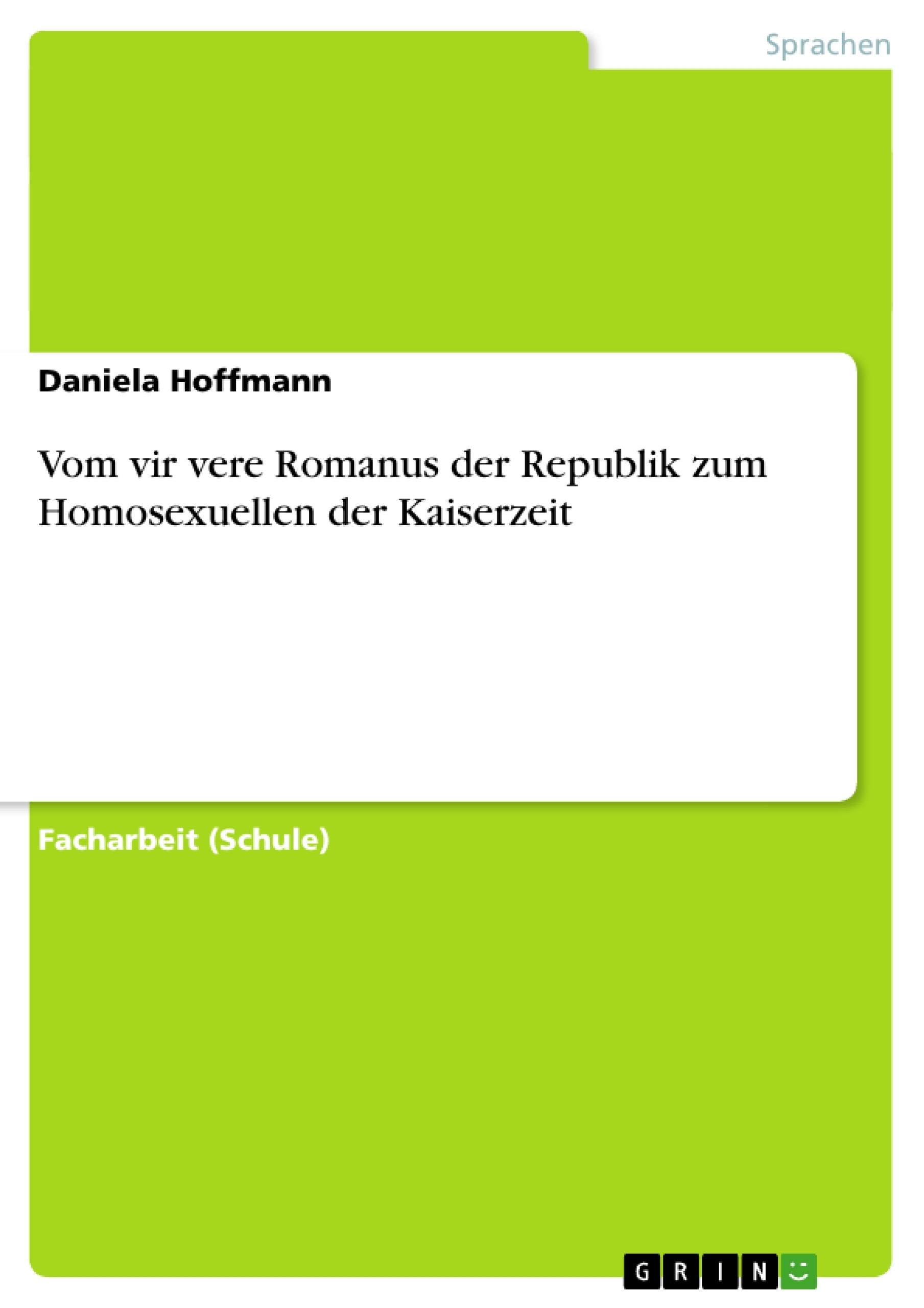Was verbirgt sich wirklich hinter den Marmorstatuen und heroischen Epen des antiken Rom? Diese fesselnde Untersuchung enthüllt eine überraschende Facette der römischen Gesellschaft: die allgegenwärtige und doch oft missverstandene Welt der Homosexualität. Von den Mythen um Ganymed und Achill bis zu den Kaisern Tiberius und Nero, die für ihre ausschweifenden Orgien berüchtigt waren, entfaltet sich ein komplexes Bild, das weit über gängige Klischees hinausgeht. Tauchen Sie ein in die Ideale des "vir vere Romanus", des wahren römischen Mannes, und entdecken Sie, wie Tugend, Schönheit und Macht mit gleichgeschlechtlicher Begierde in Konflikt gerieten. Erkunden Sie die Feinheiten der Knabenliebe, die Päderastie, und deren subtile Unterschiede zur modernen Vorstellung von Homosexualität, analysiert anhand der Werke von Catull, Ovid und Martial. Entdecken Sie die Bedeutung von Körperpflege, Mundhygiene und dem Ideal des perfekten Jünglings, während wir die Rolle von Aktivität und Passivität im sexuellen Akt sowie die damit verbundenen sozialen Konsequenzen beleuchten. War die Fellatio wirklich eine Schande? Welche Rolle spielten Sklaven in homosexuellen Beziehungen? Und wie wurden Frauen in dieser von Männern dominierten Welt wahrgenommen? Diese tiefgründige Analyse der antiken Sexualmoral, gestützt auf Primärquellen und aktuelle Forschung, bietet neue Einblicke in das Leben, die Liebe und die Lust im alten Rom, ein Muss für alle, die sich für Geschichte, Kultur und die menschliche Natur interessieren. Entdecken Sie die faszinierenden Details einer Epoche, in der die Grenzen zwischen Konvention und Kontingenz verschwammen und die Definition von Liebe und Begehren neu geschrieben wurde, beleuchtet durch die Schriften von Dichtern und Historikern, die uns ein Fenster in eine längst vergangene Welt öffnen, in der die Suche nach Glück und Befriedigung oft auf unerwarteten Pfaden verlief. Lassen Sie sich entführen in eine Welt, in der Macht, Schönheit und Verlangen eine explosive Mischung eingingen und die Grundfesten der römischen Gesellschaft erschütterten.
Inhaltsverzeichnis
1. Homosexualität in der Mythologie 3
2. Vir vere Romanus
2.1. Tugendkatalog
2.2. Schönheitsideal
2.2.1. Catull
2.2.2. Ovid
2.2.3. Martial
3. Knabenliebe
3.1. Grundzüge
3.2. Unterschied der dorischen zur klassischen Knabenliebe
3.3. Knabenliebe in der Literatur
4. Homosexualität in der Kaiserzeit
4.1. Erklärungen zu „Homosexualität in der Antike“
4.2. Das Motiv des unreinen Mundes
4.2.1. Martial
4.2.2. Catull
4.2.3. Petron
4.3. Homosexualität bei den Bürgern 16
4.4. Homosexualität bei den Kaisern
4.4.1. Tiberius
4.4.2. Caligula
4.4.3. Nero
4.4.4. Galba und Vitellius
5. Schlussbemerkung
6. Sexualität der Frau
7. Literaturverzeichnis
8. Bilderklärungen und –nachweise
„Und Tros zeugte drei edle Söhne, Ilos und Assarakos und den göttergleichen Ganymed, der der Schönste aller Sterblichen war; ihn raubten die Götter, damit er wegen seiner Schönheit dem Zeus als Mundschenk diene(...).“ (Homer 1)
Homosexualität in der Mythologie
Schon in der griechischen Mythologie ist Homosexualität kein seltenes Thema. Wie u.a. bei Homer geschrieben, wurde der hübsche Sohn des Tros von Illion- dem Gründer von Troja- und der Kalirrhoe auf den Olymp entführt, um dort dem höchsten aller Götter- Zeus- zu dienen und dessen Liebhaber zu werden. Ebenso soll Achill mit dem um Jahre älteren Patrokolos nicht nur befreundet, sondern auch dessen Geliebter gewesen sein.2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Scheinbar wurde also gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern toleriert und keinesfalls verachtet.
Im Folgenden wird nun der Verlauf von der Zeit der Republik bis zur Kaiserzeit beschrieben, indem zuerst von den Tugenden eines vir vere Romanus3 - eines wahren römischen Staatsmannes- und den Schönheitsidealen4 berichtet wird. Dann übergehend zum Spezialfall der Homosexualität, der Päderastie5, und schließlich bei der eigentlichen Homosexualität in der Kaiserzeit6 endend.
Hier wird der vir vere Romanus beschränkt durch dessen Tugendkatalog und Schönheitsideal dargestellt. Beim Thema Knabenliebe wird näher darauf eingegangen, dass man Päderastie nicht mit Homosexualität gleichstellen kann und es wird die Beziehung des Geliebten (= griechisch: Erastes) zu seinem Knaben (= griechisch: Eromenos) näher beschrieben, um anschließend auf die eigentliche Homosexualität zurückzukommen.
Zuerst wird der Begriff „Homosexualität“ genauer definiert, schließlich wird auf die Auslebung derer bei den Bürgern und Kaisern eingegangen.
Vir vere Romanus
-Tugendkatalog-
Die Begriffe „virtus“ (=Tugend; von „vir“, der Mann; „virtus“ ist somit als „Mannhaftigkeit“ zu übersetzen) und „mos“ (Sitte) sind untrennbar mit den Römern der Republik in der Antike verbunden. Diese achteten auf eine sittsame Lebensweise, auf die nun genauer eingegangen wird.
Cicero schreibt in seinem Werk „De re publica“7, „dass eine so große Notwendigkeit der Tugend dem menschlichen Geschlecht von der Natur (…) gegeben ist.“ Doch diese Tugenden sollen auch benützt werden, um so dem Gemeinwohl zu dienen.
Für Caesar8 speziell ist die Tapferkeit etwas unabdingliches, um den Feind besiegen zu können. Doch nicht nur kriegerische Tüchtigkeit solle zum Sieg führen. Dumnorix z.B. habe „bei den Sequanern auf Grund seiner Beliebtheit und Freigiebigkeit den größten politischen Einfluss“ (S.17). Auch solle man durch Streben nach Ruhm sich Verdienste um das Volk erwerben, wobei man dabei klug, zuverlässig und gerecht handeln solle, um ein ehrenvolles Ansehen bewahren bzw. erhalten zu können.
Somit seien nun die vier Kardinaltugenden Tapferkeit, Selbstbeherrschung, Gerechtigkeit und Klugheit genannt.9
Verbunden mit diesen ist des weiteren die Treue („fides“) bzw. Wahrhaftigkeit, welche die Grundlage für Beständigkeit und Gerechtigkeit bildet. Ebenfalls als ungeschriebenes Gesetz gilt die „pietas“, die zum pflichtgemäßen Verhalten gegenüber der Umwelt aber auch den Göttern aufruft.
Besonders wichtig für dieses Gesamtthema ist die „modestia“ zu nennen, die von einer maßvollen Haltung mit einem anspruchslosen, bescheidenem sittlichen Benehmen spricht. Dabei ist es sittsam, sich gesetzlichen Schranken zu fügen, seine Leidenschaften und Begierden zu zügeln und ein zivilisiertes Leben zu führen.10
Zu der gelehrten und moralisierenden Generation gehörten nicht nur Cicero und Caesar an, auch Livius, Plutarch und v.a. Tacitus schrieben über eine Welt im goldenem Zeitalter der Republik, bei der die bürgerliche und militärische Tugend siegt.11
-Schönheitsideal-
Im römischen Leben spielte nicht nur die virtus eine bedeutende Rolle, auch dem Thema „Schönheit“ spendete man große Aufmerksamkeit.
Die auffälligsten Eigenschaften, die bei erwachsenen Männern bewundert wurden, waren „breite Schultern, ein mächtiger Brustkorb, starke Brustmuskeln, starke Muskelstränge oberhalb der Hüfte, eine schlanke Taille, ausgeprägte Gesäßbacken und kräftige Oberschenkel und Waden.“12
Ein großes Augenmerk setzten die Griechen auf die Oberschenkel, welche für sie als besonders stimulierend gewirkt haben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der Malerei ließman Menschen, die als schön gelten sollten, mit einer Stirn von gemäßigter Höhe, einer geraden Nase, einer vollen, aber nicht breiten Unterlippe, einem ausgeprägten gerundeten Kinn und gebieterischen Augen darstellen. Gelockte Haare galten dabei attraktiver als glatte. Der Penis sollte dünn und kurz sein, in einer zugespitzten Vorhaut endend. Der „hässliche“ Penis hingegen war übernatürlich lang und dick.
Das Schönheitsideal, welches gleichsam auf die Knabenliebe übergreift, lässt sich u.a. bei Catull13, Ovid14 und Martial15 herauslesen, die sich teilweise ausgiebig dem perfekten Aussehen eines jungen Mannes bzw. der Körperpflege an sich widmeten.
-Catull-
In seinem 69. Gedicht befasst sich Catull mit jemandem, dessen Geruch unerträglich für die Mitmenschen ist: „Bring entweder um die grausame Pest für Nasen oder staune nicht mehr, dass man dich allgemein flieht.“ Für ihn ist guter Körpergeruch somit ausschlaggebend für ein Beisammensein.
Der Mundhygiene widmet er sich in Gedicht 97. Es ist nicht nur wichtig, Zähne zu haben, sondern diese auch zu pflegen, damit es „ein Unterschied ist- bei den Göttern! Ob man Aemilius’ Maul oder Hintern beriecht.“
-Ovid-
Ovid widmet sich ab Vers 505 bis einschließlich Vers 523 ebenfalls dem Thema Schönheit. Er appelliert an die Männer, sich sportlich zu betätigen, um somit gleichzeitig eine attraktive Bräune zu gewinnen. (Vers 513: „(…) die Leiber mögen durch Sport auf dem Marsfelde gebräunt werden (…)“) Dabei ist saubere Kleidung und perfektes Schuhwerk unabdinglich. (Vers 513ff: „(…) gut passend und fleckenlos soll die Toga sein. Die Schuhlaschen sollen nicht aufgeraut sein (…) und der Fußschlappe nicht locker hin und her in zu weiter Tierhaut.“)
Die gepflegte Erscheinung wird ergänzt durch eine professionelle Haarfrisur, ebenso durch einen gestutzten Bart.
Des weiteren sollen Nägel „nicht zu weit hervorstehen und dürfen nicht schmutzig sein, und in den Nasenlöchern darf kein Haar stehen.“ (Vers 519f)
Wie schon Catull erinnert Ovid die Menschen daran, Mundhygiene zu betreiben und somit niemanden durch unangenehmen Geruch zu belästigen.
-Martial-
Martial berichtet zumeist von einem perfekten Aussehen eines Jünglings.
In 4,42 listet er Punkte auf, die für ein „Knabenideal“ stehen. „Er sei zunächst im Lande des Nil geboren (…) auch weißer noch als Schnee (…). Der Augen Glanz soll Sternen gleichen und sanftes Haar umwalle seinen Hals: Doch Zöpfe lieb ich (…) nicht. Die Stirn sei niedrig und die Nase zeige maßvoll Schwung, die Lippen röten sich (…).“
Im achten Epigramm des elften Buches widmet sich Martial ebenfalls der Wichtigkeit eines wohlriechenden Körpergeruchs. Er vergleicht „den matte(n) Balsamduft des Knaben“ z.B. mit „Früchte(n), die im Winter in der Kiste reifen“ oder mit dem „Gartenland Siziliens, das die Bienen lockt“, so sollten der Knabe bzw. die „Küsse (des) Knabens in der Früh“ duften.
Knabenliebe
-Grundzüge-
Von der Beschreibung eines schönen Knaben wird nun zum Thema Päderastie übergegangen (Päderastie= griechisch: „Kind“ und „verlangen“, „lieben“).
In der heutigen Zeit ist es in der Gesellschaft tabu, dass sich Männer Jungen als Geliebte zuziehen. Doch in der Antike herrschte darüber eine andere Meinung, auf die genau eingegangen werden wird.
Zumindest seit der späten Republik (ab etwa 250v. Chr.) wurde Sexualität viel unverkrampfter ausgelebt, als etwas Natürliches und Selbstverständliches gesehen und war somit allgegenwärtig. Jeder freie Mann konnte sich für Frauen oder Knaben entscheiden und es war normal, dabei sogar den Jüngling statt der eigenen Frau zu bevorzugen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Päderastie wurde als eine Art Lernprozess zwischen Lehrer und Schüler gehalten, half dem Knaben bei der Einführung in seine zukünftige Rolle als erwachsener Mann in die gesellschaftliche Gruppe, war kulturell verankert und somit- speziell in der Oberschicht als Statussymbol geltend- hoch angesehen. Sklaven und Metöken hatten sich von Knaben fernzuhalten, da sie keine freien Bürger und somit von jeder politischen Betätigung ausgeschlossen waren.
Die Knabenliebe entsprang nicht einer perversen sexuellen Neigung, sondern es galt sich nicht nur körperlich, sondern auch geistig zu verlieben. Den Geliebten reizte also nicht das junge männliche Geschlecht; es galt, den Knaben zu erziehen und (seine als weiblich angesehenen) Charaktereigenschaften wie Hilfsbedürftigkeit, Zurückhaltung und Schüchternheit zu verehren. Diese Liebe war eine tiefempfundene, leidenschaftliche Freundschaft; dadurch konnte man den eros erfahren, einen Seelenaufschwung der Begeisterung, erzeugt durch die sinnliche Schönheit des Körpers und der Seele.16
Fand sich aber keine pädagogische Funktion in der Beziehung, so galt diese als unehrenhaft und der erastes wurde des sexuellen Missbrauchs beschuldigt.17 Denn war der erastes mehr am Körper als an der Seele des eromenos interessiert, wird er in der Zukunft wohl sein Versprechen immerwährender Liebe und Dankbarkeit brechen, wenn sein Knabe dem Jünglingsalter entwachsen ist. War der erastes aber ernsthaft an dem ehrenhaften Charakter des Jünglings interessiert, so hielt diese Freundschaft bis zum Tod, da (nach Pausanias) der „Charakter nicht wie jugendliche Schönheit vergehe“.18
Die Schönheit des Knaben war dabei ein wichtiger Aspekt, weshalb ihn der erastes umwarb.
In den Gymnasien widmete man sich dem Sport, um seinen Körper und damit dessen Schönheit zu vervollkommnen, gern zeigte man durch Leibesübungen durchtrainierte Körper; als etwas Selbstverständliches galt es, Übungen nackt auszuführen und ebenso Wettkämpfe unbekleidet zu bestreiten.19 Die Männer konnten nun „ihre“ Knaben in Ruhe mustern, die Gelegenheiten für Kontakte, Austauschen von Blicken, Worten oder sogar Berührungen nutzen und sich verlieben. Herausragende Athleten mit sonnengebräunter Haut und gut entwickelter Muskulatur waren dabei besonders begehrt. Weitere Schönheitsmerkmale waren lange Jugendlocken und fehlende Körperbehaarung auf Gesicht und Brust. Das Gesetz forderte sogar einen männlichen Bürger geradezu auf, einem schönen Knaben nachzugehen.20
Häufig wird auch auf Vaseninschriften oder durch Graffiti die Schönheit einer anonymen Person oder eines beim Namen genannten Knaben angepriesen.
Doch die soziale Bedeutung der Knabenliebe zeigt sich erst in der Entstehung von Regeln und Tabus, die mit der Zeit aufgestellt wurden.
Die Hauptmerkmale eines päderastischen Verhältnisses werden nun im Folgenden genannt.
Der Knabe hatte im Alter zwischen 12 und 18 Jahren zu sein, wobei seine „Blütezeit“ im Alter von 16-17 Jahren war.
Die Beziehung war nur unter männlichen Wesen möglich, es gab also keine Liebe eines älteren Mannes mit einem jungen Mädchen.
Ebenso hatte der erastes zumeist gleichzeitig eine heterosexuelle Beziehung, gewöhnlich in einer Ehe bestehend.
Mit dem ersten Bartwuchs war der Knabe zu alt für eine passive Rolle innerhalb einer sexuellen Beziehung, konnte ab sofort selbst als erastes handeln und sexuelles Engagement zeigen.
Der Hauptaspekt in einem päderastischen Verhältnis war aber der „der Pflege der am Jugendlichen hervortretenden körperlichen und seelisch- geistigen Vorzüge (…)“.21 Sex spielte dabei eher eine Nebenrolle und galt als eine Art Zugabe, wobei mit Sex nicht der uns bei einem homosexuellen Verhältnis bekannte gemeint ist.
In der Knabenliebe wurde der so genannte „Schenkelverkehr“ praktiziert. Dieser galt als würdig im Liebesverhältnis und war- im Gegensatz zum Analkoitus- legitim, wobei der Knabe den Verkehr nicht als lustvoll zu empfinden hatte und der erastes sich sexuell beherrschen sollte.
Häufig wird auf Vasen die „oben-und-unten-Stellung“ dargestellt. Dabei berührt der erastes mit der einen Hand das Gesicht seines Knaben, mit der anderen greift er an dessen Genitalien.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ehe es aber überhaupt zu einer erastes-eromenos-Beziehung kam, musste man die aufwendige Liebeswerbung überwinden und gleichzeitig ausreichend materielle Mittel zur Verfügung haben, denn die Konkurrenz schlief nicht. Man überbot sich gegenseitig mit teuren und ideellen Gaben, um so den Knaben für sich zu gewinnen.
Das Darbringen von Geschenken war ein öffentlicher Vorgang, welcher nicht nur für den Jüngling, sondern auch für dessen Vater als ehrenvoll galt. Präsente ideellen Wertes waren Kränze und Zweige, die symbolisierten, dass diese Beziehung zur angenehmen Seite des Lebens gehört. Der Eintritt in eine solche Bindung wurde assoziiert mit einem Festakt, bei dem beide Seiten glücklich waren, diesen Schritt gewagt zu haben.
Sehr häufig wurden die Knaben mit Tieren beschenkt, welche einerseits als Symbole männlicher Tugenden, andererseits auch zur sportlichen Unterhaltung dienen sollten.
Der Hase z.B. stand für die Hetzjagd an sich; der Knabe sollte so spielerisch das Jagen lernen. Der Hahn als Macht- und Herrschaftssymbol bedeutete zum einen Kampf, zum anderen männliche Potenz. Weitere übliche Präsente waren Fuchs, Hirsch, Pferd, Hund und Vogel (wie Wachtel, Blässhuhn, Gans). Die Haupterziehungsinhalte der Werbegeschenke waren also Jagd und Kampf.
Nahm der eromenos ein solches Geschenk an, so galt dies zugleich als Einwilligung in die Beziehung und verpflichtete zu Gegenleistungen des eromenos zum erastes.22
-Unterschied der dorischen zur klassischen Knabenliebe-
Doch auch in der Knabenliebe gibt es, durch zeitliche und geographische Aspekte betrachtet, verschiedene Traditionen. Man unterscheidet zwischen der älteren (dorischen) und jüngeren (klassischen) Phase.
Die Männer neigten dazu, sich von den Frauen abgrenzend in Gruppen zusammenzuschließen, besonders zu militärischen Zwecken. Die dorische Knabenliebe soll sich somit im Lagerleben entwickelt haben. Da das weibliche Geschlecht weit weg zu Hause war, griff man „in der Not“ auf die jüngeren Gefährten zurück. Der erastes war daher als Soldat dem eromenos ein Vorbild für kriegerische Tüchtigkeit, der Aspekt der Schönheitsverehrung war hier noch nicht vorhanden; man hatte den Gedanken, den Knaben in seiner Reifungsperiode durch den sexuellen Umgang mit einem erwachsenen Mann zu stärken, ihm u.a. Körperkraft, Wehrkraft, Widerstandsfähigkeit, Gesundheit und Zeugungskraft zuzuführen. Falls ein Knabe diesen Prozess nicht durchlief, so galt er als nicht heiratsfähig und nicht vollwertiges Mitglied der Gruppe.
Der erastes sollte hier noch als „Betreuer“, nicht „Liebhaber“ sein; eine Sexualbetätigung ruhte nicht auf dem Antrieb der Zuneigung, sondern war eine gesellschaftliche Pflicht.
Der Knabe bewunderte seinen erastes und erwiderte Dankbarkeit für dessen Liebe; dieses Verhältnis könnte man mit einer Adoption vergleichen, die allerdings nur für einen kurzen Zeitraum besteht.
Speziell in Kreta begann die Beziehung mit einem rituellen Scheinraub. Der Knabe und der erwachsene Mann verbrachten dann zwei Monate an einem einsamen Ort, um gemeinsam zu jagen. Auf Kreta nannte man den älteren Mann nicht „erastes“ sondern „philetor“, „ein tätige Zuneigung bekundender“. Am Ende der „Entführung“ wurde der Knabe mit einer Waffenausrüstung beschenkt. Der philetor selbst erhielt meist vom Vater des Jünglings Geschenke als Entgelt für seine Leistung als Kraftspender. War die Familie des Knaben aber von Anfang an der Meinung, dass der philetor nicht gut genug sei, so verhinderten sie, dass der Sohn in ein Versteck gebracht werden konnte. Oftmals gelang es dem philetor aber, die Verwandten seines Auserwählten durch Geschenke, wie z.B. Kleidung, umzustimmen.
Durch diese Initiation entstand zwar eine perfekte Kampfmaschine für das Militär, doch ein vertrautes Verhältnis zwischen Vater und Sohn konnte schwer oder gar nicht aufgebaut werden.
Bei dem klassischen Typus der Knabenliebe hingegen war nicht das Militär ausschlaggebend. Sie wurde durch den Polisadel eingeführt und konzentrierte sich mehr auf die Schönheit denn auf den Charakter des Knaben.23
-Knabenliebe in der Literatur-
Die Literatur zeugt ebenfalls davon, dass Päderastie sehr gängig war.
In seinem Epigramm 3,71 verspottet Martial24 einen erastes, da dieser seinen Knaben sexuell aktiv handeln lässt: „Den Knaben schmerzt das Glied, dich, Naevolus, der Steiß.“ Somit sei für ihn alles klar, dass hier gegen ein Tabu, das der Aktivität eines eromenos, verstoßen wurde.
In 3,82 beschreibt Martial ein Präsent, das der Geliebte seinen Jünglingen schenkt: „und Taubenkeulen schenkt er seinen Lustknaben“.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Epigramm Nummer sieben im vierten Buch lässt einen erastes verzweifelt aussehen: Sein Knabe würde ihn zum Narren halten, da dieser ihm weismachen wolle, ihm sei über Nacht ein Bart gewachsen, welcher nun eine Fortführung der Beziehung verhindere. Für den Erwachsenen klingt dies alles unglaublich: „O Hyllus, du, noch gestern Knabe, sprich: Aus welchem Grund bist heute du ein Mann?“
Auch Catull befasst sich mit dem Thema Päderastie. Im 33. carmen berichtet Catull25 von einem Vater, dessen Sohn Lust beim penetriert werden empfindet („und der Hintern des Sohnes ist recht gefräßig“), doch da der Knabe sich bereits in der Reifephase zum Erwachsenen befindet („die schon behaarten Backen“), lässt er sich „um ein einziges As nicht mehr verkaufen“, da er nun selbst als erastes handeln kann.
Ovid26 hingegen verabscheut die Knabenliebe. Für ihn soll kein Geschlecht in einer Partnerschaft benachteiligt werden: Vers 681f: „was Vergnügen bereitet, sollen Mann und Frau gleichermaßen gewinnen“. Zuwider seien ihm Beilager, die nicht beide auflockern würden („das ist auch der Grund, warum ich von Knabenliebe weniger wissen will“, Vers 683).
Alles in allem lässt sich sagen, dass Päderastie als Ausdruck gesellschaftlicher Eigenständigkeit und Exklusivität galt und streng reglementiert war. Dennoch war sie immer eine Gratwanderung zwischen legitimer und illegitimer Liebe.
Homosexualität in der Kaiserzeit
-Erklärungen zu „Homosexualität in der Antike“-
Die in der Republik stark verpönte Homosexualität unter Männern wurde nun in der Kaiserzeit meist toleriert und es wurde versucht, ihr Zustandekommen unter verschiedenen Aspekten zu erklären.
Als erstes wäre die so genannte „Nothomosexualität“ zu nennen, die aufgrund eines Mangels an Gelegenheit heterosexueller Triebbefriedigung (wie z.B. bei längerem Zusammenleben gleichgeschlechtlicher Personen auf Schiffen oder in Kasernen) auftrat.
Im jugendlichen Alter soll es der sexuelle Experimentiertrieb gewesen sein, da man sich noch in der Phase der Entwicklung befand und mit sich und seiner Sexualität noch nicht im Reinen war.
Als letzter Punkt wäre das Zärtlichkeitsbedürfnis bei schwärmerischen Freundschaften aufzuführen, wodurch eine sexuelle Beziehung zwischen zwei Männern entstanden sein soll.27
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unser heutiger Begriff Homosexualität würde aber wohl am ehesten für jene römischen Männer zutreffen, die es bevorzugten, penetriert zu werden. Da der aktive Part beim Akt mit politischer Macht in Verbindung gebracht wurde, verachtete man einen freien Mann, der passiv handelte. Diesem schrieb man dann Begriffe wie cinaedus (schamlos), exoletus (Lustknabe), pathicus (voller Zoten), effeminatus (weibisch) oder impudicitia (Unzucht) zu.
Doch selbst in der heutigen Zeit haben Homosexuelle mit Spott zu rechnen. So werden diese z.B. als „Tunte“, „Schwester“ oder „warmer Bruder“ bezeichnet. Auch ein bestimmtes Klischee existiert in den Köpfen der Menschen: schwule Männer hätten einen leichten, zarten Körperbau und feine Gesichtszüge, würden die Gestik und Bewegungen den Frauen nachmachen und deren weibliche Stimmen imitieren.
In der Antike wurde ein weibisch-weichlicher Mann als „mollis“ bezeichnet, d.h. dieser trug Make-up, Parfum, Kleidung wie Frauen, Halsketten, enthaarte seinen Körper und sprach leise.
Bei Ovids „Die Liebeskunst“28 wird das Bild eines „mollis“ genau beschrieben: (Vers 505f.) „Lass es dir nicht einfallen, deine Haare mit dem Eisen zu plagen, und reibe deine Schenkel nicht mit ätzendem Bimsstein ab.“ Hinzu kommt hier, dass man als „richtiger Mann“ sich nicht die Haare zu glätten hat, da es sich für Männer schicke, „auf Wohlgestalt geringeren Wert zu legen“ (Vers 509).
In Vers 523f. wird klar, dass Ovid Schwulen gegenüber abgeneigt ist: „überlass (es) (…) (dem) Manne, der hässlich die Neigung eines Mannes sucht“. Denn nur Homosexuelle würden es bei der Körperpflege übertreiben und somit als „mollis“ hervorgehen.
Martial zeichnet in 12,48 das Portrait eines Schwulen: „Das Haar glänzend, dunkel der Teint vom Salbenöl, im durchsichtig schimmernden Purpurkleid, das Antlitz zart, glatt die Brust, an den Schenkeln unbehaart“.
Ergänzt wird in 8,64 das Bild eines Homosexuellen: „sehr glattes Gesicht“, „tiefschwarzes Haar“, „zitternd- wabbelnde Weichheit“ und „ein Brustansatz wie ein noch nicht heiratsfähiges junges Mädchen“.29
Als eine schändliche Praxis zur Befriedigung galt die Fellatio, da der Mann sich dadurch wie ein Sklave in den Dienst des Sexualpartners stellte. Nur für Frauen, Knaben und Sklaven war dies angebracht, ebenso sollten sich diese immer passiv verhalten und stets zur Verfügung stehen. Dazu schreibt Petron in seinem „Satyricon“30: (Kapitel 75, Vers 11) „Was der Herr befiehlt, ist ja keine Schande“. Sklaven waren ein legitimer gleichgeschlechtlicher Partner, die sogar für die Gäste - falls erwünscht- ihren Dienst zu leisten hatten.
Unüblich waren homosexuelle Kontakte zu erwachsenen Männern sicher nicht, doch weithin wurden diese verspottet und abgelehnt.
Bei den streng phallokratisch denkenden Römern galt nur der Penetrierende als männlich; er war stark und mächtig, der andere übernahm dagegen die verachtete weibliche Rolle.
-Das Motiv des unreinen Mundes-
Die Ausführung oraler Sexualpraktiken wurde je nach Partnerzusammensetzung entweder hoch oder niedrig angesehen. Führte eine Frau die Fellatio aus, so galt dies durchaus als ehrenhaft, doch unter Männern wurde dies abgewertet. Unterwarf sich der Mann freiwillig der Fellatio oder gar des Cunnilingus, so galt sein Mund als unrein, als „impurus“.31
-Martial-
In einem Epigramm von Martial (2,42) wird ein Mann genannt, der sich gerade waschen will. Dabei erklärt der Sprecher ihn als unrein: „Zoilus, du versaust das Badewasser, indem du deinen Hintern wäscht. Damit es noch dreckiger wird, Zoilus, tauch’ doch deinen Kopf rein!“ Einerseits ist hier Zoilus’ Hintern beschmutzt: Der Erzähler meint aber nicht nur die Verunreinigung durch Kotausscheidungen, sondern auch durch die Folgen der Pedicatio: sein podex besteht aus einem Gemisch aus Samen und Kot. Der Kopf- bzw. die Lippen und der Mund- sind aufgrund der Fellatio besudelt.
In Epigramm 2,70 wird einem bekannten Fellator der Tipp gegeben, er solle zuerst „seinen Schwanz drin (in der Badewanne) waschen, dann erst den Kopf“. Dem Leser wird klar gemacht, dass der Mann durch Fellatio oder gar Irrumatio beschmutzt ist.
Bei Martial 6,81 heißt es: „Lieber hab ich es, du wäscht (nur) deinen Schwanz“. Wieder wird hier die Vermutung ausgesprochen, dass durch Oralpraktiken der Bereich des Kopfes unreiner ist als der Intimbereich. Entweder könnte es daher rühren, dass der von Sperma besudelte Kopf bzw. Mund das Wasser beschmutzen könnte, oder der Mann einer ist, der sich gern passiven Sexualpraktiken hingibt.
-Catull-
Nach Martial widmet sich ebenso Catull dem ore-impurus Motiv. In carmen 97 überlegt er zunächst, welcher Köperteil eines Geschmähten- ob nun Kopf oder Hintern- der Reinere ist. Schließlich kommt er zu folgendem Entschluss: „(…) sauberer und besser ist der Arsch“. Wiederum wird hier jemand oraler Sexualpraktiken beschuldigt.
Bei der Erkennung von Fellatoren spielt die Blässe des Verdächtigten bei Catull (carmen 80) eine Rolle: Gellius’ Gesichts- und Lippenfarbe ist stets am Morgen und nach Mittag- jeweils nach dem Schlafen- sehr blass. Verantwortlich dafür sei Fellatio: „(…) oder ist an dem Gerücht was Wahres dran, dass du die großen, stocksteifen (Schwänze) in des Mannes Mitte verschlingst?“ Schließlich wird die Blässe begründet: „Die Lippen sind befleckt vom abgespritzten (Samen-) Saft“.
-Petron-
Bei Petron wird dem Ascyltos (Kapitel 9 und 81) und cinaedus im Haus der Quartilla (Kapitel 21 und 23) ein unreiner Mund zum Vorwurf gemacht. Dabei meint Encolpius zu Ascyltos: „(…) du Mannhure, die du wie ein Weib alles mit dir machen lässt: nicht einmal dein Atem ist sauber!“. Bei cinaedus sind es die „stinkenden Küsse“ aufgrund seiner Oralpraktiken; diese sind somit seinen Opfern unangenehm und rufen Ekel hervor.
-Homosexualität bei den Bürgern-
In der griechischen Kultur wurde eine Person anerkannt, wenn sie sowohl homo- als auch heterosexuelle Neigungen verspürte. Allerdings wurde dies nur so lange als natürlich empfunden, als dass der Schwule als aktiver Partner agierte.
Ein Komödiendichter des 4.Jh. (Euboulos) verspottete die Griechen, die zehn Jahre aufgrund des Kampfes um Troja für längere Zeit miteinander leben mussten, mit folgenden Worten: „Niemand sah auch nur eine Hetäre; sie wichsten zehn Jahre lang. Es war ein erbärmlicher Feldzug: für die Eroberung einer einzigen Stadt zogen sie nach Hause mit Ärschen viel weiter als die (Tore der) Stadt, die sie eingenommen hatten“. Der Autor gibt hier in einer witzigen Situation wieder, was viele damals glaubten: da Frauen fehlten, musste nun mit den männlichen Soldaten vorlieb genommen und mit diesen zur Befriedigung Analverkehr betrieben werden.
Zum Quellenmaterial dient hier nicht nur die Literatur, denn Graffiti, Wandgemälde und Vasenmalerei zeugen von einem belebten Sexualleben der Römer. Abbildungen des männlichen Aktes herrschen bei Vasen vor; doch im Gegensatz zu Schenkelverkehr wird der Analverkehr nur dann dargestellt, wenn Personen der selben Altersgruppe daran beteiligt sind.32
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Männer bevorzugten, ihre Geschlechtsgenossen zu penetrieren. Ersichtlich wird dies in Martials Epigramm 11,43: „Wenn du mich bei meinem Burschen erwischst, Frau, (…) verweist (du) darauf, dass auch du einen Hintern hast“. Die Gattin erhofft sich dadurch, dass der Ehemann sich nun ihren Hintern vornimmt. Dieser aber redet weiter: „Wie oft hat Juno dem geillüsternen Donnergott das gleiche gesagt! Und trotzdem liegt jener mit seinem großschwänzigen Ganymed (im Bett)“. Begründet wurde die Bevorzugung des männlichen Geschlechts u.a. damit, dass der männliche Schließmuskel eine besondere Eigenart habe und dabei mehr Genuss bei der Penetration empfunden werden würde.
Gute Gelegenheiten für Orgien ergaben sich auch bei einem ausgiebigen Mahl. Meist wählte der Gastgeber seine Gäste aufgrund seines erotischen Interesses aus. Martial versucht in seinem Epigramm 1,23 dafür einen Grund zu finden, weshalb sein Erzähler nicht eingeladen wurde: „Du lädst nur Leute ein, Cotta, mit denen du badest; (…) Und ich wunderte mich immer, weshalb du niemals mich einludst. Jetzt weißich’s: Nackt hab ich dir nicht gefallen“.
Einen Diskurs über analen Sex bietet das Epigramm 1,46. Dabei haben beide Partner Schwierigkeiten, sich aufeinander einzustellen, was dabei sogar zu einer zeitweiligen Impotenz des Erzählers führt: „(…) wenn du zu mir sagst: ’gleich kommt’s mir, nun mach schon, (spritz ab)!’, erschlafft mein Schwanz sofort und zieht sich geschwächt zurück“. Das eigentliche Ziel der beiden ist der gleichzeitige Orgasmus, daher entgegnet der Erzähler: ’Lass dir (ruhig) Zeit’, sag: so zurückgehalten, werde ich umso schneller kommen, Hedylus, wenn’s dir kommt, sag zu mir: ’Komm noch nicht’“. Ein scheinbares Nicht-Wollen des Hedylus vermag den Sprecher aus seiner Situation zu retten.
Genauso konnte man z.B. durch eine Strafe zur Passivität gezwungen werden, obwohl man den eigentlichen Part- den des Penetrierenden- übernahm. Dies ist in Petrons Satyricon im 21. Kapitel der Fall: Dort wird Encolpius dazu erniedrigt, gegen seinen Willen seinen Phallus in den Hintern des Schwulen einzuführen. Das Absurde daran ist, dass diese Szenerie das traditionelle Denken in der Antike durcheinander bringt, denn hier ist nun derjenige, der normalerweise der Aktive wäre, ein Verachteter der Gesellschaft.33
In Martial Epigramm 2,28 geht es um den „Gipfel der Unzucht“. Hier wird ein Mann verdächtigt, er betreibe sowohl Cunnilingus als auch Fellatio: „(…) Sextillus, du liebst auch Knaben und Fraun nicht wie üblich und Vetustias Mund reizt dich nicht (…). Nichts darum trifft auf dich zu (…). Was also? (…) du weißt, dass es noch zweierlei gibt“.34 Ein Liebhaber solcher Praktiken war in der Öffentlichkeit nicht akzeptiert; er hatte daher mit dem Spott und Hohn der Leute zu rechnen.
Martial redet in 1,24 von einer Schwulenhochzeit: „ (…) Er, als die Braut, nahm gestern sich ’nen Mann“.35 Scheinbar gab es in der Antike nicht nur körperliche Liebe unter Männern, sondern wurde diese auch durch eine uns bekannte Zeremonie bekräftigt: Heirat.
Im 21. Gedicht bei Catull droht ein Erzähler einem Mann mit Penetration, falls dieser seinen Knaben nicht in Ruhe lässt: „(…) Unzucht willst du mit meinem Liebling treiben. (…) hör auf, da’s noch möglich ist mit Anstand; wenn du niedergeritten, hörst du doch auf!“36 Dabei erhofft er sich, den Störenden los zu werden, indem jener aus Angst vor der Schande penetriert zu werden, nachgibt.
Doch eine Lektüre mit erotischem oder homoerotischem Beigeschmack war nicht an die ältere Generation gerichtet. Hatten Personen gehobenen Alters Interesse daran, galt dies als lächerlich oder gar abstoßend. Martial bringt diese Einschränkung in Epigramm 3,69: „(…) Dies soll ein älterer Herr lesen, aber nur einer, dem eine (junge) Freundin noch (hart) zusetzt“.37
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
-Homosexualität bei den Kaisern-
Nicht nur unter den „Normalbürgern“ gab es homosexuelle Handlungen; einige Kaiser werden- v.a. bei Sueton38 - verdächtigt, ein exzessives Liebesleben geführt zu haben.
-Tiberius-
In den Herrscherdynastien erfreuten sich homosexuelle Praktiken mit mehreren Teilnehmern großer Beliebtheit. Tiberius galt als der Erfinder der sog. „dreier Spintria“. Dabei stehen drei Männer hintereinander; der Vordermann gewährt Lust, der Hintermann holt sie sich und der Mittelmann erfreut sich beiderlei.
Tiberius wurde nachgesagt, Orgien aller Art auf Capri durchzuführen: „(…) auf Capri ersann er auch ein Sesselzimmer als Platz geheimer Lüste. Dort sollten (…) die Erfinder widernatürlichen Geschlechtsverkehrs, die er spintriae nannte, (…) vor seinen Augen miteinander Verkehr ausüben (…)“. (Kapitel 43)39 In seinem Haus waren Bilder und Figuren mit unanständigen Szenen und Gestalten verteilt. Ebenso soll er an den ungewöhnlichsten Orten wie in Grotten oder auf hohen Felsen mit jungen Leuten beiderlei Geschlechts Verkehr gehabt haben.
Da er sein Sexualleben offen auslebte, soll man die Insel Capri spöttisch in „Caprineum“ umbenannt haben.
-Caligula-
Von Caligula wird im 36. Kapitel berichtet, dass er seinen Schwager und den Pantomimeschauspieler Mnester liebte „sowie mehrere Geiseln (…) zu gegenseitiger Unzucht missbraucht (hat)“.
-Nero-
Nero liebte den Tänzer Paris und den Knaben Sporus. Letzteren „ließer entmannen und versuchte sogar eine Geschlechtsumwandlung vorzunehmen“. (Kapitel 28) Bei den anschließenden Hochzeitsfeierlichkeiten wurde alles Traditionelle bewahrt: die „Braut“ wurde mit einer Mitgift ausgestattet und mit einem Brautschleier geschmückt. Sogar ein Priester war anwesend, der die beiden vermählte. „Dann ließer ihn in prächtigem Zug in seinen Palast geleiten und hielt ihn dort wie seine Gemahlin. (…) Auf den Festversammlungen und Messen (…) hatte er ihn bei sich und tauschte immer wieder zärtliche Küsse mit ihm“. Bei der zweiten Schwulenhochzeit mit Doryphoros alias Pythagoras spielte Nero den Frauenpart. Bekannten sich Leute offen zu ihren sexuellen Ausschweifungen, habe er „alle ihre übrigen Schandtaten durchgehen lassen“.
- Galba und Vitellius-
Beide- sowohl Galba als auch Vitellius- waren bisexuell. Sueton schreibt zu Ersterem: „In der Liebe neigte er mehr zu Männern und auch dort nur zu sehr drallen und ausgewachsenen“ (Kapitel 22). Auch soll er in Spanien den Icelus „nicht nur ganz offen mit leidenschaftlichen Küssen begrüßt, sondern ihn dann verführt (haben)“.
Vitellius missbrauchte den Freigelassenen Asiaticus. Dieser war dann vor ihm geflohen, doch der Kaiser fand ihn wieder auf, befreite ihn und nahm ihn abermals zum Geliebten. (siehe Kapitel 12)
Schlussbemerkung
Zusammenfassend zum Thema Homosexualität der Kaiserzeit aber auch zur Päderastie lässt sich sagen, dass weder die Griechen noch die Römer religiöse Einrichtungen besaßen, die sexuelle Verbote aussprachen oder gar erzwangen.
Hierbei handelt es sich um eine Erscheinung, die einerseits von Ort zu Ort verschieden, andererseits genauso durch den Wandel der Zeit geprägt war.
Bemühte man sich in der Republik noch, Tugenden zu leben, so wurden diese oftmals in der Kaiserzeit verworfen und vergessen.
Sexualität der Frau
Über gleichgeschlechtliche Liebe unter Frauen ist kaum etwas überliefert. Sappho von Lesbos dagegen beweist uns, dass es auch lesbische Beziehungen gab.
Klar ist, dass die Frau eine niedrige Stellung im patriarchalischen System innehatte und nur als tugendhafte Ehefrau toleriert wurde. War man nun aber lesbisch, so wurde man kurzerhand zu einer „männlichen Frau“40, die ausgelacht oder gar verspottet wurde.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Doch mit Ende der Kaiserzeit waren Moral und Sittsamkeit wieder hoch angesehen und sexuelle Freizügigkeit missachtet. Somit verschwand auch langsam die Homosexualität unter Männern- jedenfalls aus der Öffentlichkeit!
Bilderklärungen und –nachweise
Seite 1: Zeus raubt Ganymed; Dover, Kenneth J., Homosexualität in der griechischen Antike, Verlag C.H. Beck, Hannover und München, 1983
Seite 2: Figur: Kouros (ca. 615- 590 v.Chr.); Percy, William A., Pederasty and pedagogy in archaic Greece, Board of Trustees of the University of Illinois, 1996
Seite 7: Erastes küsst eromenos; Percy, William A., Pederasty and pedagogy in archaic Greece, Board of Trustees of the University of Illinois, 1996
Seite 9: Erastes berührt die Genitalien des eromenos; Percy, William A., Pederasty and pedagogy in archaic Greece, Board of Trustees of the University of Illinois, 1996
Seite 11: Erastes beschenkt eromenos mit einem Hahn; Percy, William A., Pederasty and pedagogy in archaic Greece, Board of Trustees of the University of Illinois, 1996
Seite 13: Zärtliche Berührungen zweier Homosexueller; Kartenspiel “Sex in the ancient Greece”
Seite 16: Orgie dreier Homosexueller; Kartenspiel „Sex in the ancient Greece“
Seite 18: Sog. „dreier Spintria“; Kartenspiel „Sex in the ancient Greece“
Seite 20: Zwei Frauen berühren sich intim; Kartenspiel „Sex in the ancient Greece“
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Deissmann, Marieluise, übersetzt und herausgegeben, Gaius Iulius Caesar, De bello Gallico, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1980
Eisenhut, Ed. Werner, Catullus, Gaius Valerius, Gedichte Lateinisch- Deutsch, Artemis Verlag, München; Zürich, 1986 9
Hofmann, Walter, Martialis, Marcus Valerius, Epigramme, aus dem Lateinischen übertragen und herausgegeben, Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig, 1997
Lenz, Friedrich Walter, Ovid, Die Liebeskunst, Lateinisch und Deutsch, Akademie-Verlag, Berlin, 1969
Martial, Epigramme, Artemis Verlag, Zürich, 1957
Schnur, Harry C., übersetzt und erläutert, Petron, Satyricon, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1999
Wittstock, Otto, Lat. und dt., Suetonius Tranquillus, Gaius, Kaiserbiographien, Akademie Verlag, Berlin, 1993
Sekundärliteratur
Cancik, Hubert und Schneider, Helmuth, hrsg., Der neue Pauly, Enzyklopädie der Antike, Metzler, Stuttgart; Weimar, 2002
Christ, Karl, Die Römer, C.H. Beck, München, 1994 3
Demandt, Alexander, Das Privatleben der römischen Kaiser, C.H. Beck, München, 1996
Dover, Kenneth J., Homosexualität in der griechischen Antike, Verlag C.H. Beck, Hannover und München, 1983
Giardina, Andrea, Der Mensch der römischen Antike, Campus, Frankfurt/ Main, 1991
Georges, Karl Ernst, Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch, Hahnsche Buchhandlung, Leipzig, 1918
Grant, Michael und Hazel, John, Lexikon der antiken Mythen und Gestalten, Deutscher Taschenbuchverlag GmbH& Co., München, 2001 16
Obermayer, Hans Peter, Martial und der Diskurs über männliche „Homosexualität“ in der Literatur der frühen Kaiserzeit, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1998
Patzer, Harald, Die griechische Knabenliebe, Franz Steiner Verlag GmbH, Wiesbaden, 1982
Percy, William A., Pederasty and pedagogy in archaic Greece, Board of Trustees of the University of Illinois, 1996
Reinsberg, Carola, Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im antiken Griechenland, C.H. Beck, München, 1989
Weeber, Karl Wilhelm, Alltag im alten Rom, Artemis Verlag, Zürich, 1995
Weinold, Horst, Von der Republik zum Prinzipat, C.C. Buchners Verlag, Bamberg, 2001 2
[...]
1 Dover, Kenneth J., Homosexualität in der griechischen Antike, Verlag C.H. Beck, Hannover und München, 1983 (Seite 172)
2 Grant, Michael und Hazel, John, Lexikon der antiken Mythen und Gestalten, Deutscher Taschenbuchverlag GmbH& Co., München, 200116
3 Cancik, Hubert und Schneider, Helmuth, hrsg., Der neue Pauly, Enzyklopädie der Antike, Metzler, Stuttgart; Weimar, 2002 Georges, Karl Ernst, Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch, Hahnsche Buchhandlung, Leipzig, 1918
4 Eisenhut, Ed. Werner, Catullus, Gaius Valerius, Gedichte Lateinisch- Deutsch, Artemis Verlag, München; Zürich, 19869 Lenz, Friedrich Walter, Ovid, Die Liebeskunst, Lateinisch und Deutsch, Akademie-Verlag, Berlin, 1969 Hofmann, Walter, Martialis, Marcus Valerius, Epigramme, aus dem Lateinischen übertragen und herausgegeben, Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig, 1997
5 Reinsberg, Carola, Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im antiken Griechenland, C.H. Beck, München, 1989
6 Obermayer, Hans Peter, Martial und der Diskurs über männliche „Homosexualität“ in der Literatur der frühen Kaiserzeit, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1998
7 Weinold, Horst, Von der Republik zum Prinzipat, C.C. Buchners Verlag, Bamberg, 20012
8 Deissmann, Marieluise, übersetzt und herausgegeben, Gaius Iulius Caesar, De bello Gallico, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1980
9 Cancik, Hubert und Schneider, Helmuth, hrsg., Der neue Pauly, Enzyklopädie der Antike, Metzler, Stuttgart; Weimar, 2002
10 Georges, Karl Ernst, Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch, Hahnsche Buchhandlung, Leipzig, 1918
11 Gardina, Andrea, Der Mensch der römischen Antike, Campus, Frankfurt/ Main, 1991
12 Dover, Kenneth J., Homosexualität in der griechischen Antike, Verlag C.H. Beck, Hannover und München, 1983
13 Eisenhut, Ed. Werner, Catullus, Gaius Valerius, Gedichte Lateinisch- Deutsch, Artemis Verlag, München; Zürich, 19869
14 Lenz, Friedrich Walter, Ovid, Die Liebeskunst, Lateinisch und Deutsch, Akademie-Verlag, Berlin, 1969
15 Hofmann, Walter, Martialis, Marcus Valerius, Epigramme, aus dem Lateinischen übertragen und herausgegeben, Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig, 1997
16 Patzer, Harald, Die griechische Knabenliebe, Franz Steiner Verlag GmbH, Wiesbaden, 1982
17 Reinsberg, Carola, Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im antiken Griechenland, C.H. Beck, München, 1989
18 Dover, Kenneth J., Homosexualität in der griechischen Antike, Verlag C.H. Beck, Hannover und München, 1983
19 Patzer, Harald, Die griechische Knabenliebe, Franz Steiner Verlag GmbH, Wiesbaden, 1982
20 Dover, Kenneth J., Homosexualität in der griechischen Antike, Verlag C.H. Beck, Hannover und München, 1983
21 Patzer, Harald, Die griechische Knabenliebe, Franz Steiner Verlag GmbH, Wiesbaden, 1982
22 Reinsberg, Carola, Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im antiken Griechenland, C.H. Beck, München, 1989
23 Patzer, Harald, Die griechische Knabenliebe, Franz Steiner Verlag GmbH, Wiesbaden, 1982
24 Hofmann, Walter, Martialis, Marcus Valerius, Epigramme, aus dem Lateinischen übertragen und herausgegeben, Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig, 1997
25 Eisenhut, Ed. Werner, Catullus, Gaius Valerius, Gedichte Lateinisch- Deutsch, Artemis Verlag, München; Zürich, 19869
26 Lenz, Friedrich Walter, Ovid, Die Liebeskunst, Lateinisch und Deutsch, Akademie-Verlag, Berlin, 1969
27 Patzer, Harald, Die griechische Knabenliebe, Franz Steiner Verlag GmbH, Wiesbaden, 1982
28 Lenz, Friedrich Walter, Ovid, Die Liebeskunst, Lateinisch und Deutsch, Akademie-Verlag, Berlin, 1969
29 Obermayer, Hans Peter, Martial und der Diskurs über männliche „Homosexualität“ in der Literatur der frühen Kaiserzeit, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1998
30 Schnur, Harry C., übersetzt und erläutert, Petron, Satyricon, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1999
31 Obermayer, Hans Peter, Martial und der Diskurs über männliche „Homosexualität“ in der Literatur der frühen Kaiserzeit, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1998
32 Dover, Kenneth J., Homosexualität in der griechischen Antike, Verlag C.H. Beck, Hannover und München, 1983 (Seite 172)
33 Obermayer, Hans Peter, Martial und der Diskurs über männliche „Homosexualität“ in der Literatur der frühen Kaiserzeit, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1998
34 Martial, Epigramme, Artemis Verlag, Zürich, 1957
35 Hofmann, Walter, Martialis, Marcus Valerius, Epigramme, aus dem Lateinischen übertragen und herausgegeben, Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig, 1997
36 Eisenhut, Ed. Werner, Catullus, Gaius Valerius, Gedichte Lateinisch- Deutsch, Artemis Verlag, München; Zürich, 19869
37 Obermayer, Hans Peter, Martial und der Diskurs über männliche „Homosexualität“ in der Literatur der frühen Kaiserzeit, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1998
38 Wittstock, Otto, Lat. und dt., Suetonius Tranquillus, Gaius, Kaiserbiographien, Akademie Verlag, Berlin, 1993
39 Wittstock, Otto, Lat. und dt., Suetonius Tranquillus, Gaius, Kaiserbiographien, Akademie Verlag, Berlin, 1993
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text behandelt Homosexualität in der Antike, insbesondere im Kontext der römischen Republik und Kaiserzeit. Er untersucht die Konzepte von Tugend, Schönheit, Knabenliebe (Päderastie) und die unterschiedliche Wahrnehmung von Homosexualität in verschiedenen sozialen Schichten und historischen Perioden.
Was bedeutet "vir vere Romanus" im Text?
"Vir vere Romanus" bedeutet "wahrer römischer Staatsmann". Der Text diskutiert die Tugenden und Schönheitsideale, die einen solchen Mann auszeichneten, einschließlich Tapferkeit, Selbstbeherrschung, Gerechtigkeit, Klugheit, Treue, Pietät und Bescheidenheit.
Was ist Knabenliebe (Päderastie) im Kontext des Textes?
Knabenliebe oder Päderastie bezieht sich auf Beziehungen zwischen älteren Männern (erastes) und jungen Knaben (eromenos). Der Text untersucht die sozialen, kulturellen und pädagogischen Aspekte dieser Beziehungen in der griechischen und römischen Antike, wobei betont wird, dass Päderastie nicht immer nur sexueller Natur war, sondern oft auch als eine Form der Erziehung und des Mentoring angesehen wurde.
Wie unterschied sich die dorische von der klassischen Knabenliebe?
Die dorische Knabenliebe, die ältere Form, entwickelte sich im militärischen Kontext und betonte die Stärkung des Knaben durch den Umgang mit einem erwachsenen Mann. Sie sah den Erastes als Betreuer und weniger als Liebhaber. Die klassische Knabenliebe hingegen, die sich mit dem Polisadel entwickelte, konzentrierte sich mehr auf die Schönheit des Knaben.
Was bedeutet "Homosexualität" im Kontext des Textes in Bezug auf die römische Gesellschaft?
Im Kontext des Textes bezieht sich "Homosexualität" auf sexuelle Beziehungen zwischen Männern, die oft mit Vorurteilen und unterschiedlichen sozialen Akzeptanzen verbunden waren. Der Text untersucht, wie die Römer zwischen aktiven und passiven Rollen in homosexuellen Handlungen unterschieden und wie diese Rollen die Wahrnehmung der Männlichkeit beeinflussten. Der passive Part wurde oft verachtet.
Was ist das Motiv des unreinen Mundes, das im Text diskutiert wird?
Das Motiv des unreinen Mundes bezieht sich auf die Stigmatisierung oraler Sexualpraktiken (Fellatio, Cunnilingus) in der römischen Gesellschaft. Männer, die sich diesen Praktiken hingaben, wurden oft als unrein oder weibisch angesehen, da dies als Unterwerfung unter den Sexualpartner interpretiert wurde.
Welche Kaiser werden im Text als Beispiele für Homosexualität oder Bisexualität genannt?
Der Text nennt Tiberius, Caligula, Nero, Galba und Vitellius als Beispiele für Kaiser, die homosexuelle oder bisexuelle Beziehungen hatten. Es werden detaillierte Beschreibungen ihrer sexuellen Ausschweifungen und Vorlieben angeführt, oft unter Berufung auf Sueton.
Was sagt der Text über die Sexualität der Frau in der Antike?
Der Text stellt fest, dass über gleichgeschlechtliche Liebe unter Frauen kaum etwas bekannt ist. Lesbische Beziehungen wurden nicht toleriert. Lesbische Frauen wurden oft als "männliche Frauen" bezeichnet, ausgelacht und verspottet.
Welche Art von Literatur wurde als Quelle für den Text verwendet?
Der Text stützt sich auf Primärliteratur von römischen Autoren wie Catull, Ovid, Martial, Petronius, Suetonius und Gaius Julius Caesar. Sekundärliteratur und moderne wissenschaftliche Werke zum Thema Homosexualität in der Antike werden ebenfalls herangezogen.
Welche Bilder sind enthalten?
Der Text enthält Bilder von Zeus, der Ganymed entführt; Kouros-Figuren; Szenen von Erastes, die Eromenos küssen und berühren; Geschenke, die zwischen Erastes und Eromenos ausgetauscht werden; Orgie-Szenen und mehr.
- Quote paper
- Daniela Hoffmann (Author), 2003, Vom vir vere Romanus der Republik zum Homosexuellen der Kaiserzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107776