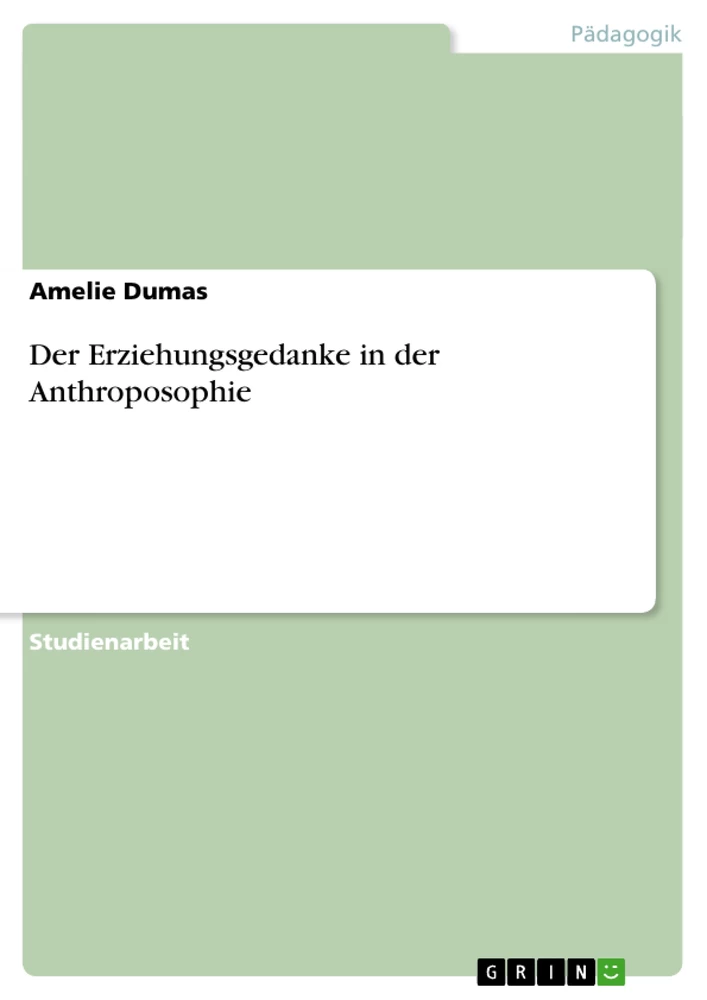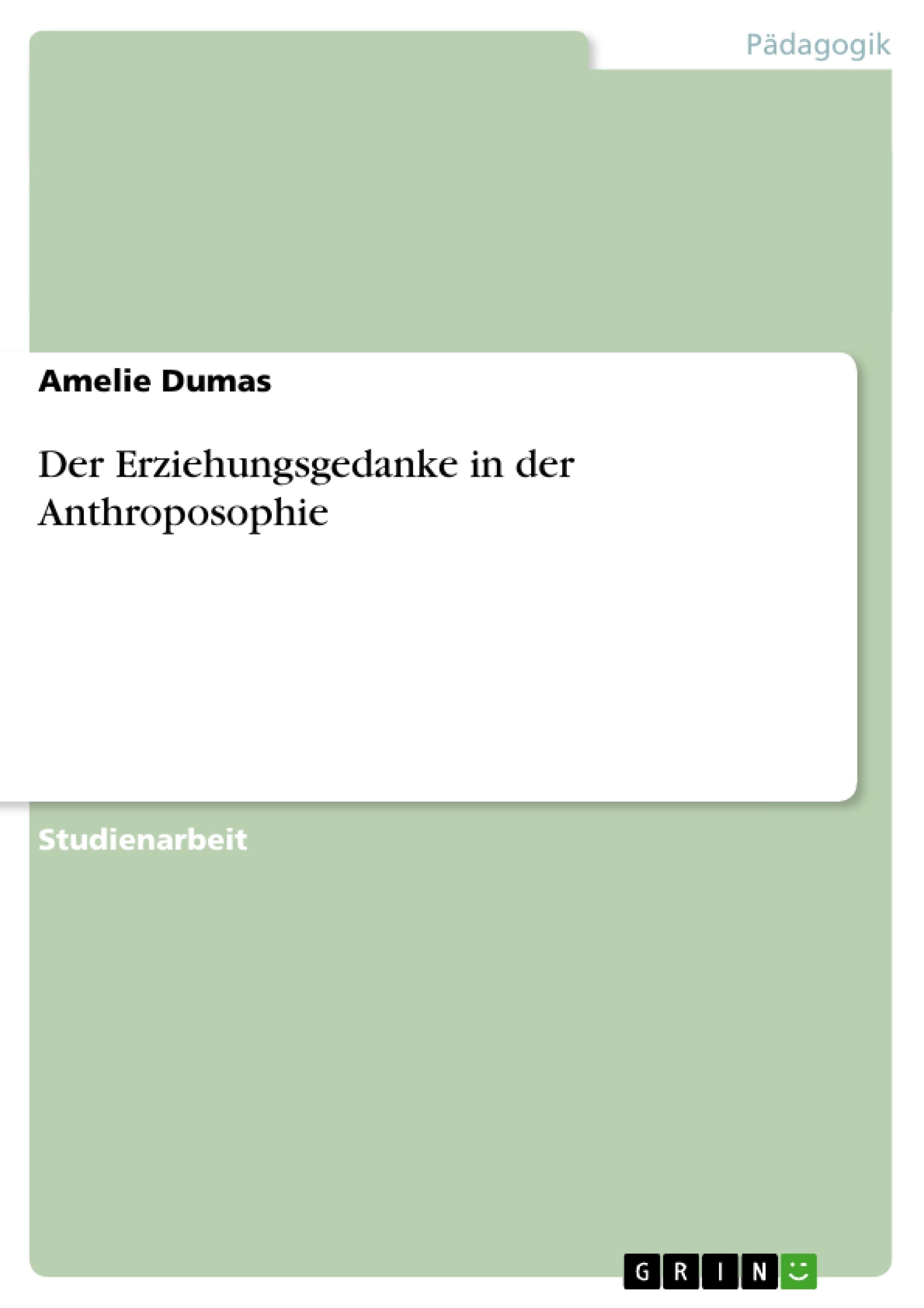Was verbirgt sich wirklich hinter den Mauern einer Waldorfschule? Tauchen Sie ein in eine Welt, in der die Erziehung des ganzen Menschen im Mittelpunkt steht, eine Welt, die auf den Prinzipien der Anthroposophie Rudolf Steiners basiert. Dieses Buch enthüllt die zentralen Säulen der anthroposophischen Lehre, von den vier Wesensgliedern des Menschen – dem physischen Leib, dem Ätherleib, dem Astralleib und dem Ich-Leib – bis hin zu den spezifischen Entwicklungsphasen, die jedes Kind durchläuft. Entdecken Sie, wie diese Erkenntnisse den Lehrplan und die Pädagogik der Waldorfschulen prägen, vom Epochenunterricht bis zur Eurythmie, und wie sie darauf abzielen, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch die individuellen Fähigkeiten und Talente der Schüler zu fördern. Erfahren Sie mehr über die Rolle des Waldorflehrers, der nicht nur Wissensvermittler, sondern auch Begleiter auf dem Weg zur Selbsterkenntnis sein soll, und über die Bedeutung von Kreativität, künstlerischem Ausdruck und handwerklichem Können im Lernprozess. Kritische Leser finden hier fundierte Einblicke in die oftmals diskutierte Autoritätsfrage und die spirituellen Grundlagen der Waldorfpädagogik, während Eltern und Pädagogen wertvolle Anregungen für eine ganzheitliche Erziehung erhalten, die den Menschen in seiner Gesamtheit erfasst. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für alternative Bildungswege interessieren und die tieferen Zusammenhänge zwischen Anthroposophie, Pädagogik und menschlicher Entwicklung verstehen möchten. Es beleuchtet die besonderen Aspekte der Waldorfpädagogik, einschließlich des Verzichts auf traditionelle Medien und Lehrbücher, und zeigt, wie der Lehrplan darauf ausgerichtet ist, die Entwicklung des Kindes in jedem Lebensjahr zu unterstützen. Lassen Sie sich auf eine Reise mitnehmen, die Ihr Verständnis von Erziehung und Bildung grundlegend verändern könnte.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Anthroposophie - Zwei Definitionen
2. Rudolf Steiner - Begründer der Anthroposophie
3. Die vier Leiber oder Wesensglieder des Menschen
3.1 Der physische Leib
3.2 Der Äther- oder Lebensleib
3.3 Der Astralleib
3.4 Der Ich-Leib
4. Der Entwicklungsgedanke in der Anthroposophie und Konsequenzen für die Erziehung
5. Die Waldorfschule
5.1 Die ganzheitliche Erziehung
5.2 Der Waldorflehrer
5.3 Der Waldorflehrplan
5.4 Der Epochenunterricht
5.5 Die Eurythmie
5.6 Medien- und Lehrmitteleinsatz an den Waldorfschulen
6. Ergebnisprotokoll der Sitzung vom Mo 16/11/1998
1. ANTHROPOSOPHIE - ZWEI DEFINITIONEN
„ Anthroposophie (griech. anthropos Mensch, sophia Weis- heit; engl. anthroposophy). Von R. Steiner begründete Er- kenntnismethode zur wissenschaftlichen Erforschung der real-geistigen Welt und zur Entwicklung der dazu notwen- digen Erkenntnisfähigkeit. Die A. ist die Grundlage der anthroposophischen Pädagogik, der Waldorfpädagogik und der Konzeption der Waldorfschulen, der Waldorfkin- dergärten und der heilpädagogischen Einrichtungen.“
(Schaub/Zenke, 1995, S. 28)
„ Anthroposophie (gr., Menschenweisheit), v. Rudolf → Steiner begr. philosoph. Weltanschauung, Mischung v. magischen Elementen, indischer Seelenwanderungslehre u. der mythischen u. mystischen → Gnosis; wichtige Merk- male: Eingliederung aller menschl. u. außermenschl. Er- scheinungen in kosmischen Gesamtzusammenhang, Be- stimmung des Geistigen als Urgrund allen Seins, zu dem der Mensch in Wiedergeburten geläutert werden muß, u. Bestimmung des künftigen Schicksals als Ergebnis früherer guter od. schlechter Taten ( → Karma).“
(Universal Lexikon, 1989, S. 202-203)
2. Rudolf Steiner - Begründer der Anthroposophie
Rudolf Steiner ist am 27. Februar 1861 als Sohn eines östereichischen Bahnbeamtens und erstes von drei Geschwistern in Kraljevec, in Ungarn, geboren worden. In Wiener-Neustadt besuchte er die Realschule und bestand das Abitur mit Auszeichnung. Im Anschluß daran studierte er an der Wiener Hochschule und belegte Mathematik, Physik, Chemie und Biologie, geisteswissenschaftliche Vorlesungen wie deutsche Literatur, Philosophie und Geschichte. 1882 erhält Steiner den Auftrag innerhalb Kürschners Nationalliteratur Goethes Naturwissenschaftliche Schriften zu kommentieren.
Im Herbst 1890 wird er ständiger Mitarbeiter am Goethe-Schiller-Archiv in Weimar. Während dieser Zeit erarbeitet Steiner die erkenntnis-theoretisch-philosophischen Grundlagen seiner späteren Anthroposophie. 1891 promoviert er als Doktor der Philosophie. 1894 publiziert er sein philosophisches Grundwerk „Die Philosophie der Freiheit“, in welchem er sein Anliegen wie folgt zusammenfaßt:
„Meine Philosophie der Freiheit ist in einem Erleben begründet, das in der Verständigung des menschlichen Bewußtseins mit sich selbst besteht. Im Wollen wird die Freiheit geübt, im Fühlen wird sie erlebt, im Denken wird sie erkannt.“
(Maurice Martin, 1987, S.21)
1897 zieht Steiner nach Berlin und arbeitet dort 1899 - 1904 als Lehrer an der Arbeiter Bildungsschule. 1902 tritt er unter der Bedingung, seine eigenen Anschauungen als Anthroposophie vertreten zu können in die „Theosophische Gesellschaft“ (1875 durch H.P. Blavatsky in New York gegründet) ein, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, und lernt dort Marie von Sivers kennen mit der er sich am 24. Dezember 1914 vermählt. Im Jahre 1907 begegnet er dem französischen Schriftsteller Edouard Schuré, durch den die Kunst Eingang in Steiners Schaffen fand. Schuré vertrat die Ansicht, daß die Bildsprache der Kunstformen geistige Inhalte lebendiger zum Ausdruck bringen kann als die Gedanken.
1919 gründet Rudolf Steiner die erste Waldorfschule in Stuttgart, deren Inhalte darauf ausgerichtet waren Anthroposophie nicht zu lehren sondern zu leben. Am 01. Januar 1924 erkrankt er an einem Leiden, das ihn ende September 1924 an sein Bett fesselt und schließlich am 30. März 1925 zu seinem Tode führt.
Rudolf Steiner hat im Laufe seines Lebens europaweit an die 6000 Vorträge gehalten. Die Problematik die Anthroposophie Rudolf Steiners als zukunftsweisende und zu einem neuen Humanismus führende Geisteswissen- schaft anzuerkennen, besteht in der Gefahr eines absoluten Autoritätsglaubens und einer sektiererischen Anhängerschaft ihm gegenüber. Das dies aber keinesfalls in seinem Sinne war, hat er selbst einmal gesagt:
„Je mehr man es dahin bringt, den Geistesforscher nicht als Autorität zu nehmen, sondern sich auf den gesunden Men- schenverstand zu verlassen, alles zu prüfen, und je mehr man alles, was der Geistesforscher sagt, daran bemißt, wenn man es mit dem Leben vergleicht, je mehr man das tut, desto mehr steht man auf einem gesunden Boden . Aus diesem Grunde sollte die üble Gewohnheit, die so sehr die Wege zur übersinnlichen Erkenntnis verlegt, ganz und gar bei denen ausgetilgt werden, welche an solche Erkenntnis herantreten wollen: daß man den Geistesforscher, der in die geistige Welt hineinzuschauen vermag, deshalb, weil er dies kann, für eine besondere Autorität, für etwas Besonderes hält. Dadurch wird der Autoritätsglaube und eine blinde An- hängerschaft hervorgerufen, die schon schlimm genug sind auf anderen Gebieten, die aber am allerschlimmsten sind auf dem Gebiete geisteswissenschaftlicher Forschungen.“
(Aus dem Vortrag „Die Wege der übersinnlichen Erkenntnis“, gehalten am 21. November 1912)
3. Die vier Leiber oder Wesensglieder des Menschen
Die Anthroposophie als Weisheit vom Menschen beansprucht für sich die Wahrheit, daß das, was wir vom Menschen mit unseren Sinnen wahrnehmen können, nur ein viertel des ganzen Menschenwesens ausmacht. Dabei handelt es sich um den „physischen Leib“ (griech. physis = Natur, natürlicher Leib), den wir sehen, fühlen, riechen und ertasten können. Die anderen drei Wesensglieder, der „Äther- oder Lebensleib“, der „Astral- oder Seelenleib“ und das „Ich“ erschließen sich dem Menschen erst dann wenn er sich bewußt und aufmerksam wahrnimmt und so zur Selbsterkenntnis gelangt die es ihm ermöglicht seine verschiedenen Wesensglieder vollständig wahrzunehmen. Die Wesensglieder sind hierarchisch auf verschiedenen Erkenntnisstufen zu finden, je tiefer der Mensch in sich eindringt desto näher gelangt er durch Selbsterkenntnis an sein wahres „Ich“.
Bei einer derartigen Menschenbetrachtung wird es hilfreich sein, einen Vergleich mit dem übrigen Naturreich zu vollziehen und eine „Rangordnung“ aufzustellen.
3.1 Der physische Leib
Zuerst zeigt sich der physische Leib der den Menschen mit der äußeren Welt verbindet, ihn kann man mit seinen Sinnesorganen wahrnehmen. Die Stoffe aus denen sich der physische Leib zusammensetzt, sind die gleichen die man sowohl in der mineralischen, anorganischen Natur, als auch in der organischen, belebten Natur findet. Allerdings sind wir Menschen, wie auch alle Tiere und Pflanzen, mit der mineralischen Welt nur insofern verwandt, als das wir identisches „Material für den Aufbau des physischen Leibes“ haben. Bau und Gestalt kommen aus der geistigen, uns unsichtbaren Welt. Steiner nennt den Bereich der anorganischen Natur „das Reich des Mineralischen, das stets den Tod in sich trägt“(Scherer, 1987, S.44). Die Kräfte die aus diesem Reich im Menschen vorhanden sind, wirken erst, wenn der physische Leib gestorben ist. Sie lösen ihn auf und werden als „Vernichtungs- und Zerstäuberkräfte“(Scherer, 1987, S.44) tätig.
3.2 Der Äther- oder Lebensleib
Das darauf folgende Wesensglied des Menschen befindet sich in der nächst höheren Erkenntnisstufe, der geistigen Welt. So wie der physische Leib die Baumaterialien für den Körperaufbau liefert, wird der Ätherleib vergleichsweise als Baumeister oder Architekt tätig. Er ist dafür zuständig, daß der Organismus planmäßig aufgebaut und unterhalten wird, und das alle lebenserhaltenden Prozesse ablaufen können. So spricht man auch vom „Bildekräfteleib“. Während des Schlafes sinken alle Lebewesen in die Bewußtlosigkeit ihres Ätherleibes zurück. Wäre dieser die letzte Stufe menschlicher Erkenntnis, so würden wir ewig in dem Zustand der Bewußtlosigkeit verharren. Man spricht dieser Stufe die „Imagination“ zu.
3.3 Der Astral- oder Seelenleib
Das dritte Wesensglied des Menschen löst diesen aus seiner Bewußtlosigkeit heraus und bietet ihm eine Reihe von Sinnesempfindungen, regt Wünsche und Willensimpulse an und bestimmt seine Aktivitäten. Es beseelt den Menschen in dem er ihm Schmerz und Lust, Hunger und Durst, Freude und Leid, Farben, Formen und Töne empfinden läßt. Während der Schlafphase verläßt der Seelenleib den Ätherleib, so daß dieser seine Aufbau- und Regenerationstätigkeit ungestört ausführen kann. Zu der dritten Erkenntnisstufe, die gleichzeitig die zweite geistige Stufe ist gehört die „Inspiration“.
3.4 Der Ich-Leib
Wie der Seelenleib den Menschen aus dem Schlaf ins Wachen bringt, so ermöglicht ihm das „Ich“ das Vergessen zu überwinden und sich zu erinnern. Steiner sieht darin den wesentlichen Unterschied zum Tier, dem er unterstellt die Gegenwart nicht mit der Vergangenheit verbinden zu können. Das Erinnern ermöglicht dem Menschen logisches und systematisches Denken und plaziert ihn dadurch an die höchste Position, der von Steiner aufgestellten Rangordnung. Viele Dinge vergißt der Mensch, was notwendig ist um neuen Erkenntnissen unvoreingenommen gegenüberstehen zu können, aber in folgenden ähnlichen Situationen erinnert er sich wieder daran und kann sein Handeln so optimieren und Fehler vermeiden. Die Erinnerung ermöglicht es dem Menschen zu lernen. Beim Lernen erweitert er seine Kompetenzen indem er auf bisheriges Wissen zurückgreift, welches er sich mit Hilfe der Erinnerung aus seinem Gedächtnis zurückruft und es erweitert.
Das Wort „Ich“, grenzt sich von allen anderen Wörtern durch die Tatsache ab, daß es für jeden Menschen eine individuelle Bedeutung hat. Nenne ich einen Baum „Baum“, so hat dieses Wort den gleichen Sinn als wenn ein anderer einen Baum „Baum“ nennt. Gebrauche ich allerdings das Wort „Ich“, dann hat es für mich eine völlig andere Bedeutung als wenn ein anderer sich mit „Ich“ benennt. „Denn ich bin ein Ich nur für mich, für jeden anderen bin Ich ein Du; und jeder andere ist für mich ein Du.“(Scherer, 1987, S.47)
Das Bewußtsein ein „Ich“ zu sein, bildet sich in der Regel um das dritte Lebensjahr aus, alles was davor geschehen ist haben wir vergessen. Das hängt damit zusammen, daß der Ätherleib in den ersten Lebensjahren ausschließlich mit dem Körperaufbau beschäftigt ist und keine Kräfte für das Festhalten von Erinnerungen übrig hat. Zu dem „Ich“ gehört die Intuition.
Es ist notwendig mit der Lehre über die verschiedenen Wesensglieder vertraut zu sein, wenn man den Erziehungsgedanken in der Anthroposophie verstehen möchte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. DER ENTWICKLUNGSGEDANKE IN DER ANTHROPOSOPHIE UND DIE KONSEQUENZEN FÜR DIE ERZIEHUNG
Die vier Wesensglieder aus denen der Mensch besteht entfalten sich nacheinander in einem sieben Jahres Zyklus. Steiner spricht von den „vier Geburten“(F.-J. Wehens, 1987, S.175). Der Erzieher muß genau Bescheid wissen über die Merkmale jedes Wesensgliedes, damit er dem Kind helfen kann sich im Sinne der Anthroposophie zu entwickeln.
Die erste Entwicklungsstufe umfaßt die Phase von der Geburt bis zum ersten Zahnwechsel ( 0-7 Jahre ). Während dieser Zeit ist das Kind geprägt von dem Glauben das alles in der Welt gut ist und von dem Willen erfüllt alles zu imitieren was es in seiner Umwelt erfährt. Der Erziehungsgrundsatz dieser Phase lautet daher „Nachahmung- und Vorbild“. Eine bewußt gestaltete Umgebung mit angemessenen Spielen und Musik, gesunder Ernährung, bequemer Kleidung und freundlichen Menschen ist nötig, um den Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden.
Vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife durchlebt das Kind den zweiten Entwicklungszyklus (7-14 Jahre). Das Gedächtnis und das Temperament des Kindes prägen sich aus, Emotionen und Talente entwickeln sich und die bildhafte Vorstellung. Kinder in dieser Phase sind nicht in der Lage mit abstrakten Begriffen und Reflexionen umzugehen, daher muß der Erzieher oder Lehrer mit Bildern, Gleichnissen und Beispielen arbeiten. Er sollte eine starke Persönlichkeit sein dem die Kinder von sich aus Bewunderung und Verehrung entgegenbringen. Dem Gedächtnis kommt während dieser Phase ebenfalls eine ganz besondere Bedeutung zu. Steiner ist der Ansicht, daß man Inhalte, die man zunächst nur mit dem Gedächtnis lernt, später wesentlich besser mit dem Verstand durchdringen kann. Für ihn ist der Verstand eine „Seelenkraft die erst mit der Geschlechtsreife geboren wird“ (Wehnes, 1987, S. 177),und die während dieser Phase vom Kind folglich nicht beansprucht werden kann. Das Erziehungsprinzip dieser Phase heißt „Nachfolge und Autorität“, wobei „Autorität“ sich durch die Verehrung und Bewunderung auszeichnet, die die Waldorfschüler ihrem Lehrer entgegenbringen sollen.
Der Zahnwechsel ist in der Anthroposophie deswegen so bedeutungsvoll, weil der Ätherleib, der ja auch „Bildekräfteleib“ genannt wird, mit dem Zahnwechsel den Körperaufbau abgeschlossen hat und nun seine Kräfte für das Lernen verwenden kann (vgl. 2.4 Der Ich-Leib). Werden Kinder verfrüht zum Lernen aufgefordert führt das zur Überforderung und bringt die Gesamtentwicklung aus dem Gleichgewicht.
Im Verlauf der nun folgenden dritten Entwicklungsphase (14-21 Jahre) entfaltet sich der „Astralleib“, Steiner spricht hier auch von der „zweiten Geburt des Menschen“ (F.-J. Wehnes, 1987, S.177). Abstraktes Denken und freie Urteilskraft sollen im Verlauf dieser Phase ausgebildet werden, folglich heißt der Erziehungsgrundsatz „Förderung des selbständigen Denkens und Urteilens“. Steiner hält es für einen der größten Fehler von einem Menschen übereilt selbständige Urteile zu verlangen, denn „.; um reif zum Denken zu sein, muß man sich die Achtung vor dem angeeignet haben, was andere gedacht haben. Es gibt kein gesundes Denken dem nicht ein auf selbstverständlichen Autoritätsglauben gestütztes gesundes Empfinden für die Wahrheit vorangegangen wäre.“ (Wehnes, 1987, S. 178).
Mit dem Abschluß der dritten Entwicklungsphase soll der junge Mensch Mündigkeit und Freiheit erreicht haben. Er soll sich seiner selbst bewußt geworden sein und so sein „Ich“ gefunden haben. Die Erziehung durch den Lehrer oder Erzieher wird ersetzt durch die Selbsterziehung.
Im Sinne der anthroposophischen Menschenkunde durchlebt jeder Mensch im Laufe seines Lebens diese Entwicklungsphasen. Während jeder Phase wird ein Leib frei, der bestimmte Handlungsweisen verlangt. Es ist dabei von größter Bedeutung das der Erzieher mit Berücksichtigung dieser Entwicklungstheorie auf das Kind einwirkt und es unterstützt. Unangemessene oder unterlassene Förderungen und Forderungen stören die Entwicklung des Kindes und beeinträchtigen es. So ist es verständlich, daß die Arbeit in Waldorfkindergärten sowie der Lehrplan der Waldorfschulen auf diese Entwicklungslehre aufbauen.
5. DIE WALDORFSCHULE
1991 wurde die erste Waldorfschule in Stuttgart gegründet. Der Direktor der Zigarettenfabrik „Waldorf-Astoria“, Emil Molt, stiftete sie für die Kinder seiner Arbeiter und Angestellten. Er wollte eine Schule schaffen, in der Kinder aus verschiedenen Gesellschaftsschichten die Möglichkeit bekommen sollten, sich „Bildung zum Aufstieg zu einer höheren Kultur anzueignen“ (Kayser/Wagemann, 1991, S.41).
In der Bundesrepublik gibt es heute ungefähr 165 Waldorfschulen und 70.000 Waldorfschüler, weltweit sind es etwa 500 Schulen deren Popularität ständig ansteigt. Neben den Schulen gibt es Waldorfkindergärten, Kinderheime, heilpädagogische Wohngemeinschaften, Werkstätten, landwirtschaftliche Betriebe, u.s.w. .
5.1 DIE GANZHEITLICHE ERZIEHUNG
Ganzheitliche Erziehung ist ein wichtiger Grundsatz der Waldorfschulen, welcher aus der anthroposophischen Weltanschauung Rudolf Steiners kommt.
Der Mensch, als ein Teil von Kosmos und Natur ist durch die Reinkarnation in den Lauf von Vergehen, Werden und Weiterentwickeln eingebettet und soll durch seine wiederholte Wiederkehr sein Bewußtsein immer weiter entwickeln und sein geistiges Leben entfalten. Musisches Tun, Rezitieren, Werken Musizieren, Tanzen, Spielen und Eurythmie fördern die Bewußtseinserweiterung und die persönliche Entfaltung und sind daher von großer Bedeutung an der Waldorfschule. Diese Kreativen Tätigkeiten können jedoch nicht beliebig durchgeführt werden sondern sind an festgelegte anthroposophische Vorstellungen geknüpft was Formen, Farben, Materialien und Instrumente angeht. Mit jeder Wiederkehr bekommt der Mensch die Möglichkeit sich weiter zu entfalten und eine höhere Erkenntnisstufe zu erreichen. Diesen Prozeß hat der Lehrer vorrangig vor der Wissensvermittlung zu ermöglichen.
5.2 DER WALDORFLEHRER
Der Waldorflehrer soll nicht nur Wissen vermitteln und erziehen, sondern zusätzlich in die anthroposophische Wahrheit einführen. Er ist von höheren Mächten dazu auserwählt und sieht in den Kindern geistige Wesenheiten die aus der übersinnlichen Welt stammen.
Da Waldorfschüler bis zur Entfaltung des Astralleibes (ab dem 14. Lebensjahr) Bewunderung und Ehrfurcht vor ihrem Lehrer haben sollen, ergibt sich eine besondere Form der Autorität des Erziehers die sich wie folgt darstellt:
„In der Waldorfschule herrscht der Lehrer; er ist König, ab- soluter Monarch und an keine Konstitution gebunden außer seiner Wesenserkenntnis, gegen die es keine Ap- pellation und keine Berufung gibt.“
(Kayser/Wagemann, 1991, S.32)
Der strenggläubige Waldorfpädagoge sieht das Kind als ein formbares Wesen an, dessen karnische Gegebenheiten aus vorhergegangenen Leben festgelegt sind und die er zu entfalten hat:
„.seine heiligste Aufgabe ist es, das im Kinde veranlagte Göttlich-Geistige zu entfalten. Das erzieherische Handeln wird als eine Art religiösen Kultes begriffen, als Vermittlung einer bestimmten meditativen Lebenshaltung.“
(Kayser/Wagemann, 1991, S.32)
Um die Entwicklung des Kindes bestmöglich vorantreiben zu können, werden die Schüler acht Jahre lang in allen Hauptfächern von dem gleichen Lehrer unterrichtet. Darüber hinaus besteht ein enger Kontakt zum Elternhaus und regelmäßige Hausbesuche des Lehrers.
5.3 DER WALDORFLEHRPLAN
Die Gestaltung des Lehrplans für die Waldorfschulen baut auf der Annahme auf, daß das Kind in seiner Individualentwicklung die ganze Menschheitsgeschichte durchlebt:
„Im zehnten Jahr ist das Kind > Germane < , dann > Grieche < , dann absolviert es die Wanderung von Osten bis ans Mittelmeer und wird als zwölfjahriger ein Römer, im dreizehnten ein Ritter und Klosterbru- der, ein Columbus . und ist mit der Geschlechtsreife in seiner Gegenwart angekommen.“
( Kayser / Wagemann, 1991, S. 28 ).
Basierend auf dieser Vorstellung zog Steiner den Schluß, das Unterrichtsphasen und Lebensphasen miteinander korrespondieren müssen. In dem Alter in dem das Kind also „am meisten Grieche ist“, soll das Griechentum im Unterricht behandelt werden. Es gibt keinen klar umrissenen und festgelegten Lehrplan, da die „Lebendigkeit“ des Unterrichts von größter Bedeutung ist. 1978 hat die Stuttgarter Musterschule einen exemplarischen Lehrplan erstellt der praktische Lehrererfahrungen, verschiedene Unterrichtsbeispiele und andere Anregungen geben soll.
Der Lehrplan der Bundesländer ist ohne Bedeutung für die Waldorfschulen, so wiederholt sich der Waldorflehrplan losgelöst von politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen mit jeder Einschulung von neuem: Märchen im ersten Schuljahr, Legenden und Fabeln im zweiten, das alte Testament im dritten, germanische Mythologie im vierten Schuljahr, griechische Mythologie im fünften, das Mittelalter und die römische Geschichte im sechsten und die europäische Expansion nach Übersee im siebten Schuljahr. Im achten Schuljahr werden dann bedeutende Persönlichkeiten behandelt, die Steiner als Vorbilder für die Schüler selbst ausgewählt hat.
Aber nicht nur die Unterrichtsinhalte sondern auch die Lehrmethoden sollen auf die jeweilige Leibesentwicklung des Kindes abgestimmt sein (vgl. 3. Der Entwicklungsgedanke in der Anthroposophie und die Konsequenzen für die Erziehung). In der Zeit in der sich der Ätherleib entfaltet (7-14 Lebensjahr), muß der Lehrer dem Kind anschauliche Bilder bieten, da sonst die Seele Schaden nehmen könnte. Dies möchte ich am Beispiel des Deutschunterrichtes einer ersten Klasse verdeutlichen:
„. die Buchstaben werden malerisch aus einer anschau- lichen Geschichte heraus entwickelt. (...) Die Kinder bekom- men ein Märchen über einen guten und starken K önig er- zählt und lernen eine Strophe über ihn, die sie kräftig im Chor rezitieren. (...) Ein K raftvoller K önig K ommt zu dem K ampf wo die K lingen K lirren und K rachen. So lernen sie was das „K“ für ein Wesen sei. Anschließend malen sie den guten kämpfenden König mit ihren Wachsfarben; die Krone trägt er auf dem Haupt und das Schwert in seiner Hand. Mit seinem nach oben gestreckten Arm und seinem hoch vorne gestellten Fuß scheint er bereit, gleich seine Feinde zu ver- nichten. Am nächsten Tag wird er in dieser Zeichnung ma- gerer und dann noch magerer und schließlich bleibt nur noch das „ K “ übrig.“ (Kayser/Wagemann, 1991, S.30)
Der Grundgedanke ist es beim Schüler Ehrfurcht und Scheu zu erzeugen, um voreiliges Urteilen zu verhindern. Erst mit dem Beginn der Geschlechtsreife soll sich der Schüler vom „ehrfürchtigen Nachfolger“ zum kritisch hinterfragenden Beobachter wandeln. Denn erst von da an ist er reif selbständig zu denken und seine Autöritäten zu bestimmen, „ohne in seinen Bezugswerten erschüttert zu werden“ (Kayser/Wagemann, 1991, S.31).
Anthroposophie als Unterrichtsfach steht nicht auf dem Lehrplan und Rudolf Steiner formulierte in seinem Lehrplan für die Waldorfschulen:
„Man muß sich bemühen, möglichst ohne daß man theo- retisch Anthroposophie lehrt, sie so hineinzubringen, daß sie darinnen steckt.“ (Krämer, 1987, S.153)
Alles Lehren und sämtliche pädagogischen Handlungen beruhen also auf der Grundlage der Anthroposophie.
5.4 DER EPOCHENUNTERRICHT
Der Epochenunterricht an der Waldorfschule soll ein „Instrument zur Ökonomie und Konzentration des Unterrichts“ (Lindenberg, 1975, S. 60) sein. Das Grundmuster des Stundenplans ist von der ersten bis zur letzten Klasse identisch: Jeden Morgen zwei Stunden Hauptunterricht (Epochenunterricht), nach der Pause die Fächer auf die wöchentlich drei bis vier Stunden entfallen und schließlich praktische Inhalte wie Eurythmie, Werken, Handarbeiten, Gartenbau oder ähnliches. Auf diese Weise sollen die Schüler im Idealfall täglich „erst denkend-vorstellend, dann sprechend-übend, dann praktisch-künstlerisch in Anspruch genommen werden.“(Lindenberg, 1975, S. 60).
Im Haupt- oder Epochenunterricht, der mindestens vier Wochen lang das gleiche Thema behandelt, soll ständig Neues erarbeitet werden. Dabei ist es besonders wichtig, daß Gesetzmäßigkeiten, Regeln und Zusammenhänge vom Schüler erkannt werden können. Gewöhnlich wird zu Beginn der Unterrichtseinheit das am vergangenen Tag Erlernte wiederholt. Dann erst kommt es zur Erarbeitung neuer Inhalte, zur Vertiefung in den Unterrichtsstoff und zu Diskussionen. Auf diese Weise erhält der Schüler die Möglichkeit sich intensiv in ein Themengebiet hinein zu versetzen.
5.5 DIE EURYTHMIE
Die Eurythmie wurde 1912 von Rudolf Steiner ursprünglich als Bühnenkunst ins Leben gerufen, um Sprache und Ton durch menschliche Bewegungen sichtbar zu machen. In der Mimik und Gestik zeigt sich ansatzweise die Tendenz der Sprache, Bewegung zu werden, an und für Kinder ist es oft selbstverständlich, daß man sich zur Musik bewegt. Eurythmie will die natürliche kindliche Ausdrucks- und Bewegungsfähigkeit erhalten und wenn möglich sogar verstärken. Die Lust der Kinder sich zu bewegen, zeigt aber auch ihre Bereitschaft alles Bewegende aus der Umwelt aufzunehmen. Die Euryrhmie soll folglich den menschlichen Körper für Ausdruck und Eindruck schulen.
Die ersten Elemente der Eurythmie erinnern an Bewegungsspiele, die Kinder verwandeln sich in buckelige, trippelnde Gnome oder in gewaltige, stampfende Riesen. Später laufen sie geometrische Formen auf dem Boden oder deuten lautliche Gesten wie S, R, C mit den Händen an, während sich der Rhythmus eines Verses auf den Lauf des Fußes anpaßt. Lindenberg schrieb 1975 über die Eurythmie:
„.Wer einen Rhythmus nicht nur hört, sondern ihn läuft, wer eine Tonfolge mit den Händen und den Armen dar- stellt, wer die Lautgebärden eines Gedichtes in Gestik verwandelt, gewinnt ein aktives Verhältnis zu dem, was sonst heute nur passiv aufgenommen und analytisch be- trachtet wird. (...) Es geht bei diesem Umgang mit Musik- stücken oder Werken der Dichtung nicht um die Reali- sierung eines ästhetischen Anspruchs, sondern eben darum, das subjektive Erfassen dieser Werke zu verstärken.“ (S.103-104)
Eurythmie wird in besonders hergerichteten Eurythmieräumen abgehalten. Die Kinder tragen hierbei weite Gewänder und leichte Schläppchen um in ihrer Bewegungs- und Empfindungsfreiheit möglichst uneingeschränkt zu sein.
5.6 MEDIENEINSATZ IM UNTERRICHT AN DER WALDORFSCHULE
Lehrbücher aus den bekannten Verlagen werden an den Waldorfschulen nicht eingesetzt. Die Schüler haben ihre selbst erstellten Epochenhefte als Lehrbücher, auf deren Gestaltung größter Wert gelegt wird. Medien wie Fernseher und Videorecorder finden gewöhnlich keinen Einsatz im Unterricht, da sie dem „ . Weg der Einsicht aus dem Inneren des Menschen heraus widersprechen.“ (Scherer, 1987, S. 147).
6. ERGEBNISPROTOKOLL DER SITZUNG VOM MO 16/11/1998
TOP 1:
Die Referenten zum Thema „Der Erziehungsgedanke in der Anthroposophie“ haben ihren Vortrag mit einer Definition des Wortes „ Anthroposophie“ und einer Biographie Rudolf Steiners begonnen.
TOP 2:
Die Referenten stellten die wesentliche Grundideen Steiners Weltanschauung heraus:
- Die Anthroposophie will ein neues, aus der Sinneswelt nicht beobachtbares, Denkbewußtsein schaffen
- Anthroposophie ist keine Ideologie sondern eine Weltanschauung aus einer anderen Sicht
- Die Anthroposophie will den Erkenntnisweg des geistigen im Menschen zum geistigen im Weltall führen
TOP 3:
Es wird ein Überblick über die Bandbreite anthroposophischer Institutionen wie Waldorfschulen, Lernwerkstätten, Kinderheime, anthroposophischer Heilkunde, landwirtschaftlicher Betriebe und anderer Einrichtungen gegeben.
TOP 4:
Die Entwicklung des Kindes aus Sicht der Waldorfpädagogik wird mit Hilfe einer Tabelle verdeutlicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
TOP 5:
Die Waldorfschule und ihre Merkmale werden dargelegt:
- Es gibt 165 Waldorfschulen mit 70.000 Schülern in Deutschland
- Die Waldorfschule will Bildung vermitteln, unabhängig von der gesellschaftlichen Lebenssituation
- Schüler der Waldorfschule sollen künstlerische und handwerkliche Erfahrungen im Unterricht sammeln
- Der Lehrplan der Waldorfschulen baut auf der Entwicklungstheorie Rudolf Steiners auf
TOP 6:
Die Referenten geben einen kurzen Einblick in den Epochenunterricht, die ganzheitliche Erziehung, der Autoritätsfrage und der Selbstverwaltung der Waldorfschulen.
Da alle von den Referenten angesprochenen Themengebiete in meiner Ausarbeitung vertieft werden, habe ich sie in diesem Ergebnisprotokoll teilweise nur benannt und nicht weiter erläutert.
LITERATURVERZEICHNIS
M. KAYSER, P.-A. WAGEMANN. (1991). Wie frei ist die Waldorfschule. München: Wilhelm Heyne Verlag
F. J. KRÄMER, G. SCHERER, F.-J. WEHNES. (1987). Anthroposophie und Waldorfpädagogik. Annweiler: Verlag Thomas Plöger
C. LINDENBERG. (1975). Waldorfschulen: angstfrei lernen, selbstbe- wußt handeln. Hamburg: Rowolt Taschenbuch Verlag
M. MARTIN. (1987). Anthroposophie, was ist das?. Schaffhausen: Novaliv Verlag AG
H. SCHAUB, K. G. ZENKE.(1995). Wörterbuch zur Pädagogik. München: Deutscher Taschenbuch Verlag
Häufig gestellte Fragen
Was ist Anthroposophie laut dem Dokument?
Das Dokument präsentiert zwei Definitionen von Anthroposophie: eine von Schaub/Zenke (1995), die es als eine von Rudolf Steiner begründete Erkenntnismethode zur Erforschung der real-geistigen Welt und zur Entwicklung der dazu notwendigen Erkenntnisfähigkeit beschreibt. Die andere Definition, aus dem Universal Lexikon (1989), sieht Anthroposophie als eine von Rudolf Steiner begründete philosophische Weltanschauung, die magische Elemente, indische Seelenwanderungslehre und Gnosis vermischt.
Wer war Rudolf Steiner und welche Rolle spielte er in der Anthroposophie?
Rudolf Steiner (1861-1925) war der Begründer der Anthroposophie. Das Dokument beschreibt seinen Lebensweg, von seiner Ausbildung bis zur Gründung der ersten Waldorfschule. Er entwickelte die philosophischen Grundlagen der Anthroposophie und hielt europaweit Vorträge. Das Dokument betont auch, dass Steiner nicht als Autorität missverstanden werden sollte, sondern dass sein Werk kritisch geprüft werden soll.
Was sind die vier Leiber oder Wesensglieder des Menschen in der Anthroposophie?
Die Anthroposophie unterscheidet vier Wesensglieder des Menschen: den physischen Leib, den Äther- oder Lebensleib, den Astral- oder Seelenleib und das Ich. Der physische Leib ist der sichtbare Körper. Der Ätherleib ist für den Aufbau und die Erhaltung des Organismus verantwortlich. Der Astralleib ermöglicht Sinnesempfindungen und Gefühle. Das Ich ermöglicht das Erinnern und logisches Denken.
Welchen Entwicklungsgedanken vertritt die Anthroposophie und welche Konsequenzen hat dies für die Erziehung?
Die Anthroposophie geht davon aus, dass sich die vier Wesensglieder des Menschen nacheinander in sieben Jahreszyklen entwickeln. Dies hat Konsequenzen für die Erziehung, da der Erzieher die Merkmale jeder Entwicklungsstufe berücksichtigen soll. Die Erziehungsgrundsätze variieren je nach Entwicklungsphase: Nachahmung und Vorbild (0-7 Jahre), Nachfolge und Autorität (7-14 Jahre) und Förderung des selbstständigen Denkens und Urteilens (14-21 Jahre).
Was ist die Waldorfschule und was sind ihre Hauptmerkmale?
Die Waldorfschule ist eine Schulform, die auf den anthroposophischen Prinzipien Rudolf Steiners basiert. Zu den Hauptmerkmalen gehören die ganzheitliche Erziehung, ein besonderer Fokus auf künstlerische und handwerkliche Aktivitäten, ein Lehrplan, der sich an den Entwicklungsphasen des Kindes orientiert, der Epochenunterricht, die Eurythmie und der eingeschränkte Einsatz von Medien.
Was bedeutet ganzheitliche Erziehung in der Waldorfschule?
Ganzheitliche Erziehung bedeutet in der Waldorfschule, dass die Entwicklung des Bewusstseins und die persönliche Entfaltung des Kindes gefördert werden, indem musische Tätigkeiten wie Rezitieren, Werken, Musizieren, Tanzen und Eurythmie in den Unterricht integriert werden.
Welche Rolle spielt der Waldorflehrer?
Der Waldorflehrer hat nicht nur die Aufgabe, Wissen zu vermitteln, sondern auch in die anthroposophische Weltanschauung einzuführen. Er soll eine Autoritätsperson für die Schüler sein und die Entwicklung des Kindes bestmöglich fördern, indem er die karmischen Gegebenheiten aus vorhergegangenen Leben des Kindes berücksichtigt.
Was ist der Epochenunterricht an der Waldorfschule?
Der Epochenunterricht ist ein Unterrichtsprinzip, bei dem ein Fach über einen Zeitraum von mehreren Wochen intensiv behandelt wird (zwei Stunden täglich). Ziel ist es, den Schülern die Möglichkeit zu geben, sich intensiv in ein Themengebiet hineinzuversetzen.
Was ist Eurythmie?
Eurythmie ist eine Bewegungskunst, die von Rudolf Steiner entwickelt wurde, um Sprache und Ton durch menschliche Bewegungen sichtbar zu machen. Sie soll die natürliche kindliche Ausdrucks- und Bewegungsfähigkeit erhalten und stärken.
Wie werden Medien in der Waldorfschule eingesetzt?
Lehrbücher aus Verlagen werden nicht verwendet, stattdessen nutzen Schüler selbst gestaltete Epochenhefte. Medien wie Fernseher und Videorecorder werden im Unterricht in der Regel nicht eingesetzt, da sie dem Weg der Einsicht aus dem Inneren des Menschen heraus widersprechen sollen.
- Quote paper
- Amelie Dumas (Author), 2003, Der Erziehungsgedanke in der Anthroposophie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107669