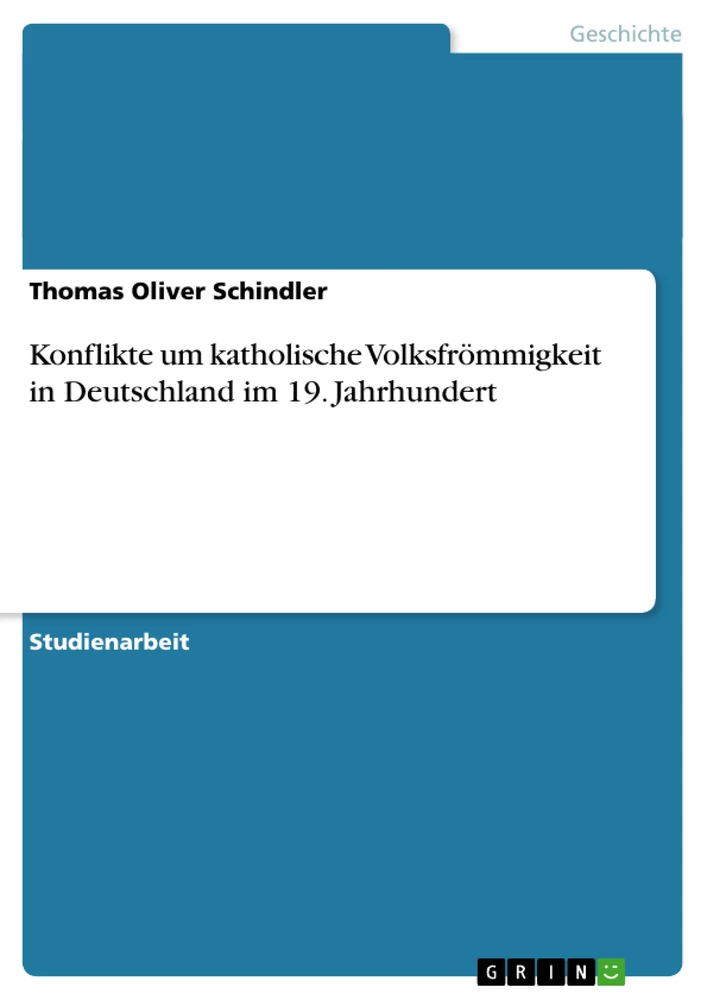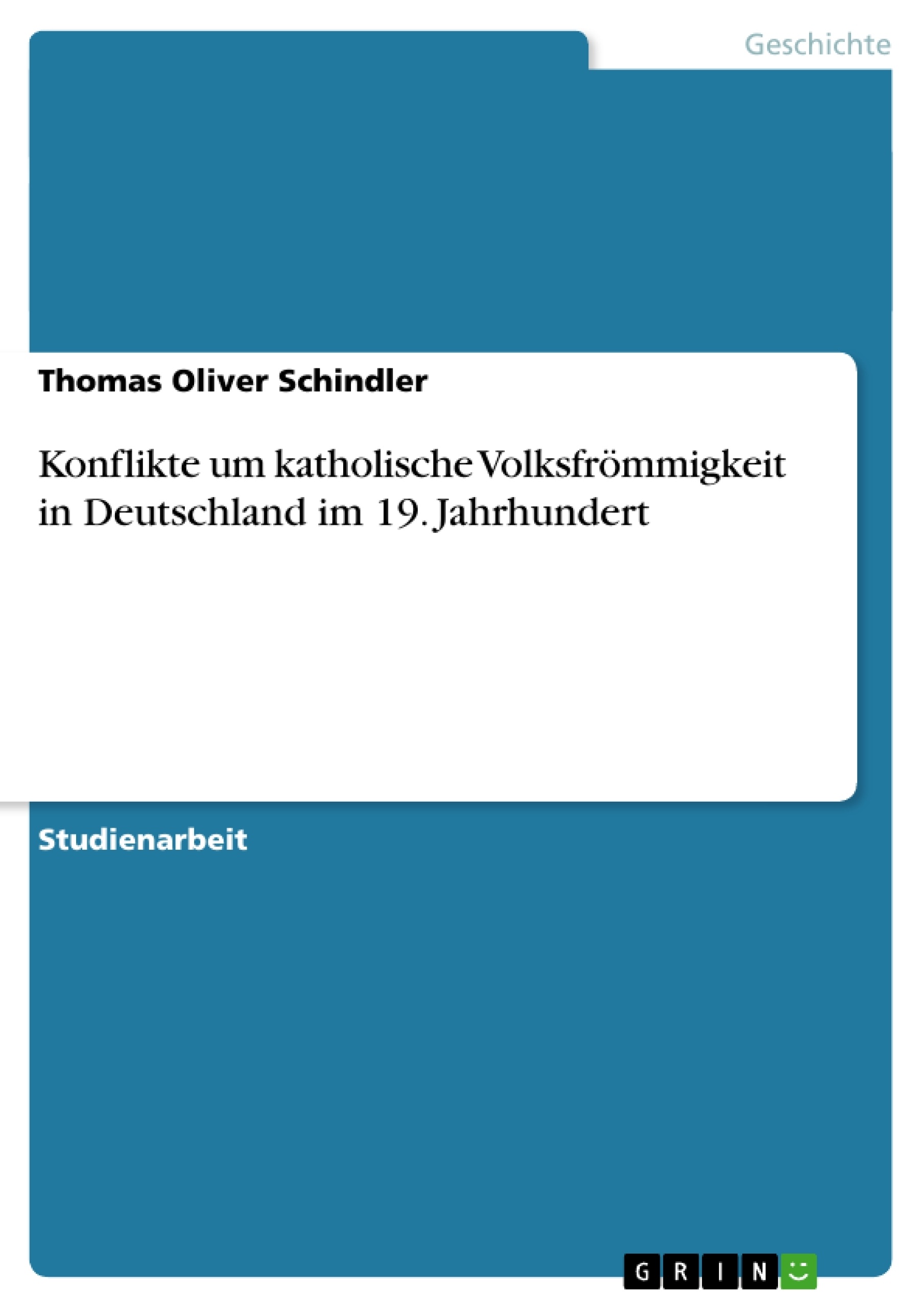Die Leitfrage der Arbeit: `welche Konflikte werden von volksfrömmischen Bewegungen getragen?` wird im folgenden Hauptteil in Beziehung mit den Faktoren Staat, Kirche und Volk gesetzt. Diese Vorgehensweise erscheint mir, aus der Möglichkeit dadurch ähnliche Konfliktursachen zusammenfassen und gliedern zu können, und aufeinander Aufbauende verknüpfen zu können, sinnvoll. Es werden hier also lediglich Konflikte zwischen Volksreligiosität und den jeweiligen Unterpunkten (Staat, Kirche, Volk) diskutiert, nicht aber Konflikte zwischen den Unterpunkten, da sie die Leitfrage nicht enthalten. Beispielsweise wird der Kulturkampf als eigentlicher Konflikt zwischen Staat und Kirche nur in soweit erwähnt, wie er in Beziehung zur Volksreligiosität steht.
Zur Begriffserklärung verwendete Quellen, die in der Einleitung schon erwähnt wurden, sind Werke von Max Weber und Winfried Schulze. Quellen zu den Unterpunkten stellen einerseits die Dokumentensamlung zur Geschichte des Staatskirchenrechts von Ernst Rudolf Huber9, andererseits eine zeitgenössische Eigenpublikation des später noch erwähnten Kölner Erzbischof Vischering10 und ein kritisches Überblickswerk zu Staat und Kirche11 von einem zeitgenössischen evangelischen Theologen12 dar. Die Literatur gliedert sich neben Überblickswerken von Nipperdey und Siemann hauptsächlich nach den Unterpunkten Staat (Blessing, Lepsius), Kirche (Busch, Herres) und Volk (Ulenhusen, Busch, Herres). Die Miteinbeziehung soziologischer (Ebertz), volkskundlicher (Mohrmann) und sozialgeschichtlicher (Schieder) Aufsatzsammlungen ist für den komplexen Zusammenhang mit dem Thema essentiell und bietet wichtige Informationen für jeden Unterpunkt. Vor allem der Literaturbericht von Lönne13 war hilfreich bei der Auswahl der Sekundärliteratur und verschaffte mir zusätzlich einen guten Gesammtüberblick.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Volksreligiosität und Volksfrömmigkeit
- 1.2 Die Unterscheidung von offizieller- und Volksreligiosität
- 1.3 Problemstellung und Erklärung der Vorgehensweise
- 2 Die Beziehung zwischen Staat und Volksreligiosität
- 2.1 Die Opposition zur Moderne
- 2.2 Die Kölner Wirren
- 2.3 Die Milieubildung und der politische Katholizismus
- 2.4 Die Schulaufsicht
- 2.5 Der Kulturkampf
- 2.6 Weitere Konflikte in Zusammenfassung
- 3 Die Beziehung zwischen Kirche und Volksreligiosität
- 3.1 Der Deutschkatholizismus
- 3.2 Die Kontrolle über Kulte und Kongregationen
- 3.3 Der Feiertagsstreit im Rheinland
- 4 Die Beziehung zwischen Volk und Volksreligiosität
- 4.1 Bildung und soziale Lage im Verhältnis zur Volksfrömmigkeit
- 4.2 Die Feminisierung der Volksreligiosität
- 5 Schlußwort
- 6 Quellen
- 7 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Konflikte um katholische Volksfrömmigkeit in Deutschland im 19. Jahrhundert. Sie analysiert die Beziehungen zwischen Volksreligiosität und drei zentralen Faktoren: Staat, Kirche und Volk selbst. Das Ziel ist es, die Konfliktursachen zu identifizieren und zu kategorisieren.
- Die Beziehung zwischen Staat und katholischer Volksfrömmigkeit im Kontext von Säkularisierung und Modernisierung.
- Die Rolle der Kirche in der Kontrolle und Beeinflussung der Volksreligiosität.
- Der Einfluss von Bildung, sozialer Lage und Geschlecht auf die Ausprägung der Volksfrömmigkeit.
- Die verschiedenen Formen des Widerstands und der Konflikte zwischen Volksreligiosität und den etablierten Mächten.
- Analyse spezifischer Konflikte wie des Kulturkampfes und der Kölner Wirren.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung definiert die zentralen Begriffe „Volksreligiosität“ und „Volksfrömmigkeit“, unterscheidet zwischen offizieller und Volksreligiosität nach Max Weber und erläutert die Forschungsfrage der Arbeit: Welche Konflikte werden von volksfrömmischen Bewegungen getragen? Die Methodik der Arbeit, die sich auf die Analyse der Beziehungen zwischen Volksreligiosität und Staat, Kirche und Volk konzentriert, wird dargelegt. Die verwendeten Quellen und die methodische Vorgehensweise werden ebenfalls beschrieben.
2 Die Beziehung zwischen Staat und Volksreligiosität: Dieses Kapitel analysiert die komplexen Beziehungen zwischen Staat und katholischer Volksfrömmigkeit im 19. Jahrhundert. Es beleuchtet den Einfluss der Säkularisierung nach dem Untergang des Reichskirchensystems und die Versuche der Einzelstaaten, das Verhältnis von Staat und Kirche durch Konkordate zu regeln. Der Fokus liegt auf dem Spannungsfeld zwischen staatlicher Autorität und religiöser Praxis der Bevölkerung, indem die Rolle der Revolutionsangst der Fürsten und der daraus resultierenden Konflikte untersucht wird.
3 Die Beziehung zwischen Kirche und Volksreligiosität: Dieses Kapitel befasst sich mit den Interaktionen zwischen der offiziellen Kirche und der Volksreligiosität. Es analysiert die Strategien der Kirche zur Kontrolle von Kulten und Kongregationen, sowie die Herausforderungen durch Bewegungen wie den Deutschkatholizismus. Der Konflikt um Feiertage im Rheinland wird als Beispiel für den Kampf um Deutungshoheit und Einfluss auf das religiöse Leben der Bevölkerung diskutiert. Der Fokus liegt hier auf dem Spannungsverhältnis zwischen hierarchischer Kirchenstruktur und der autonomen Frömmigkeit der Bevölkerung.
4 Die Beziehung zwischen Volk und Volksreligiosität: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von sozialen Faktoren auf die Ausprägung der Volksfrömmigkeit. Es analysiert den Zusammenhang zwischen Bildung, sozialer Lage und der religiösen Praxis der Bevölkerung. Die zunehmende Feminisierung der Volksreligiosität wird als ein weiteres wichtiges Thema behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf der sozialen Einbettung der religiösen Praktiken und der Rolle der Volksreligiosität im Alltag der Menschen.
Schlüsselwörter
Volksreligiosität, Volksfrömmigkeit, Staat und Kirche im 19. Jahrhundert, Kulturkampf, Säkularisierung, Deutschkatholizismus, Konflikte, soziale Lage, Bildung, Gender, Massenreligion, politischer Katholizismus, Kölner Wirren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Konflikte um katholische Volksfrömmigkeit in Deutschland im 19. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Konflikte um katholische Volksfrömmigkeit in Deutschland im 19. Jahrhundert. Sie analysiert die Beziehungen zwischen Volksreligiosität und drei zentralen Faktoren: Staat, Kirche und Volk selbst. Das Ziel ist es, die Konfliktursachen zu identifizieren und zu kategorisieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Beziehung zwischen Staat und katholischer Volksfrömmigkeit im Kontext von Säkularisierung und Modernisierung, die Rolle der Kirche bei der Kontrolle und Beeinflussung der Volksreligiosität, den Einfluss von Bildung, sozialer Lage und Geschlecht auf die Ausprägung der Volksfrömmigkeit, verschiedene Formen des Widerstands und der Konflikte zwischen Volksreligiosität und etablierten Mächten sowie spezifische Konflikte wie den Kulturkampf und die Kölner Wirren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die die zentralen Begriffe definiert und die Forschungsfrage erläutert; ein Kapitel über die Beziehung zwischen Staat und Volksreligiosität; ein Kapitel über die Beziehung zwischen Kirche und Volksreligiosität; ein Kapitel über die Beziehung zwischen Volk und Volksreligiosität; und ein Schlusswort. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Liste der verwendeten Quellen und Literatur sowie Schlüsselwörter.
Welche Begriffe werden zentral definiert?
Zentrale Begriffe sind "Volksreligiosität" und "Volksfrömmigkeit". Die Arbeit unterscheidet zwischen offizieller und Volksreligiosität nach Max Weber.
Welche Konflikte werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert den Kulturkampf und die Kölner Wirren als Beispiele für größere Konflikte. Darüber hinaus werden Konflikte um die Kontrolle von Kulten und Kongregationen, der Feiertagsstreit im Rheinland und die Opposition zur Moderne behandelt.
Welche Rolle spielen Staat, Kirche und Volk in den beschriebenen Konflikten?
Die Arbeit untersucht die komplexen Beziehungen zwischen Staat und katholischer Volksfrömmigkeit im Kontext von Säkularisierung und Modernisierung, die Strategien der Kirche zur Kontrolle von Kulten und Kongregationen und den Einfluss von sozialen Faktoren wie Bildung und sozialer Lage auf die Ausprägung der Volksfrömmigkeit. Das Zusammenspiel dieser drei Akteure und deren Konflikte stehen im Mittelpunkt.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Beziehungen zwischen Volksreligiosität und Staat, Kirche und Volk. Die verwendeten Quellen und die methodische Vorgehensweise werden in der Einleitung beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Volksreligiosität, Volksfrömmigkeit, Staat und Kirche im 19. Jahrhundert, Kulturkampf, Säkularisierung, Deutschkatholizismus, Konflikte, soziale Lage, Bildung, Gender, Massenreligion, politischer Katholizismus, Kölner Wirren.
- Citar trabajo
- Thomas Oliver Schindler (Autor), 2001, Konflikte um katholische Volksfrömmigkeit in Deutschland im 19. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107653