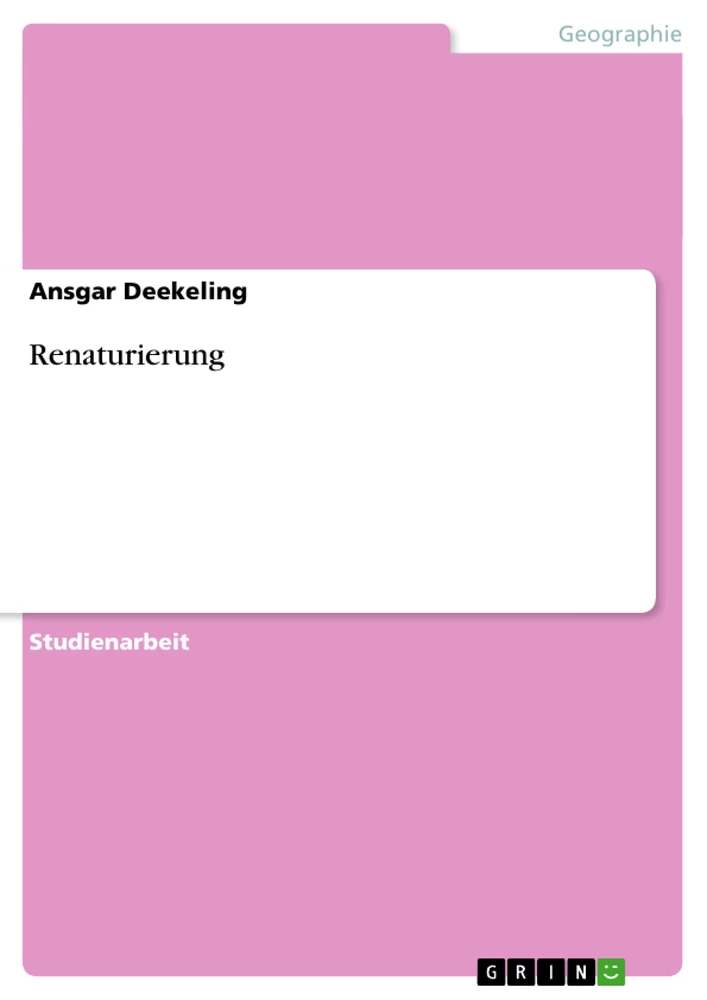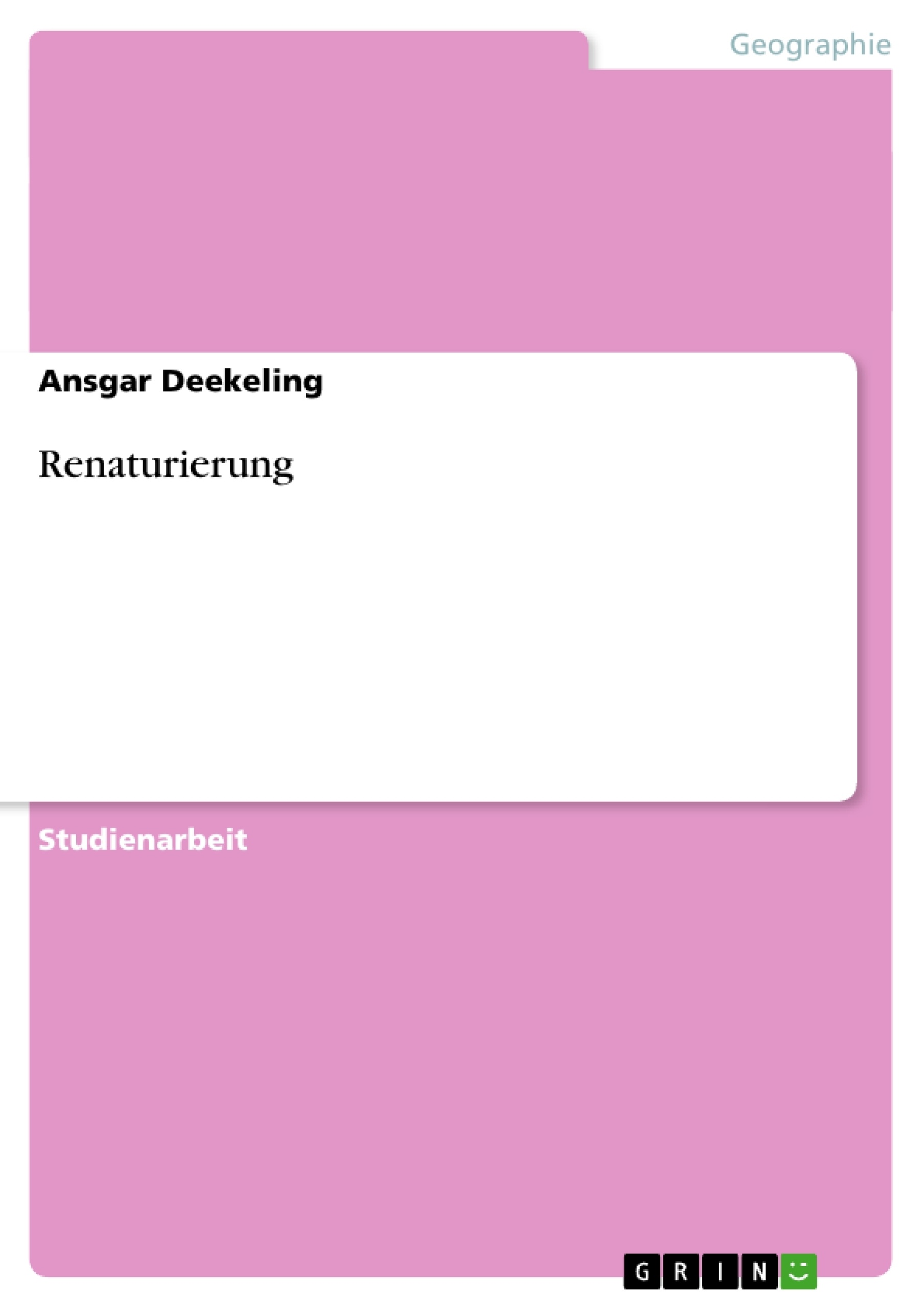Die vorliegende Seminararbeit zum Thema „Renaturierung und Rekultivierung von Sand und Kiesabtragungsflächen“ versucht einen ersten Einblick in dieses breitgefächerte Themenfeld zu geben. In der Bundesrepublik Deutschland wurden 1983 305 Mio. Tonnen Sand und Kies verbraucht( R. Springenschmid in Dingethal 1985, S.14). Von dieser Menge gehen nach Springenschmid (1985) 95% in das Bauwesen und 5% in andere Industriebereiche(eisenschaffende Industrie, Glas-und Keramikindustrie...). Für die Industrie sind diese beiden Rohstoffe von ungemeiner Bedeutung und können nur bedingt(wenn überhaupt) durch andere Rohstoffe ersetzt werden. „Kein anderer Rohstoff wird in so großen Mengen verbraucht wie Sand und Kies“ (Springenschmid in Dingethal 1985 S.22), wobei Deutschland in bezug auf das Vorkommen dieser Rohstoffe relativ reich gesegnet ist. (vgl. Kartenanlage). Problematischer Nebeneffekt der Förderung von Sand und Kies ist der enorme Flächenverbrauch. Nach Peter Könemann(1995) verbraucht die Kiesindustrie durch den Abbau dieser beiden Rohstoffe jährlich 5000 ha Land. Nach Dingethal (1985) werden in NRW 25% der Kiese und Sande gefördert, wobei besonders im Niederrheingebiet, in den Flußniederungen des Rheines und der Lippe, der Weser und der Ems abgebaut wird. Jedoch zeigen sich in vielen Bereichen schon Erschöpfungsanzeichen der Vorkommen. In Anbetracht der enormen Flächeninanspruchnahme, der zunehmend problematischeren Ausweisung von Abbaugebieten kommt der Wiederherstellung solcher Abbauflächen eine enorme Bedeutung in bezug auf die zukünftige Akzeptanz dieses Industriezweiges zu. In diesem Sinne wendet sich der Autor schwerpunktmäßig den Fragestellungen zu, welche sich in direkter Weise mit dem Aktionsfeld und Planungsfeld Renaturierung und Rekultivierung befaßt. Konkret beinhaltet diese Vorgehensweise eine inhaltliche Konzentration auf die im folgenden genannten Bereiche. Den Beginn soll die Klärung der unterschiedlichen Bedeutung der doch so häufig synonym verwendeten Begriffe Renaturierung und Rekultivierung bilden. Welche Leitbilder und Wunschvorstellungen über unseren Lebensraum (gemeinsamen oder getrennten Lebensraum mit Flora und Fauna) vermitteln uns diese beiden Begriffe, welchen Bedeutungswandel und Wertewandel durchliefen diese Begriffe(und letztlich die Frage der Konsequenz für das heutige Handeln)?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung1
2. Begriffe und Leitbilder als Handlungsorientierung
3. Die Problematik des Sand- und Kiesabbaus.
4. Möglichkeiten und Probleme der Renaturierung und Rekultivierung von Sand- und Kiesabgrabungsflächen
4.1 Das nordrhein-westfälische Abgrabungsgesetz
4.2 Grundwasseraufschluß bei Naßabgrabungen.
4.3 Renaturierungsmaßnahmen bei Naßabgrabungen..
4.4 Fallbeispiel: Rekultivierung 6 - Seen - Platte in Duisburg
5. Renaturierung von Trockenabgrabungen.
6. Literaturverzeichnis.
Tabellenverzeichnis
1. Möglichkeiten der Biotopgestaltung
Abbildungsverzeichnis
1. Gliederung und Ablauf einer Landschaftsplanung zur Rekultivierung
2. Schematische Darstellung der Grundwasserspiegelbeeinflussung durch Naßgrabungen
1. Einleitung
Die vorliegende Seminararbeit zum Thema „Renaturierung und Rekultivierung von Sand und Kiesabtragungsflächen“ versucht einen ersten Einblick in dieses breitgefächerte Themenfeld zu geben. In der Bundesrepublik Deutschland wurden 1983 305 Mio. Tonnen Sand und Kies verbraucht( R. Springenschmid in Dingethal 1985, S.14). Von dieser Menge gehen nach Springenschmid (1985) 95% in das Bauwesen und 5% in andere Industriebereiche(eisenschaffende Industrie, Glas-und Keramikindustrie...). Für die Industrie sind diese beiden Rohstoffe von ungemeiner Bedeutung und können nur bedingt(wenn überhaupt) durch andere Rohstoffe ersetzt werden. „Kein anderer Rohstoff wird in so großen Mengen verbraucht wie Sand und Kies“ (Springenschmid in Dingethal 1985 S.22), wobei Deutschland in bezug auf das Vorkommen dieser Rohstoffe relativ reich gesegnet ist. (vgl. Kartenanlage). Problematischer Nebeneffekt der Förderung von Sand und Kies ist der enorme Flächenverbrauch. Nach Peter Könemann(1995) verbraucht die Kiesindustrie durch den Abbau dieser beiden Rohstoffe jährlich 5000 ha Land. Nach Dingethal (1985) werden in NRW 25% der Kiese und Sande gefördert, wobei besonders im Niederrheingebiet, in den Flußniederungen des Rheines und der Lippe, der Weser und der Ems abgebaut wird. Jedoch zeigen sich in vielen Bereichen schon Erschöpfungsanzeichen der Vorkommen. In Anbetracht der enormen Flächeninanspruchnahme, der zunehmend problematischeren Ausweisung von Abbaugebieten kommt der Wiederherstellung solcher Abbauflächen eine enorme Bedeutung in bezug auf die zukünftige Akzeptanz dieses Industriezweiges zu. In diesem Sinne wendet sich der Autor schwerpunktmäßig den Fragestellungen zu, welche sich in direkter Weise mit dem Aktionsfeld und Planungsfeld Renaturierung und Rekultivierung befaßt. Konkret beinhaltet diese Vorgehensweise eine inhaltliche Konzentration auf die im folgenden genannten Bereiche. Den Beginn soll die Klärung der unterschiedlichen Bedeutung der doch so häufig synonym verwendeten Begriffe Renaturierung und Rekultivierung bilden. Welche Leitbilder und Wunschvorstellungen über unseren Lebensraum (gemeinsamen oder getrennten Lebensraum mit Flora und Fauna) vermitteln uns diese beiden Begriffe, welchen Bedeutungswandel und Wertewandel durchliefen diese Begriffe(und letztlich die Frage der Konsequenz für das heutige Handeln) ? An diese Vorstellungen anknüpfend gilt es kritisch anhand von Beispielen(realisiert) und Planungsbeispielen die Konsequenzen zu erläutern, welche die Verwirklichung unterschiedlicher Leitziele beim Umgang mit industriellen Abgrabungsflächen haben. In diesem Rahmen gilt es die Möglichkeiten und Chancen zu erläutern, welche der Naturschutz in bezug auf industrielle Abgrabungsflächen, hier im kleineren Maßstab des Baggersees oder der Trockenabgrabungsfläche, bietet und in Zukunft bieten könnte. Auch hier sollen Beispiele der Veranschaulichung dienlich sein. Ein weiteres Kapitel in dieser Arbeit soll den Planungsablauf einer Abgrabung und die gesetzlichen Bestimmungen für NRW(Abgrabungsgesetz NRW) erläutern. Ausgegrenzt oder nur punktuell angeführt werden in dieser Arbeit die ökonomischen Aspekte und wirtschaftliche Nutzung des Rohstoffs Sand und Kies, d.h. nur in Hinblick auf die Kosten-Nutzen Rechnung betreffend der Renaturierung- und Rekultivierungsmaßnahmen wird kurz auf diesen Bereich eingegangen. Gleichfalls spartanisch werden die geologischen Aspekte in dieser Arbeit nur Niederschlag finden, d.h. im Abschnitt der Planung, welcher sich mit den Einflüssen auf das Grundwasser und der Konzeption des Sees als zunächst künstliches Biotop, das in Austauschprozessen mit seiner Umgebung steht, befaßt.
2. Begriffe und Leitbilder als Handlungsorientierung
Wie in der Einleitung schon angedeutet wandelten sich die Vorstellungen über den Umgang mit ehemaligen Sand- und Kiesabbauflächen. Nicht zuletzt die zunehmende Inanspruchnahme von Flächen durch die industrielle Nutzung des Menschen, die weitesgehende Kultivierung der uns umgebenden Landschaft und die Vernichtung ihrer „natürlichen“ und „ursprünglichen“ Ausprägung vervielfältigte auch die zerstörerischen Nebenwirkungen. Im Rückgang der Artenvielfalt, der Entwicklung Roter Listen als Quantifizierungsmerkmal zerstörter und bedrohter Tier- und Pflanzenarten finden wir heute Szenarien, an deren Erschöpfungsketten letzten Endes das „WIR“ als Opfer und Täter zugleich steht.
In der Verwendung von Begriffen deuten sich Prozesse der Sensibilisierung an, die Grenzen einer nur auf den Menschen hin gestalteten bedürfnisorientierten Nutzung und Gestaltung der Natur aufzeigen. Ansprüche der Tierwelt Bedeutung beizumessen und innerhalb industrieller Nutzung von Natur auch der Folgenutzung Natur Nachdruck zu verleihen, scheint hierbei von besonderer Bedeutung.
„Unter dem Begriff „Rekultivierung“ kann man alle Maßnahmen zusammenfassen, die notwendig sind, um solche Teilräume der Kulturlandschaft erneut wirtschaftlich und landwirtschaftlich ansprechend herzurichten und zu entwickeln, deren Oberflächenbereich durch mehr oder weniger großflächige Erdbewegungen zwecks Gewinnung erdbürtiger Roh- und Wertstoffe soweit umgelagert wird, daß ein neues Relief entsteht, auf dem neue Standorte mit anderen, neuen Nutzungsmöglichkeiten hergerichtet werden müssen“ (G. Darmer 1973, S.9). Diese Definition verfaßte Gerhard Darmer 1973 und beschreibt den Prozeß der Rekultivierung als Stufenprozeß mit den Begriffen „Wiedernutzbarmachung“ (erste Stufe) und „Wiederurbarmachung“ (zweite Stufe). Ziel dieser Maßnahmen ist es, die verursachten Schäden so zu kompensieren, daß spätere Nutzungen dieser Flächen wieder möglich werden. Im Speziellen bestimmt die vorherige Nutzung auch die Folgenutzung, wenn dies im Rahmen des Machbaren (Finanzierbaren ?) liegt. Darmer verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff der Renaturierung als unverzichtbaren Teil einer ökologischen Orientierung. Eine „...durch ökologische Leitbilder gelenkte Rekultivierung...“ bildet für Darmer den Maßstab der Orientierung. Es zeigt sich bei Darmer (1973) schon die Relevanz „ökologischer Leitbilder“ als Handlungsorientierung, jedoch verortet er diese Leitbilder noch unter dem Begriff der Rekultivierung, was trotz der Betonung ökologischer Leitbilder die Stoßrichtung vorgibt, d.h. „Inwertsetzung“ vernutzter Flächen zwecks Folgenutzung. Hermann-Josef Bauer grenzt Rekultivierung schon deutlicher vom Begriff der Renaturierung ab. „Eine Rekultivierung verhindert die natürliche Sukzession und damit die Entwicklung zu Refugien und Regenerationszellen gefährdeter Arten“ (H.-J. Bauer 1987, S.12). Er verweist später noch auf die möglichen unterschiedlichen Folgewirkungen durch die beiden unterschiedlichen Betrachtungen(Begriffe). „Daher können Naturbiotope aus 2. Hand nicht durch Rekultivierung geschaffen werden, sondern gerade die Instabilität der Biotope im Zuge der Renaturierung ist ein positiver Wert der Ausgrabungsbiotope“ (H.-J. Bauer 1987, S. 12). Dies bedeutet im Klartext, daß Rekultivierung im Sinne gesetzlicher Bestimmungen dem komplexen Gefüge einer Biotopgestaltung viel zu undifferenziert ist, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Ein beispielsweise durch freie Ansiedlung entstandenes Biotop könnte sogar durch die formelle Zielanwendung im Sinne einer Rekultivierung, z.B. gezielte Bepflanzung wieder zerstört werden. Naturschutz verlangt beizeiten einfach nur Zurücknahme menschlicher Aktivität. Das Ziel der Renaturierung bietet unter seinem Dach vielfältigere Möglichkeiten als dies bei der Rekultivierung der Fall wäre. Der wiederhergestellte Landschaftsteil muß sich „...nahtlos in eine weitgehend einförmig geordnete und technisch aufbereitete Landschaft einfügen.“ betont Peter Könemann(1995, S.77) als Charakterristikum von Rekultivierung. Abweichend von diesem Ziel bedeutet Renaturierung die Möglichkeit, gezielt Naturschutzanliegen als Folgenutzung im Sinne von Artenvielfalt, Artenschutz zu verwirklichen. In diesem Zusammenhang darf nicht ausgespart bleiben, daß solche Begriffe ebensogut Kontroversen zwischen verschiedenen Interessengruppen charakterisieren können, was z.B. im Verhältnis der Landwirtschaft zum Naturschutz sehr prägnant zum Ausdruck kommt.
3. Die Problematik des Sand- und Kiesabbaus
Jährlich werden in der Bundesrepublik Deutschland 300 Millionen Tonnen Kies und Sand verbraucht. Jährlich werden durch den Abbau dieser Rohstoffe 5000 Hektar an Landfläche verbraucht und damit verändert(Könemann 1995, S. 74). Der Kies- und Sandabbau geht einher mit der Zerstörung der „natürlichen“ Flächenstrukturen und deren Nutzungen. Die Vegetation wird abgetragen, ebenso der Mutterboden, der A-und B- Horizont; es werden gegebene Reliefformen verändert, die Tierwelt verscheucht und ihres Lebensraumes beraubt. Die räumliche Nutzung durch die Kies- und Sandindustrie(Tagebau) zerstört somit flächenhaft Ökosysteme in ihrer komplexen Struktur. An dieser Schnittstelle an der Natur entstehen nun „Sekundärbiotope“, die durch die verschiedenen Vorstellungen und Leitbilder unterschiedliche Gesichter erhalten. Es bietet sich die Möglichkeit, diese „verbrauchten“ Gebiete dem Naturschutz zuzuführen. Auf der Grundlage dieser Flächen können durch gezielte Renaturierungsmaßnahmen oder auch durch „simples“ Unterlassen jeglicher Maßnahmen wertvolle Biotope entstehen; es bietet sich damit eine Möglichkeit zur Bildung von Rückzugs- und Regenerationsräumen für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Jedoch muß angemerkt werden, daß diese neu entstehenden Biotope grundsätzlich eine andere „Qualität“ besitzen als die ursprüngliche Form. Die massiven Eingriffe in den Naturhaushalt, d.h. die Abtragung des Bodens und der Oberfläche zerstören weitesgehend das Gefüge dieses Raumausschnittes. als besonders gravierend erweisen, eher erwiesen sich somit Eingriffe in sensiblen und noch relativ unberührten Gebieten wie z.B. Flußauen, Mooren u.ä. .Gleiches gilt natürlich auch für die Wiederherstellung von landwirtschaftlicher Nutzfläche, die durch den Abtrag und der Vermischung der oberen Bodenschichten nicht mehr so fruchtbar sein wird. Nach Leser „..kann nicht erwartet werden, daß die Landschaft nach der Rekultivierung ertragreicher ist als vorher...“(H. Leser 1978, S. 364). Konkret bedeutet dies, daß Abgrabungen in Naturschutzgebieten und anderen sensiblen Bereichen unterbleiben müssen. Sekundärbiotope sind wertvoll, können jedoch Primärbiotope nur unzureichend ersetzen.
4. Möglichkeiten und Probleme der Renaturierung und Rekultivierung von Sand- und Kiesabgrabungsflächen
Die einführende Problematisierung des Themas im zweiten Kapitel deutete schon auf die Schwierigkeiten solcher Maßnahmen hin. In erster Linie gilt es natürlich unsere gefährdeten Primärbiotope zu erhalten, aber es zeigt sich in vielen Untersuchungen über ehemalige Abtragungs-Abgrabungsgebiete die enorme Bedeutung dieser Flächen für die Pflanzen- und Tierwelt[1]. In bezug auf Sand- und Kiesabgrabungenen unterscheiden wir zwischen zwei Typen, zum einen den der Trockenabgrabung(ohne Freisetzung des Grundwassers) und zum anderen den Typ des Naßabbaus(Freisetzung/Offenlegung des Grundwassers). Aus beiden Abbauarten können sich als Resultate unterschiedliche Biotope entwickeln, bzw. lassen sich unterschiedliche Varianten von Biotopen „herstellen“.
Bevor in dieser Arbeit anhand von Planungs-Beispielen Renaturierungsmaßnahmen anschaulich gemacht werden, sollen kurz die rechtlichen Grundlagen erläutert werden. Dem anschließend soll ein der Literatur entnommener Ablaufplan zur Rekultivierung die Umsetzung solcher Gesetze und die gleichzeitige Einbeziehung der Wissenschaft und der Landschaftsplanung praxisnah veranschaulichen.
4.1 Das nordrhein-westfälische Abgrabungsgesetz
Am 23.11. 1979 wurde in NRW das Abgrabungsgesetz verabschiedet, bzw. bekanntgegeben. Es sollte eine gesetzliche Lücke schließen, durch welche Unternehmer jahrzehntelang der Landschaft Schaden zufügen konnten, ohne dafür Gegenleistungen (Renaturierung- Rekultivierungmaßnahmen der Abgrabungsflächen) gegenüber der Allgemeinheit und der Natur zu erbringen.. Könemann (1995) faßt das Hauptanliegen dieses Gesetzes in vier Kernsätzen zusammen.
„Nach § 3 Abs. 3 sind „die Belange der Landschaftsverordnung in der Regel beachtet, wenn durch die Nutzung und Herrichtung des Abbau- und Betriebsgeländes
1. der Naturhaushalt durch Eingriffe in die Tier- und Pflanzenwelt, die Grundfwasserverhältnisse, das Klima und den Boden nicht nachhaltig geschädigt wird,
2. eine Verunstaltung des Landschaftsbildes auf Dauer vermieden wird,
3. Landschaftsteile von besonderen Wert nicht zerstört werden und
4. den Entwicklungszielen oder besonderen Festsetzungen eines auf Grund des Landschaftsgesetzes erlassenen rechtsverbindlichen Landschaftsplans nicht nachhaltig und erheblich zuwidergehandelt wird“(Könemann 1995, S.77). Der Unternehmer wird durch dieses Gesetz verpflichtet, die von ihm zerstörte Fläche wiederherzurichten, bzw. sie gemäß einer betimmten Folgenutzung entsprechend zu hinterlassen. Darüber hinaus ist der Unternehmer durch dieses Gesetz in Form einer Sicherheitsleistung, die er zu hinterlegen hat, auch materiell zu Kompensationsmaßnahmen gebunden. Die Art der Maßnahmen richten sich zum einen an den Richtlinien des Landschaftsplanes, zum anderen finden sich in den „Technischen Richtlinien zum Abgrabungsgesetz(Runderlaß des Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 1.1.1984)“ Empfehlungen zur Gestaltung. Nach Könemann (1995, S.76) ist das „...Ziel dieser Maßnahmen...; wieder eine landschaftsökologisch intakte Landschaftseinheit entstehen zu lassen und der neugestalteten Fläche eine konkrete Funktion zu geben.“
Eine entscheidendenes Instrument des Tagebaus mit seiner problematischen Frage nach den Wiederherstellungsmöglichkeiten bietet die Landschaftsplanung.
Abb. 1: Gliederung und Ablauf einer Landschaftsplanung zur Rekultivierung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Darmer, Gerhard 1979: Landschaft und Tagebau. Bd.2. Hannover. S.132
Darmer(1979) verbindet in diesem Ablaufschema die Landschaftsplanung mit mit der Rekultivierungsplanung. „Die Landschaftsplanung ist in ihrer dargestellten Konzeption...also gleichberechtigt und -geachtet in den Planungsprozeß zum Wiederaufbau von Tagebaugelände zu integrieren“(Darmer 1979, S.133). Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise bietet sich in den möglichen Abstimmungen zwischen Unternehmen und Behörden. Die wiederhergestellten Flächen, für welche Nutzungen diese jetzt im speziellen auch vorgesehen sein mögen, können durch diese Vorgehensweise im Raum sinnvoll verortet werden. Praktisch bietet sich dadurch die Möglichkeit, z.B. Baggerseen effektiv in eine Nutzungskonzeption einzugliedern, die weiträumiger ist als der bloße Tellerand einer Kommune.
Das abgebildete Schema zeigt sehr deutlich die zweckmäßigen, zu erfüllenden Verpflichtungen auf. Die Rekultivierungsmaßnahme beginnt nicht erst mit der ausgebeuteten Landfläche oder Wasserfläche, sondern muß von Anfang an planerisch und wissenschaftlich fundiert begleitet sein. Darmer(1979) betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung interdiziplinären Arbeitens. Nur die Einmischung verschiedener Ressorts ermöglicht Objektivität in der Sache, fördert die Umsicht beim planerischen Umgang mit dem immer knapper werdenden „Naturgütern“. Ausgehend von der Erfassung des anvisierten Abbaugebietes (Zustand, Nutzung usw.), muß dieses genau ökologisch erfaßt(interdiziplinär) und bewertet werden. Unter Berücksichtigung dieser „Grundlagen“ gilt es nun, Vorteile und Nachteile abzuwägen. Die wissenschaftliche Grundlage dient zudem als Basis für die zu planenden Rekultivierungsmaßnahmen. Die Landschaftsplanung bringt hierbei Auflagen und „Zielvorstellungen“(z.B. Naturschutz) in den Prozeß hinein. Diese müssen im Interessenausgleich abgestimmt(z.B. Finanzierbarkeit/Kosten contra Nutzungsansprüchen) werden. Die planerischen Ausführungen, rechtlich geprüft und politisch entschieden, müssen bei ihrer Realisierung staatlicher Kontrolle unterliegen[2]. Das Schaubild summiert somit eine komplexe Struktur, in der ökologische, wirtschaftliche, politische, verwaltungstechnische Systeme ineinandergreifen. Den Sekundärbiotopen vor unserer Haustür kommt damit zumindest planerischer Aufwand und Bedeutung zu. Diese Ebene verlassend behandeln die folgenden Abschnitte Modelle und (realisierte )Beispiele.
4.2 Grundwasseraufschluß bei Naßabgrabungen
Wir alle kennen den sommerlichen Baggersee als Erfrischung und zum Zwecke der Naherholung ausgebaut als Tummelplatz für gestreßte Städter. Der Wasserkörper, der hier durch die Ausbeutung von Sand und Kieslagerstätten entsteht ist ein künstliches Gewässer. In den vorangegangenen Abschnitten und Kapiteln wurden schon die Probleme solcher künstlichen Aufschlüsse (Baggerseen) angesprochen.
Die Abgrabung von Sand und Kies setzt in großen Mengen Grundwasser frei, also Wasser, welches zuvor unter völlig anderen Bedingungen stand. Die Freisetzung des Grundwassers bedeutet zu aller erst einmal eine potentielle Gefährdung, da der schützende Schichtmantel zerstört, das Wasser gänzlich anderen oberflächenbestimmten Einflußfaktoren und gegebenfalls Belastungen(z.B. durch Einwehung, menschliche Nutzung) unterworfen wird. Zudem entstehen „Zwischen dem Baggersee und dem umgebenden Grundwasserkörper zunächst eine enge Wechselbeziehung“(DVWK 1992, S.8.). Eine Belastung des Baggersees bedeutet damit gleichzeitig auch eine mögliche Gefährdung der Grundwasserqualität. Das Verhältnis zwischen Baggersee und Grundwasser muß dementsprechend schon in der Planung untersucht werden, um spätere negative Folgen zu vermeiden. Der Grundwasserstrom spielt bei der Anlage des Sees eine ebenso gewichtige Rolle. Der künstliche See steht im permanenten Austausch mit dem Grundwasserstrom, welcher in Richtung des natürlichen Gefälles fließt. Nach Hermann Trier(in Dingethal 1985) pendelt sich der Wasserspiegel des Baggersees auf horizontaler Ebene ein(vgl. Abb.2. S.10). Die Folge ist, daß „dadurch ..das Grundwasser am grundwasseroberstromigen Ufer abgesenkt, am grundwasserunterstromigen Ufer aufgehöht“ wird(Trier in Dingethal 1985, S.64.). Dies kann nach Trier (in Dingethal 1985) zu Problemen führen, wenn der Grundwasserstrom „relativ“ oberflächenah fließt, d.h. bei erhöhtem Wasserstand kann es sehr schnell zu „Geländeüberflutungen“ kommen.
Abb. 2: Schematische Darstellung der Grundwasserspiegelbeeinflussung durch Naßgrabungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Dingethal, F.J.u.a.(Hrsg.) 1985: Kiesgrube und Landschaft. 2.Aufl. Hamburg, Berlin. S.64.
Solchen Problemen gilt es bei der Anlage des Sees und seiner Ausstattung, z.B. mit Flutungs-Abflußsystemen entgegenzuwirken. Nach Könemann sollten insbesondere „große Baggerseen ...mit ihrer Längsachse senkrecht zur Grundwasserfließrichtung liegen. Hierdurch wird die Relation von oberstromiger Uferlinie und Wasserkörpervolumen günstig beeinflußt“(Könemann 1995, S.125). Des weiteren wird das Austauschverhältnis mit dem Grundwasser verbessert, was sicherlich in bezug auf die Wasserqualität des Sees(weniger des Grundwassers) positive Wirkung haben dürfte. Mit zunehmender Alterung nimmt nach Trier(in Dingethal 1985) auch die Durchlässigkeit des Sees ab, da durch Nährstoffanreicherung Schwebeteilchen im Wasser die Seewände verstopfen und damit die Porendurchlässigkeit verringern(Verdichtung der Poren).
Die Folgen sind Nährstoffanreicherungen im See, was in der extremsten Form in der Literatur als „Badewanneneffekt“ bezeichnet wird(Trier in Dingethal 1985, S.67). Die Qualität des Wasser und damit der Zustand des Gewässers nimmt auch entscheidenen Einfluß auf die Möglichkeiten der Renaturierung von Abgrabungsflächen, bzw. von Baggerseen. Das erstrebenswerte Ziel jeder Renaturierung ist der nährstoffarme (oligotrophe) See. Dabei handelt es sich nach Albert Hamm (in Dingethal 1985, S.71ff) um einen See, welcher bis zum Gewässergrund durchlichtet ist, dessen Bodenbewuchs überwiegt und in dem die Zehrschicht des Sees sehr viel Sauerstoff(über 70%-Sättigung) bindet. Darüber hinaus zeichnet sich dieser klare See nach Hamm durch wenig Phytoplankton(Merkmal nährstoffreicher Seen) aus. Damit einhergehend ist der geringe Phosphatgehalt ein wichtiges Merkmal nährstoffarmer Seen. Im nächsten Abschnitt sollen nun anhand von Renaturierungsbeispielen und Modellen Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.
4.3 Renaturierungsmaßnahmen bei Naßabgrabungen
Die Folgenutzung Naturschutz für Baggerseen gewinnt in zunehmenden Maße, in der auch der Flächenverbrauch steigt, an Bedeutung. Die Ziele des Naturschutzes liegen in der Erhaltung unserer Tier- Pflanzenwelt und im Schutz der Artenvielfalt, die diese Natur ausmacht. Baggerseen können in diesem Sinne eine wichtige Aufgabe erfüllen, wenn sie geschützt und in unterschiedlicher Weise gestaltet und/oder der Sukzession überlassen werden, d.h. die Vielfältigkeit der Gestaltung ermöglicht die Verschiedenartigkeit ihrer biologischen Ausstattung. Es muß in diesem Zusammenhang aber auch auf die Grenzen von Renaturierung hingewiesen werden. Nach H.-J. Bauer (1987, S19) „..sind viele als anspruchsvoll geltende Arten in der Lage, verhältnismäßig schnell neue Lebensräume zu besiedelnsoweit ein geeignetes Habitatangebot besteht. Andererseits fällt immer wieder auf, daß zu erwartende Arten fehlen, obwohl für sie günstige Ausstattung des Lebensraumes vorliegt.“ Die hoffnungsfrohe Ansicht der Sand- und Kiesindustrie, die Kompensation von Eingriffen(„Verritzung der Landschaft“) durch Renaturierung zu bewerkstelligen muß man kritisch bewerten. Im Vergleich zu H.-J. Bauer klingen die „Renaturierungstöne“ aus dem Lager der Kiesindustrie ein wenig anders. „Man sollte daher bei der Ausweisung der Schutzgebiete, die nicht unbedingt erhalten bleiben müssen, den Hinweis aufnehmen, daß eine Entkiesung möglich bleibt, wenn im Zuge der Rekultivierung und der Renaturierung die Wertigkeit des betreffenden Schutzgebietes wiederhergestellt werden kann oder im Sinne des Naturhaushaltes sogar zu steigern ist.“ Weiter heißt es, „Zum anderen haben wir gemeinsam, Industrie und Behörden des Landschaftsschutzes, gelernt und sind somit in der Lage, durch eine zweite Generation von Herrichtungsplätzen Sekundärbiotope zu verschaffen, die diesen bedrohten Pflanzen und Tieren erst den Lebensraum verschaffen, den sie benötigen“(Hans-Gerd Rauff 1987, S.21). Die Sand- und Kiesindustrie als ökonomisch ausgereifte Naturschützer der zweiten Generation von Kiesunternehmern, die für bedrohte Pflanzen und Tiere den Lebensraum erschaffen, den sie „unter normalen“ Bedingungen unserer Kulturlandschaft nicht bekämen, ist das neue Image, das es zu pflegen gilt. Solche Ansprüche gilt es zu relativieren. Nach H.-J. Bauer (1987, S.11) bedeutet „Jeder Eingriff durch den Menschen in die naturnahen Ökosysteme eine unnatürliche Unterbrechung der Struktur und Funktion von Ökosystemen bis zu einer totalen Zerstörung der jeweiligen Landschaftsstrukturen.“ Sekundärbiotope sind gegenüber dem Verlust von Primärbiotopen immmer nur ein begrenzter Ersatz, der aber vielfältige Ansätze und Möglichkeiten bietet.
Künstlich gestaltete Wasserflächen können bei entsprechender Ufer- und Böschungsgestaltung ähnliche Standortvoraussetzungen bieten wie ehemals unkorregierte Flußläufe.(Könemann 1995, S. 80). Im Laufe der Jahre wechseln auch die Standortbedingungen(z.B. Vegetationsbedeckung des Bodens, Wasserqualität), so daß mit fortschreitenden Sukzessionsstadien Verhältnisse entstehen, wie wir sie von Altwasserarmen naturnaher Flußläufen kennen.(vgl. Könemann 1995). Wie schon erwähnt entscheidet die strukturelle Vielfalt und Unregelmäßigkeit im Uferbereich (Flachwasserzonen, Inseln, Halbinseln, Lagunensysteme, usw.) über die Möglichkeiten zur Ansiedlung möglichst verschiedener Tierarten. Hierbei gilt es besonders solchen Tierarten Lebensräume zu schaffen, deren Bestände gefährdet sind und deren Lebensräume zunehmend verengt wurden und werden. Diese Betrachtungsweise ist gewollt qualitativ, d.h. nicht die Masse (der Generalisten) macht das Biotop, sondern die Unterschiedlichkeit. Für die Planung ergibt eine solche Orientierung natürlich die Pflicht zur Sorgfältigkeit (vgl. Abb. 1) in der Gestaltung von Vielseitigkeit. Flachwasserzonen bieten nach Helmut Ranftel (in Dingethal, 1985 S.148-157) unterschiedlichen Watvögeln(z.B. Flußregenpfeifer), Gründelenten, Löffelenten Fischreiher usw. Lebensraum. Eisvögel und Uferschwalben hingegen bevorzugen nährstoffarmes Gewässer, nisten in Steilwänden aus sandigen und tonigen Material. Tiefere Bereiche werden dagegen von Tauchvögeln, z.B. dem Haubentaucher, den Tauchenten als Nahrungsraum genutzt. Der Flußregenpfeifer nistet auf vegetationsarmen Kies- und Sandflächen, der Haubentaucher andererseits im Röhrichtgürtel. Darüber hinaus dienen künstliche Wasserflächen Zugvögeln und Überwinterungsgästen (z.B. der Graugans) Quartiermöglichkeiten. Neben verschiedenen Vogelarten bilden WasserInsekten, Amphibien und Reptilien weitere gefährdete Tiergruppen, die bei entsprechender Biotopgestaltung Lebensraum finden. Tabelle Nr. 1 verdeutlicht noch einmal den Zusammenhang zwischen gezielter Ufergestaltung und der Ansiedlung verschiedener Tiergruppen. Die Wasserqualität spielt hier als Grundbedingung eine wichtige Rolle. Kleine Tümpel, die jahreszeitlich unterschiedliche Wasserstände aufweisen und sogar (überraschenderweise) wassergefüllte Reifenspuren bieten gute Lebensbedingungen für Amphibien und im begrenztem Umfang für Libellen. Ein „vielseitiges Biotopmosaik“(H.-J. Bauer 1987, S.17), so wird aus dieser Tabelle sehr schön sichtbar, muß das Ziel der Gestaltung sein. Auffallend ist , das H.-J. Bauer (1987) die Maßnahmen auch über den Zeitraum der eigentlichen Renaturierungsaktion hinaus ausgeweitet sehen möchte. Durch gezielte Eingriffe sollen Sukzessionsstadien und damit die unterschiedlichen Lebensraumbedingungen erhalten werden. H.-J Bauer bezeichnet ein solche Vorgehensweise als „Biotopmanagement“.
Tab. 1: Möglichkeiten der Biotopgestaltung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: H.-J. Bauer 1987: Renaturierung oder Rekultivierung von Abgrabungsbereichen? Illusion und Wirklichkeit. In: Naturschutzzentrum NRW/LÖLF(Hrsg.). Seminarberichte. H1. 1Jhg. S.16.
4.4 Fallbeispiel: Rekultivierung 6 - Seen - Platte in Duisburg
Im Rahmen eines Besuchs der Kiesbaggerei Hülskens(Sitz in Wesel) in Duisburg-Großenbaum am 2.6. 1998 wurden dem Verfasser die Techniken, der Umfang der Abgrabungen und die geplanten, bzw. schon erbrachten Rekultivierungsmaßnahmen vom zuständigen Leiter für Rekultivierung Herrn Stenmanns vorgestellt. Die Firma Hülsken baut im Duisburger Süden, Großenbaum Buchholz und Wedau Sand und Kiese seit 1991 ab. Die Abbaurechte wurden von dem vormals dort tätigen Unternehmen des Grafen von Spee (Kiesbaggerei Spee) erworben. Dessen Unternehmen verfügt derzeit über die Rechte zur Nutzung des Forstes zum Zwecke der Holzgewinnung. Es ergibt sich danach folgende Nutzungskette für das vorgestellte Gebiet. Das Unternehmen Graf Spee rodet und nutzt den Holzbestand, die Firma Hülsken baut auf demselben Gebiet die Sand- und Kiesvorkommen ab, rekultiviert das Abbaugebiet und übergibt dieses Gebiet im Anschluß an diese Maßnahmen der Stadt Duisburg als Folgenutzer. Der Firma Hülsken obliegt zudem eine dreijährige Garantiepflege für die erbrachten Leistungen. In Abstimmung mit den zuständigen Behörden(untere Landschaftsbehörde, Grünflächenamt) gab die Firma Hülsken der branchenbekannten schweizer Firma OEKOPLAN (Hauptsitz in Zürich, mit einer Zweigstelle in Rees) den Auftrag zur Erstellung der Rekultivierungspläne für das betroffene Gebiet. Es muß vorweg noch erwähnt werden, daß das vorgestellte Gebiet ein Landschaftsschutzgebiet ist. Im Rahmen dieser Arbeit wird nur auf zwei Seen der 6-Seen- Platte in Duisburg eingegangen, der Wildförstersee und die derzeit noch genutzte Abgrabung Haubachsee. Insgesamt umfaßt die von der Firma Hülsken genutzte Fläche 48 ha, wobei die derzeitige Abgrabung Haubachsee mit 34 ha das Hauptprojekt darstellt. Die Firma Hülsken verwendet zum Abbau ausschließlich Eimerkettenschwimmbagger, wodurch nach Aussage des Leiters für Rekultivierungsmaßnahmen „definierte Schnitte“ unter Wasser (bis 1:3 Schnittfläche) möglich werden, d.h. es ergeben sich bezogen auf die Ufergestaltung und der Böschung gezielte Gestaltungsmöglichkeiten. „Nachdem mit einem Eimerkettenbagger die erforderlichen Flachböschungen, wie sie im Zuge der Rekultivierungsmaßnahmen erforderlich sind angelegt werden können, fallen bei fachgerechten Abbaubetrieb kaum Nacharbeiten zur Uferformung an“ (Dingethal 1985, S.123). Diese Möglichkeit nutzt die Firma Hülsken, da aufgrund der relativ geringen Menge an Abraum(Kies- und Sandvorkommen liegen sehr oberflächennah, d.h. sehr günstige Abbaubedingungen, getrübt nur durch die geringe Mächtigkeit der an Sand- und Kiesschichten) dies die günstigste Methode ist. Die Firma Hülsken fördert jährlich ca. eine Millionen Tonnen Sand und Kies, wovon nach Aussage Hr. Stenmanns ca. 10-15% des Erlöses in die Rekultivierungsmaßnahmen geleitet wird. In Anbetracht der Berechnungsgrundlage, der Aufwand Transportfahrzeuge wird als Kostenfaktor Abtransport sowie zur Abschüttung für die Uferzonen berechnet(transportiert wird ja auch unabhängig von der Rekultivierung), der berechnete Einsatz des Eimerkettenbaggers zum Abbau (und wie erwähnt kostenneutral zum Uferanschnitt), dürfen solche Zahlen nicht überbewertet werden. Ebenso sind gezielte Bepflanzungen nur punktuell durch Baumpflanzungen sichtbar; der überwiegende Teil darf man eher der natürlichen Sukzession anrechnen. Als Kostenpunkte dürften eher das ausgebaute Wegesystem, die vorhergegangenen Planungen und Gutachten, die Informationstafeln und die Anlage von Beobachtungsinseln und Zäunen zwecks Besucherlenkung aufgeführt werden. Ob diese Kostenpunkte die abgeschätzte Summe erreichen bleibt offen.
Nach Aussage der Firma Hülsken wird der zukünftige Haubachsee dem Naturschutz zugeführt, d.h. es entsteht hier in Abstimmung mit den Behörden ein Vogelschutzgewässer. Anhand des Planungsblattes(s. Anlage Blatt 3) erkennt man deutlich die unterschiedliche Gestaltung der Uferzonen. Die Abbildung (s. Anlage Blatt 4) zeigt modellhaft die hierbei verwendeten Vorbilder auf, die die Firma OEKOPLAN vorschlägt. Deutlich erkennbar sind die Unterschiede der Gestaltung der Ufer, d.h. es sollen verschiedene Biotopausstattungen geschaffen werden. Deutlich erkennbar sind hierbei sandige und kiesige Uferbereiche(gelb markiert), welche besonders gefährdeten Arten Schutz gewähren könnten. Problematisch ist nur, daß weder die Firma Hülsken noch die jeweiligen Behörden bestimmte Sukzessionsstadien zu erhalten gedenken. Des weiteren sind in der Anlage der Uferzonen keine Steilwände vorgesehen, die die Höhe von 1,5 Meter überschreiten. Begründet wird ein solches Fehlen mit der zu leistenden „Verkehrssicherheit“ für Besucher. Die einzelnen „Ufersorten“ sind mit verschiedenen Buchstabenkombinationen(z.B. Schnitt A-Ao) bezeichnet. Diese finden wir im Übersichtsplan(leider kaum erkennbar) an den Uferzonen in unregelmäßiger Verteilung wieder. Die aufgezeigten Modelle werden hier in Abwechslung verwirklicht, wobei die Firma Hüsken den Abraum(B-Horizont)[3] zur Gestaltung verwendet. In der Mitte des Sees befindet sich eine Insel, bzw. eine Vogelschutzinsel. Da das Gebiet bis auf wenige Besucherplätze für Besucher unzugänglich bleibt(vgl. rotes Wegenetz), wird dieser Platz relativ ungestört bleiben. Bei den dunkelgrün gefärbten Gebieten handelt es sich um Feuchtgebiete, die bis an die Uferzone heranreichen, gegebenfalls in weiterer Entwicklung um eine Verlandungszone. Nach Aussage der Firma Hülsken wird der See an seinen tiefsten Stelle 10-13 Meter tief sein, was für die weitere Qualität des Sees (Wassertemperatur/Nährstoffgehalt) von entscheidener Bedeutung sein dürfte. Die Grundwasserfließrichtung im Gebiet ist ost-west, so daß bei Betrachtung des Übersichtplanes die ungefähre senkrechte Ausrichtung des Sees zur Grundwasserfließrichtung erkennbar ist. Dies dürfte sich ebenfalls positiv auf die Bedingungen des Sees(Wasseraustausch) auswirken. Anhand des Übersichtsplanes ist deutlich der Waldanschluß des Sees erkennbar. Dies ist um so wichtiger, als hier Randlinieneffekte in bezug auf die umgebenden Biotope zu erwarten sind. Durch gemischte Anpflanzungen(Stieleiche, Haselnuß, Weiden, Eschen, keine Birken- vgl. Anlage 6 Foto 3) wird hier versucht, Übergänge zum angrenzendem Wald neu zu gestalten.
Die Rekultivierunsmaßnahmen am Wildförstersee sind abgeschlossen. Es handelt sich beim Wildförstersee um ein Gebiet, daß schon durch die Kiesbaggerei Spee vor einigen Jahren „angebaggert“ aber nicht ausgekiest wurde. Das Gewässer, welches damals entstand hatte nur geringe Tiefe(Flachgewässer); die Uferzonen waren lang gestreckte Sandufer, die zur Sommerzeit sehr trocken und warm waren. Amphibien und besonders Insekten (besonders auch verschiedene Libellenarten) belebten diesen Standort. Im Rahmen der Kiesgewinnung durch die Firma Hülsken wurden nun im Anschluß Rekultivierungsmaßnahmen durchgeführt. Ein Teilbereich des Sees wird nunmehr für Besucher durch Beobachterplattformen begehbar; für weite andere Teile gilt dagegen „Betreten verboten !“. Die in Anlage 6 abgedruckten Fotos sollen einen kurzen Eindruck vermitteln. In Anlehnung der in Anlage 4 vorgestellten Ufermodelle wurden im Bereich des Wildförstersees entsprechende Uferzonen gestaltet. In Anlage 6(Foto 1) finden wir den in Anlage 4(Modellplan zur Ufergestaltung) vorgestellten Ringgraben am Wildförstersee verwirklicht. Zwischen dem langgezogenem Ufer(mit noch nicht deckend bewachsener, sandig und grokiesiger Bodenoberfläche) und der hervorschauenden bewachsenen Sandinsel befindet sich ein nicht allzu tiefer langer Graben. In der gewässernahen Uferzone finden wir Röhrichtbestände, Rohrkolben, Binsengras usw., also eine verschiedenartig hohe und dichte Vegetation, die den Wasservögeln[4] Schutzmöglichkeit (Sichtschutz), Brutplatz und Nahrungsgebiet zugleich ist. Daneben finden wir im Seebereich gezielt angelegte kleine, heute bewachsene Inseln(s. Anlage 6 Foto 2). Erkennbar wird auf dem Foto(2) der dichte Bewuchs der Uferzonen. Nur auf geringer Fläche finden wir am Wildförstersee Trockenstandorte, d.h. die ursprünglich angelegten sandigen und grobkiesigen Uferzonen. Fast die gesamten Uferzonen wurden durch die natürliche Sukzession begrünt.
5. Renaturierung von Trockenabgrabungen
Im Rahmen dieser Arbeit sollen nur kurz die Möglichkeiten aufgezeigt werden, welche sich durch Trockenabgrabungen für den Naturschutz bieten. Die Literatur bietet diesbezüglich viele vertiefende Fallbeispiele(Könemann 1995, Darmer 1973 und 1979).
Trockenabgrabungen bieten nach Bauer(1987) vielen bedrohten Lebewesen Lebensraumbedingungen, wie sie in unserer Kulturlandschaft nur noch selten zu finden sind. Insbesondere Trockenabgrabungen bieten durch Sand und Kiesböden wärmeliebende Pflanzen und Tiere Lebensbedingungen. Nährstoffarme Sklettböden mit wenig dichtem Bewuchs(offene Sandflächen) und damit hohen Einstrahlungsraten ermöglichen diese warmen Temperaturen. Diese seltenen Charakteristika (Bauer 1987) entsprechen denen an unkorregierten Flußläufen und Binnendünen, welche weitesgehend durch die wirtschaftliche Nutzbarmachung unserer Flußlandschaften und Flüsse verlorengingen. Zusätzlich können solche Räume durch zeitweilig gefüllte Tümpel vielen Amphibien Lebensraum bieten. Die Erdkröte, die Gelbbauchunke, Wechselkröte und die Geburtshelferkröte seien hier als Beispiel genannt. Vielfach unbeachtet bieten Trockenabgrabungen (Bauer 1987; Könemann 1995) gute Lebensbedingungen für viele wirbellose Tierarten(Pillenkäfer, Sandlaufkäfer, Ameisenlöwen, Waldbienen, Wespen, Heuschrecken, Grillen, Schmetterlinge usw.). Reptilien sind eine weitere Gruppe, welche(Bauer 1987; Könemann 1995) einen Lebensraum durch Trockenabgrabungen gewinnnen können. Diese finden dort bis zum „Verbuschungsstadium“ ideale Bedingungen. Silbergras, Schaf-Schwingel, Straußgras, Sandsegge, Frühlings-Spark, Bauernsenf usw. sind nach Könemann(1995) Pflanzen, welche sich unter den genannten nährstoffarmen und warmen(trockenen) Bedingungen ansiedeln. Nach Bauer(1987) sind daher in solchen Gebieten Aufforstungen und Rekultivierungsmaßnahmen eher schädlich, da sie diese speziellen Bedingungen , z.B. durch Bepflanzung verminderte Einstrahlung (durch erhöhte pflanzliche Bodenbedeckung), zerstören. Bauer(1987) fordert vielmehr, solche „spartanischen“ Lebensbedingungen durch Biotopmanagement zu erhalten und bestimmte Sukzessionsstadien durch regelmäßige Eingriffe zu konservieren. Es zeigt sich also, daß Trockenabtragungen Ersatzbiotope für viele bedrohte Tierarten sein können und ihr Wert denen von renaturierten Baggerseen in nichts nachsteht. Gleichfalls gilt aber auch hier, daß es zu aller erst darum geht, wertvolle Primärbiotope zu schützen und eine Zerschneidung/Zerstörung der Landschaft zu vermeiden.
6. Literaturverzeichnis
ABN(Hrsg.) 1982: Bodenabbau und Naturschutz. Jb. Naturschutz und Landschaftspflege. 32.Bonn.
Barner, J. 1978. Rekultivierung zerstörter Landschaften. Stuttgart.
Bauer, I.;Wienand, U. 1994: Hinweise zur Handhabung der Eingriffsregelung bei Naßabgrabungen. In: LÖLF(Hrsg.) Jahresbericht 1993. S.8-11. Recklinghausen.
Bauer, H.-J.1987: Renaturierung oder Rekultivierung von Abgrabungsbereichen? Illusion und Wirklichkeit. In: Naturschutzzentrum NRW(Hrsg.). NZ-NRW Seminarberichte . H.1. Jhg. 1. S.8-19.
Burger, D.; Pfeffer, K.-H. 1980: Renaturierung von Kiesgruben im Stadtgebiet von Köln. In: Stadtbauwelt Nr.67. S.1557-1564.
Darmer, G. 1973: Landschaft und Tagebau. Ökologische Leitbilder für die Rekultivierung. Berlin.
Darmer, G. 1979: Landschaft und Tagebau. Planerische Leitbilder und Modelle zur Rekultivierung. Berlin.Bd.2.
Dingethal, F.J.; u.a.(Hrsg.) 1985: Kiesgrube und Landschaft.2 Aufl. Hamburg.
German, R. 1982: Naturschutz und Landschaftspflege. In: SII Geowissenschaften. Stuttgart.
Hofmann, M. 1981: Belastung der Landschaft durch Sand- und Kiesabgrabungen, dargestellt am Niederrheinischen Tiefland. In: Forschungen zur Deutschen Landeskunde Bd. 219. Trier.
Hutter, C.-P.(Hrsg.) 1993: Seen, Teiche, Tümpel und andere Stillgewässer. Stuttgart.
Könemann, P. 1995: Der Sand- und Kiesabbau an der Porta Westfalica- Ökonomische und ökologische Untersuchungen zur Belastung und Inwertsetzung des Naturraumpotentials. In: Hannoversche Geographische Arbeiten. Bd. 50.
Landau, H. 1981: Einfluss von Rekultivierungsmassnahmen an Baggerseen auf die Flora und den Wasserchemismus. In: Daten und Dokumente zum Umweltschutz. Sonderreihe Umwelttagung. Nr. 31.Hohenheim.
Leser, H. 1978: Landschaftsökologie. 2. Aufl. Stuttgart.
Pott, E.1990: Bach, Fluß, See. Pflanzen und Tiere in ihrem Lebensraum-ein Biotopführer.3. Aufl. München.
Raulff, Hans-Gerd 1987: Möglichkeiten und Grenzen des Naturschutzes bei der Rekultivierung von Abgrabungen aus der Sicht der Kiesindustrie. In: Naturschutzzentrum NRW(Hrsg.). NZ-NRW Seminarberichte. H.1, Jhg.1. S.21-24.
Ringler, A.1987: Gefährdete Landschaft. Lebensräume auf der Roten Liste. München.
Schwertner, P. 1991: Heimische Biotope. Ein Arbeitsbuch für den Naturschutz.Augsburg
[...]
[1] vgl. hierzu: ABN (Hrsg.) 1982: Bodenabbau und Naturschutz- Jahrbuch Naturschutz. Landschaftspflege 32. Bonn.
[2] vgl. dazu: Bauer, I.; Wienand, U.1993: Hinweise zu Handhabung der Eingriffsregelung bei Naßabgrabungen. In: LÖLF Jahresbericht. S.8-11.
[3] vgl. Anlage 6 und Foto Nr. 4. Abtragung der relativ geringen Humusdecke(A-Horizont), der darunter liegende Abbraum(B-Horizont wird getrennt zur Ufergestaltung (Aufschüttung) benutzt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Renaturierung und Rekultivierung von Sand- und Kiesabgrabungsflächen. Sie untersucht die Problematik des Sand- und Kiesabbaus, die verschiedenen Begrifflichkeiten (Renaturierung vs. Rekultivierung), gesetzliche Grundlagen (insbesondere das nordrhein-westfälische Abgrabungsgesetz) und die Möglichkeiten und Probleme bei der Renaturierung und Rekultivierung von Abgrabungsflächen.
Was sind die Hauptziele der Renaturierung und Rekultivierung?
Das Hauptziel der Rekultivierung ist die Wiederherstellung von Flächen, die durch den Abbau von Rohstoffen beschädigt wurden, um sie wieder wirtschaftlich oder landwirtschaftlich nutzen zu können. Die Renaturierung hingegen zielt darauf ab, naturnahe Zustände wiederherzustellen und Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten zu schaffen. Die Arbeit betont, dass Rekultivierung oft die natürliche Sukzession verhindert, während Renaturierung die Instabilität von Biotopen als positiven Wert betrachtet.
Welche Probleme entstehen durch den Sand- und Kiesabbau?
Der Abbau von Sand und Kies führt zur Zerstörung von natürlichen Flächenstrukturen und deren Nutzungen. Die Vegetation wird abgetragen, der Mutterboden entfernt, Reliefformen verändert und die Tierwelt verscheucht. Es entstehen "Sekundärbiotope", deren Qualität von den gewählten Maßnahmen zur Renaturierung oder Rekultivierung abhängt. Ein besonders gravierendes Problem ist der Flächenverbrauch: Jährlich werden in Deutschland 5000 Hektar Land durch Kies- und Sandabbau verbraucht.
Was besagt das nordrhein-westfälische Abgrabungsgesetz?
Das Abgrabungsgesetz NRW verpflichtet Unternehmen, die durch den Abbau von Rohstoffen Flächen zerstören, diese wiederherzurichten oder gemäß einer bestimmten Folgenutzung zu hinterlassen. Es soll sichergestellt werden, dass der Naturhaushalt nicht nachhaltig geschädigt wird, eine Verunstaltung des Landschaftsbildes vermieden wird und wertvolle Landschaftsteile nicht zerstört werden. Unternehmen müssen eine Sicherheitsleistung hinterlegen, um Kompensationsmaßnahmen zu finanzieren.
Welche Rolle spielt die Landschaftsplanung bei der Rekultivierung?
Die Landschaftsplanung ist ein entscheidendes Instrument bei der Rekultivierung von Tagebauen. Sie ermöglicht die Abstimmung zwischen Unternehmen und Behörden, um die wiederhergestellten Flächen sinnvoll in den Raum zu integrieren. Eine umfassende Landschaftsplanung berücksichtigt ökologische, wirtschaftliche, politische und verwaltungstechnische Aspekte, um die bestmögliche Folgenutzung der Flächen zu gewährleisten.
Wie beeinflusst der Nassabbau das Grundwasser?
Der Nassabbau, bei dem Grundwasser freigesetzt wird, birgt das Risiko der Grundwasserverschmutzung, da der schützende Schichtmantel zerstört wird. Es entsteht eine enge Wechselbeziehung zwischen dem Baggersee und dem umgebenden Grundwasserkörper. Der Grundwasserstrom wird beeinflusst, was zu Geländeüberflutungen führen kann. Die Arbeit betont die Bedeutung der Planung, um negative Auswirkungen auf die Grundwasserqualität zu vermeiden.
Welche Renaturierungsmaßnahmen können bei Nassabgrabungen durchgeführt werden?
Renaturierungsmaßnahmen bei Nassabgrabungen zielen darauf ab, Baggerseen als Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten zu gestalten. Eine vielfältige Ufergestaltung mit Flachwasserzonen, Inseln, Halbinseln und Lagunensystemen fördert die Ansiedlung unterschiedlicher Tierarten. Die Wasserqualität spielt eine entscheidende Rolle, wobei ein nährstoffarmer (oligotropher) See angestrebt wird.
Was ist das Fallbeispiel "6-Seen-Platte in Duisburg"?
Das Fallbeispiel beschreibt die Rekultivierungsmaßnahmen der Firma Hülskens im Bereich der 6-Seen-Platte in Duisburg. Die Firma baut dort Sand und Kies ab und rekultiviert die Flächen in Abstimmung mit den Behörden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Gestaltung unterschiedlicher Uferzonen, um verschiedene Biotopausstattungen zu schaffen. Der zukünftige Haubachsee soll dem Naturschutz zugeführt werden und als Vogelschutzgewässer dienen. Auch wird die Renaturierung des Wildförstersees beschrieben.
Welche Möglichkeiten bietet die Renaturierung von Trockenabgrabungen?
Trockenabgrabungen können Lebensraumbedingungen für wärmeliebende Pflanzen und Tiere bieten, die in der Kulturlandschaft selten geworden sind. Nährstoffarme Skelettböden mit wenig dichtem Bewuchs ermöglichen hohe Einstrahlungsraten und warme Temperaturen. Solche Gebiete können als Ersatzbiotope für bedrohte Arten dienen, jedoch fordert Bauer (1987), diese „spartanischen“ Lebensbedingungen durch Biotopmanagement zu erhalten und bestimmte Sukzessionsstadien durch regelmäßige Eingriffe zu konservieren.
- Quote paper
- Ansgar Deekeling (Author), 1998, Renaturierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107645