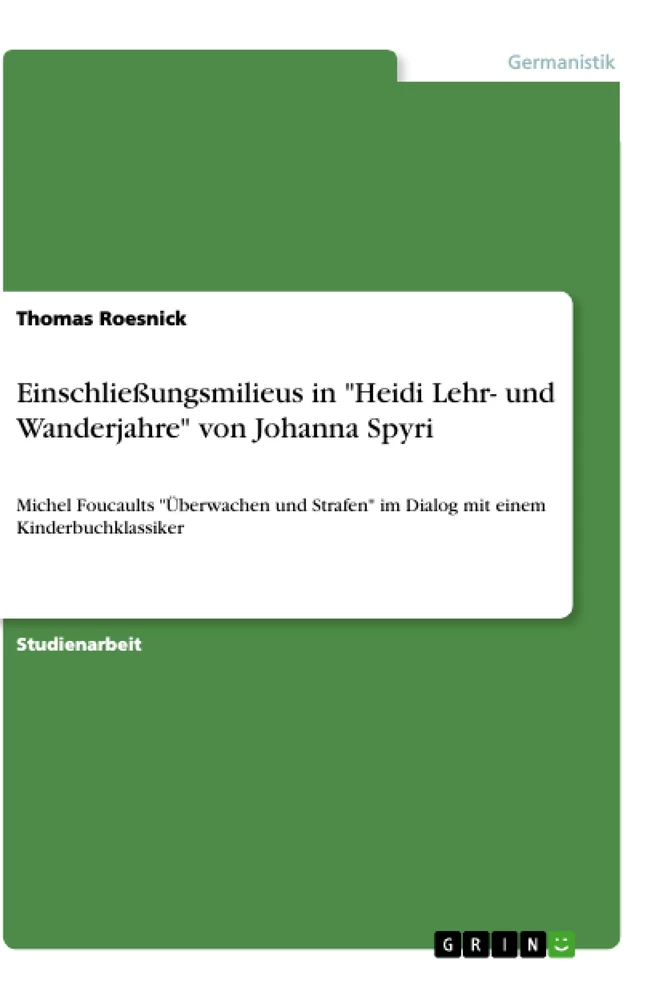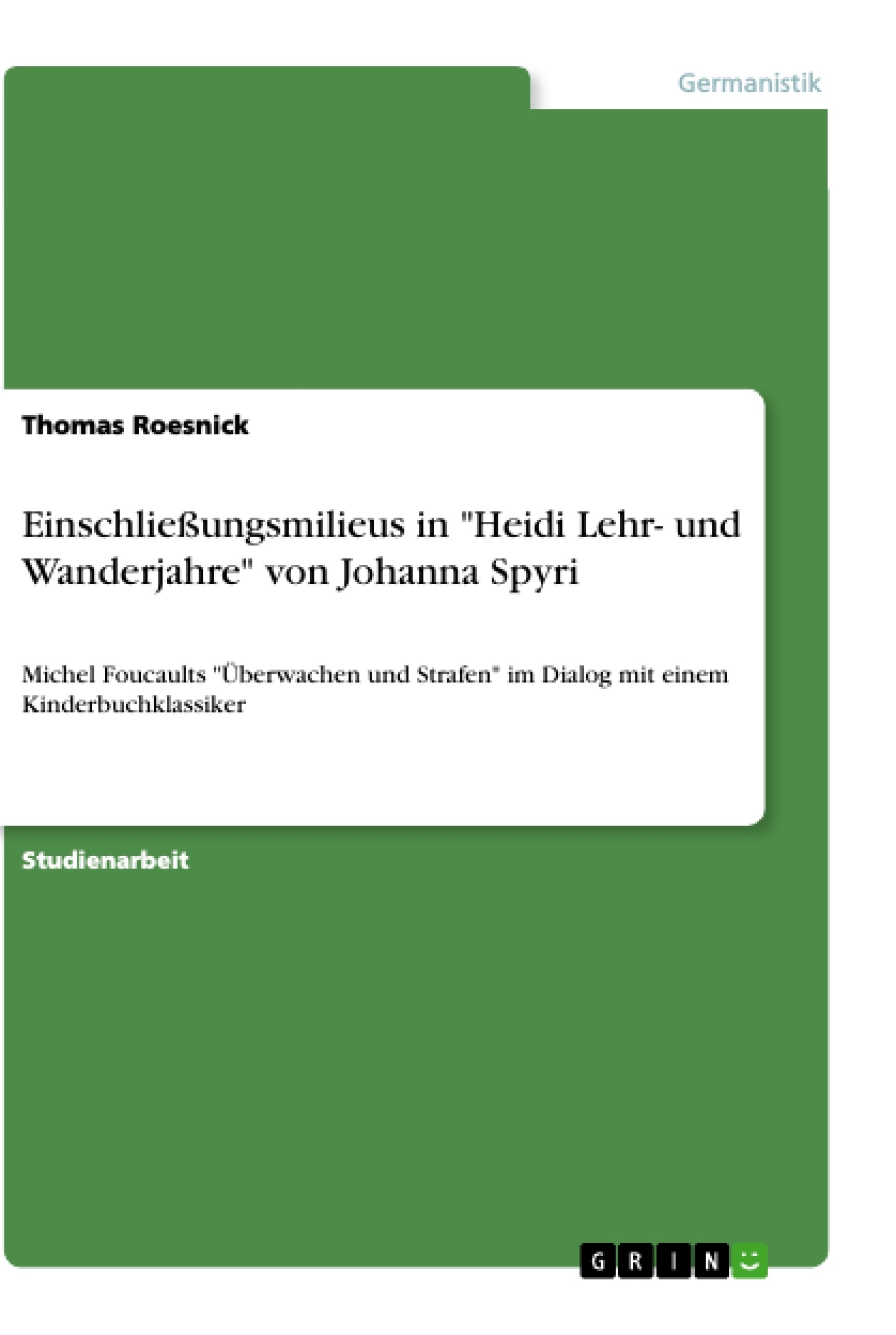Johanna Spyris Kinderbuchklassiker "Heidis Lehr- und Wanderjahre" (1880) wird in dieser wissenschaftlichen Abhandlung mit Foucaults Begriff der Einschließungsmilieus ("Überwachen und Strafen" Michel Foucault, 1975) neu gelesen. Welche Einschließungsmilieus im Roman werden dargestellt? Verhindern die Einschließungsmilieus (Familie, Schule) eine vielfältige Bildungsentwicklung bei der Figur Heidi?
Den Roman mit Foucaults Begriffen aus „Überwachen und Strafen“ zu verbinden, soll zu dem Ziel führen, neue Fragen an einen Kinderbuchklassiker zu stellen. Wie sprachlich gehaltvoll und tiefgründig ein literarischer Text erscheint, ist im Sinne Foucaults nicht entscheidend, vielmehr was ein Text an weiteren Gedanken über bestehende Diskurse eröffnen kann.
Die Literatur funktioniert dabei als Beispiel und hat überwiegend eine illustrative Bedeutung, um erkenntnistheoretische oder wissensorganisatorische Überlegungen und Thesen zu verdeutlichen. Foucault verfolgt nicht das hermeneutische Ziel, über interpretative Methoden zu einem Sinnverstehen des literarischen Textes zu gelangen. Vielmehr werden bei der Diskursanalyse Prozesse, Relationen und textuelle Verweise untersucht. Insofern eignet sich diese Methode für die Betrachtung von Textmengen. Die diskursanalytische Literaturwissenschaft untersucht dennoch auch Einzeltexte in Verbindung mit theoretischen Texten und hat das Ziel, Diskurse eines Textes nachzuweisen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Foucaults Einschließungsmilieus
3. Textanalyse Heidis Lehr- und Wanderjahre
3.1 Erste Lebensjahre
3.2 Alm
3.3 Stadt
3.4 Rückkehr Alm
4. Schlussbetrachtungen
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Johanna Spyris (1827–1901) Heidis Lehr- und Wanderjahre (1880) erfährt 140 Jahre nach der Veröffentlichung große Popularität weltweit.1 Der Schweizer Mythos etablierte sich bereits zu Lebzeiten der Autorin mit Heidi als Inbild eines naturliebenden, verträumten, glücklichen Kindheitszustandes. Den Mythos befeuert hat ein beständiges Filmangebot (seit 1920: 12 Filme, 8 Zeichentrickfilme, 6 Serien), welches den Naturlebensraum Heidis in zumeist trivialer Fülle aufzeigt. So erhält jede Generation eine filmische Interpretation des weltweit, vielfach übersetzten Kinderbuchs. Bezeichnenderweise lauten die ersten Worte eines Forschungsbeitrages (Büttners/Ewers, 2008) zum Roman: „Heidis Welt, wir lernen sie im Film kennen, dann malen wir ein Bild dazu. Was malen wir zuerst? Die Berge, hohe, spitze Berge.“2 Der filmische Erstkontakt kann somit die Erstlektüre des Romans verfälschen bzw. eine kritische Lesart verhindern. Die wohl einflussreichste Filmumsetzung ist die japanische Zeichentrickserie (1974), die einen betonten Anteil auf die Naturdarstellungen legt und die Bergszenen umfangreich erweitert.
Die Forschungsbeiträge untersuchen bisweilen diesen Mythos. Die weiteren Forschungsrichtungen zu Heidi bilden Themen wie das Natur-Stadt-Verhältnis, die theologischen Verweise im Roman, Heidi als weltweites Phänomen, Filmadaptionen im Vergleich, Pädagogik und vor allem die Biographie Johanna Spyris ab.3 Die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Spyris Heidi ist bis heute jedoch unzureichend vorangeschritten und weist Forschungslücken auf.4 Kritische Lesarten (Beispiel: Doderer, Hurrelmann, Engler) sind bis in die Gegenwart unterrepräsentiert.5 Uneinigkeit besteht bei der Einordnung des Textes als Bildungsroman. Die unterschiedlichen Positionen sowie eine Annäherung an eine Begriffsdefinition von „Bildung“ werden in der Hausarbeit aufgezeigt. Ob hier ein Bildungsroman vorliegt, wird durch eine Untersuchung der im Text dargestellten Einschließungsmilieus (Foucault) versucht, zu beantworten. In Kapitel 3 sollen diese, bezogen auf die Hauptfigur des Romans, identifiziert und analysiert werden. Daraus ergeben sich einige Fragen: Welche Einschließungsmilieus im Roman gibt es? Inwieweit befördern oder verhindern diese einen Bildungszuwachs bei Heidi? Wechselt Heidi das Milieu unter Zwang? Aus diesen Fragen abgeleitet, ergibt sich die These der Hausarbeit: Die Einschließungsmilieus verhindern eine vielfältige Bildungsentwicklung bei der Figur Heidi! Daraus ergeben sich Anschlussfragen: Inwieweit erfährt Heidi Bildung im jeweiligen Milieu und wie kann sich das auf die Handlung erzählerisch bzw. auf weitere Figuren auswirken? Inwieweit bildet sich Heidi aus einer intrinsischen Motivation heraus? Kann die Natur bzw. die Bergwelt gar als Einschließungsmilieu bezeichnet werden?
In der Hausarbeit werden der Mythos und die Autorin als Subjekt beiseite gelassen und ein poststrukturalistischer bzw. diskursanalytischer Methodenansatz gewählt: Die Schrift bildet das Zentrum der Beobachtungen und ist dabei als Teilmenge historischer Diskurse einzuordnen.6 So verhandelt der Roman unter anderem Diskurse über Kindheit, Bildung, Erziehung, Religion, die industrialisierte Welt Ende des 19. Jahrhunderts mit bereits einsetzender Rückbesinnung auf ein Leben in der Natur und reiht sich damit in eine Vielzahl von literarischen Texten zu dieser Zeit ein. Hierzu erweist sich neben Heidis Lehr- und Wanderjahre als Gegenstand7, das Hinzuziehen von Michel Foucaults (1926-1984) Abhandlung Überwachen und Strafen (1975) als hilfreich, um sich der aufgestellten These und den Fragen anzunähern. Der als „Begründer der Diskursanalyse“8 betitelte Foucault und seine Beobachtungen zu den Einschließungsmilieus werden hierbei keineswegs als Gesetzmäßigkeit eingeordnet, sondern einer kritischen Lesart unterzogen. Hierzu erweisen sich neue Forschungstexte wie der Sammelband Vierzig Jahre „Überwachen und Strafen“ (2017) als hilfreiche Transferleister.
Die Relevanz des Themas der Hausarbeit ergibt sich aus dem Umstand, dass in der Forschung diese Verbindung – Foucault/Heidi – bisher nicht hergestellt wurde. In der Hausarbeit kann allerdings keine umfassende Einordnung von Überwachen und Strafen in das Gesamtwerk Foucaults geleistet werden, zumal Foucault seine theoretischen Positionen mehrfach geändert hat.9 Besagter Text soll in Kapitel 2 auch nicht gänzlich in all seinen Ausführungen dargelegt werden, wenn es zum Beispiel um die Beschreibungen von Gefängnissen und deren Strukturen geht. Der Begriff Diskursanalyse kann hier ebenfalls nicht allumfassend historisch aufgeboten werden und welche Probleme aus literaturwissenschaftlicher Perspektive damit verbunden sein können. Foucault definiert zudem den Begriff Diskurs nicht abschließend, sodass hier der Terminus allgemein, als eine Gruppe von Aussagen über ein spezifisches Thema, zu verstehen ist.10
Den Roman mit Foucaults Begriffen aus Überwachen und Strafen zu verbinden, soll zu dem Ziel führen, neue Fragen an einen Kinderbuchklassiker zu stellen. Wie sprachlich gehaltvoll und tiefgründig ein literarischer Text erscheint, ist im Sinne Foucaults nicht entscheidend, vielmehr was ein Text an weiteren Gedanken über bestehende Diskurse eröffnen kann.11 12 Die Literatur funktioniert dabei als Beispiel und hat überwiegend eine illustrative Bedeutung, um erkenntnistheoretische oder wissensorganisatorische Überlegungen und Thesen zu verdeutlichen.13 Foucault verfolgt nicht das hermeneutische Ziel über interpretative Methoden, zu einem Sinnverstehen des literarischen Textes zu gelangen. Vielmehr werden bei der Diskursanalyse Prozesse, Relationen und textuelle Verweise untersucht. Insofern eignet sich diese Methode für die Betrachtung von Textmengen. Die diskursanalytische Literaturwissenschaft untersucht dennoch auch Einzeltexte in Verbindung mit theoretischen Texten und hat das Ziel, Diskurse eines Textes nachzuweisen.14
2. Foucaults Einschließungsmilieus
Im 1975 publizierten Überwachen und Strafen zeigt Foucault den Wandel des Strafens auf und wie sich das Gefängnis zu Beginn des 19. Jahrhunderts als zentrale Strafinstitution etabliert und das bisherige Machtkonzept der Souveränität ablöst.15 So ersetzt die disziplinarische Haftstrafe, die Marter als souveräne Machtdarstellung. Foucault versteht unter dem Begriff „Disziplin“ einen „Typus von Macht, der enge Korrespondenzen zwischen einer inneren Ordnung der Subjekte und der äußeren Ordnung ihrer Lebensbedingungen herstellt“16 und ordnet das Subjekt als Ergebnis der Disziplinierung des Körpers mit Zugriff auf die Seele durch Überwachung ein. Das Konzept der Disziplinarmacht beinhaltet Techniken einer dauerhaften Überwachung, um normierend und subjektivierend zu wirken.17 Das individuelle Subjekt wird hierbei in verschiedene, zeitbegrenzte Einschließungsmilieus wie Familie, Schulen, Universitäten, Fabriken, Krankenhäuser, Gefängnis systematisch, zeitlich und hierarchisch eingeteilt. Das Ziel ist hierbei die Zuweisung des Einzelnen in ein Gesellschaftssystem, welches mittels Übungen und Prüfungen das Subjekt wiederholt Bewegungen und Abläufe ausführen lässt und dieses Wissen schließlich abfragt. Nach Foucault vervielfältigen sich im 19. Jahrhundert diese Disziplinarsysteme bzw. Einschließungsmilieus quantitativ und erreichen alle Gesellschaftsformen, was er sogleich als Disziplinargesellschaft betitelt. Bogdal fügt zu Foucault hinzu: „Disziplin [...] ist ein komplexes Beziehungsgeflecht zwischen Subjekten, Wissen, Praktiken und Dingen.“18
Foucault thematisiert in Überwachen und Strafen Räume und deren Gestaltung. Der erste Raum der Disziplinierung ist, noch vor der Schule, das familiäre Lebensmilieu. Darin wirken Menschen aufeinander ein und erhalten eine Zuweisung nach Hierarchien. Die Familienräume können auch zugleich Machträume der Überwachung und Bestrafung sein. Hierbei geht es um die „panoptischen“ Mechanismen der Macht, die bereits in den ersten Lebensjahren der Kindheit angewendet werden und die Entwicklung beeinflussen können. Foucaults Machtbegriff ist somit nicht nur an geschlossene Institutionen („gesellschaftliche ‚Quarantäne‘“19 ) gebunden, sondern die Macht und deren Verfahren durchdringen auch die Familie und somit den ganzen Gesellschaftskörper.20
3. Textanalyse Heidis Lehr- und Wanderjahre
Foucault beschreibt das Durchdringen in alle Gesellschaften als Mikromächte21, die aus einzelnen Episoden bestehen. Die Familie kann die erste von episodischen Machtgefügen sein. In jedem Machtraum sind „die Beziehungen keine eindeutigen Relationen, in denen Konflikte, Kämpfe und zumindest vorübergehende Umkehrung der Machtverhältnisse drohen.“22 Foucaults Überwachen und Strafen zeigt eine mögliche Abfolge dieser Episoden verschiedener Einschließungsmilieus auf. Deshalb erweist sich eine chronologische Lesart des Romans als sinnvoll, um sich der These anzunähern. Zugleich braucht es, um die Bildungsroman-Frage zu klären, eine Definition des Terminus Bildung.
Der Begriff „Bildung“ hat ein vielfältiges Bedeutungsspektrum mit philosophischen, klassischen Positionen (Beispiele: Schiller, Herder, Humboldt) erhalten. Diese hier gänzlich darzulegen, überschreitet den Schriftumfang. Eine allgemeine Definition soll für die Hausarbeit deshalb hilfreich sein. So heißt es im Lexikon Literaturwissenschaft (Groppe): Bildung ist „die zielgerichtete Entwicklung der gesamten Persönlichkeit, die auf einer im Individuum angelegten Disposition aufbaut.“23 Bildungsfähigkeiten (Handlungsfähigkeit, kognitive Entwicklung, Emotionen, Interaktionen, Urteilsvermögen) eröffnen dem Menschen zugleich die Dimensionen der Freiheit und Selbstbestimmung, der Individualität und der schöpferischen Gestaltung von Ich und Welt.24 Um Heidis Bildungsweg aufzuzeigen, ist die Betrachtung der Lebenszeit vor der Begegnung mit dem Großvater von Relevanz. In welchen familiären Verhältnissen wächst Heidi auf bevor sie im Alter von beinahe fünf Jahren von Dete zum Großvater gebracht wird?
3.1 Erste Lebensjahre
Heidi verbringt das erste Lebensjahr als Säugling bei ihren Eltern im Dörfli. Nach deren Tod lebt sie bis zum vierten Lebensjahr als Kleinkind (Entwicklungsstufe: 2. und 3. Lebensjahr) gleichfalls im Dörfli in neuen Familienbeziehungen25 mit ihrer Tante Dete, der Schwester ihrer Mutter Adelheid, und deren Mutter als Bezugspersonen. So wechselt Heidi aus der Verwandtschaft ersten Grades (Mutter/Vater) in eine Familienbeziehung dritten Grades (Tante Dete) und sogleich zweiten Grades (Detes Mutter). Nach dem Tod von Detes Mutter zieht Dete nach Bad Ragaz, um als Zimmermädchen im Kurhotel zu arbeiten. In diesem entsteht der Erstkontakt zur Herrschaft aus Frankfurt. Heidi erlebt die erste, frühe Kindheit (4. bis 6. Lebensjahr) bei einer im Text undefinierten Gestalt namens „alter Ursel“ in Pfäfferserdorf.
Das kleine Kind der Adelheid nahmen wir zu uns, die Mutter und ich; es war ein Jahr alt. Wie nun letzten Sommer die Mutter starb und ich im Bad drunten etwas verdienen wollte, nahm ich es mit und gab es der alten Ursel oben in Pfäfferserdorf an die Kost.26
Ein Blick auf eine geographische Karte (Abbildung 1, Seite 19) gibt Aufschluss über die Entfernungen der Orte zueinander.27 So trennen die bisherigen Lebensorte Bad Ragaz, Pfäfferserdorf und das Dörfli nur wenige Meter. Heidis Aktionsradius erstreckt sich auf ein sehr geringes Ausmaß. Sie wird zwangsweise in der lokalen Gemeinde herumgereicht.
Die Familienkonstellationen zu identifizieren, gewährt Einblicke in die familiären Einschließungsmilieus. Der Text enthält jedoch Leerstellen. Die Informationen dazu erfährt der Leser nicht durch eine auktoriale Erzählweise, sondern nur stückweise aus der Figurenrede zwischen Barbel und Dete. So kann rekonstruiert werden, wo sich Heidi aufgehalten hat und wer sich ihr angenommen hat. Doch wie Heidi gelebt hat, wird nur unzureichend dargelegt. Heidi hat keine Erinnerungen an ihre Eltern und fragt in späteren Jahren niemals nach ihnen. Die Beziehung zu Dete ist kühl und wenig liebevoll. Inwieweit Detes Mutter/Heidis Großmutter an Heidis Entwicklung beteiligt ist, wird in keiner Textstelle aufgezeigt. Einzig auf die Beziehung zur „alten Ursel“ blickt Heidi im dritten Kapitel zurück und reflektiert: […] und jetzt kam ihm alles in den Sinn: woher es gekommen war, und daß es nun auf der Alm beim Großvater sei, nicht mehr bei der alten Ursel, die fast nichts mehr hörte und meistens fror, so daß sie immer am Küchenfenster oder am Stubenofen gesessen hatte, wo dann auch Heidi hatte verweilen müssen oder doch ganz in der Nähe, damit die Alte sehen konnte, wo es war, weil sie es nicht hören konnte. Da war es dem Heidi manchmal zu eng drinnen, und es wäre lieber hinausgelaufen. So war es sehr froh, als es in der neuen Behausung erwachte und sich erinnerte, wie viel Neues es gestern gesehen hatte und was es heute wieder alles sehen könnte […].28
Der Rückblick Heidis auf diese Zeit erklärt ihren Drang, in die Natur einzutauchen bzw. entwirrt die Entkleidungsszene aus Kapitel 1. Büttner/Ewers ordnen die Szene als Befreiung von der Enge der Zivilisation und die menschliche Rückführung in die Natur ein.29 Doch scheint es hierbei um eine viel konkretere Befreiung zu gehen. So erlebt Heidi vielmehr eine drastische Verengung in den Einschließungsmilieus der ersten Lebensjahre. So kann Heidi auch keinesfalls eindeutig als Stereotyp eines sorgenfrei lebenden, unbeschwert handelnden Naturkindes eingeordnet werden.30 Die komplex angelegten, familiären Verhältnisse lassen diese reduzierte Lesart nur bedingt zu. Der Literaturwissenschaftler Tihomir Engler bezeichnet Heidi auch nicht als Naturkind, sondern als „heimatlos gewordenes Zivilisationskind“31 mit Neugier für die Natur. Als Beispiel für ein Naturkind führt er den Geißenpeter an, weil er seit der Geburt in der Natur lebt und somit nicht mehr über die Natur staunt oder Fragen zur Natur hat.
[...]
1 Vgl. Wissmer 2014, S. 17.
2 Vgl. Büttners/Ewers, 2008.
3 Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien https://www.sikjm.ch/bibliothek-spyri-archiv/johanna-spyri-archiv/ [19.09.2020]
4 Vgl. Wissmer 2014, S. 18.
5 Vgl. Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur. Von 1850 bis 1900. S. 344.
6 Vgl. Winko 1996, S. 463.
7 Johanna Spyris Roman Heidi kann brauchen, was es gelernt hat (1881) ist für die Hausarbeit einer Lektüre unterzogen worden, ist aber nicht Hauptbestandteil der Textanalyse. Einzelne, kurze Verweise auf den Nachfolgeband sind aber möglich. Die Fortsetzungsromane zu Heidi, die nach dem Tod Spyris von weiteren Autoren entstanden sind und die Geschichte um Heidi weiterführen, finden hier gänzlich keine Berücksichtigung.
8 Vgl. Geisenhanslüke 2010, S. 259.
9 Vgl. Winko 1996, S. 465.
10 Vgl. Sich 2018, S. 172.
11 Vgl. Culler 2013, S. 26.
12 Vgl. Geisenhanslüke 1997, S. 16.
13 Vgl. Winko 1996, S. 469f.
14 Vgl. Geisenhanslüke 2014, S. 337.
15 Vgl. Sich 2018, S. 78.
16 Bogdal 2014, S. 74.
17 Vgl. Sich 2018, S. 173.
18 Vgl. Bogdal 2014, S. 76.
19 Überwachen und Strafen, S. 277
20 Vgl. Überwachen und Strafen, S. 276.
21 Überwachen und Strafen, S. 38.
22 Überwachen und Strafen, S. 39.
23 Groppe 2011, S. 42.
24 Vgl. Groppe 2011, S. 43.
25 Die Großmutter von Detes Mutter ist die Schwester der Großmutter des Alm-Öhis. Der Sohn des Alm-Öhis heiratete Detes Schwester Adelheid. Aus dieser Beziehung „entsprang“ Heidi.
26 Heidis Lehr- und Wanderjahre 2012, S. 15.
27 Die realen Orte gelten als Vorlage für Spyri. Da es sich hierbei aber um einen fiktionalen Text handelt, könnten die Entfernungen der Orte zueinander aber beliebig groß sein. Die Abbildung kann daher kein Beleg sein, aber zumindest als mögliche Darstellung herhalten. Zusätzlich ist auf der Karte das „Heidiland“ als Touristenattraktion zu sehen, was nicht zufällig an „Disneyland“ erinnert.
28 Heidis Lehr- und Wanderjahre 2012, S. 30.
29 Vgl. Büttner/Ewers 2008, S. 18.
30 Vgl. Hintereder-Emde 2006, S. 382.
Häufig gestellte Fragen zu "Heidis Lehr- und Wanderjahre"
Was ist der thematische Fokus dieser Analyse von "Heidis Lehr- und Wanderjahre"?
Diese Analyse konzentriert sich auf die Darstellung von Einschließungsmilieus im Roman und untersucht, inwieweit diese die Bildungsentwicklung der Hauptfigur Heidi beeinflussen. Es wird die These verfolgt, dass diese Milieus eine vielfältige Bildungsentwicklung eher verhindern als fördern.
Welche methodische Herangehensweise wird in der Analyse verwendet?
Die Analyse wählt einen poststrukturalistischen bzw. diskursanalytischen Ansatz. Anstatt sich auf den Mythos oder die Autorin zu konzentrieren, steht der Text selbst im Mittelpunkt und wird als Teilmenge historischer Diskurse betrachtet. Die Arbeit bezieht sich auf Michel Foucaults "Überwachen und Strafen", um die Konzepte von Macht, Disziplin und Einschließungsmilieus zu untersuchen.
Welche Einschließungsmilieus werden im Roman identifiziert und analysiert?
Die Analyse untersucht verschiedene Lebensabschnitte und Orte in Heidis Leben als Einschließungsmilieus, darunter die frühen Lebensjahre im Dörfli, die Zeit auf der Alm beim Großvater und den Aufenthalt in der Stadt. Es wird analysiert, wie diese Umgebungen Heidis Entwicklung prägen.
Wie wird der Begriff "Bildung" in der Analyse definiert und angewendet?
Die Analyse verwendet eine allgemeine Definition von "Bildung" als zielgerichtete Entwicklung der gesamten Persönlichkeit. Es wird untersucht, inwieweit Heidi in den verschiedenen Einschließungsmilieus Bildungszuwachs erfährt und wie sich dies auf ihre Handlung und die Interaktion mit anderen Figuren auswirkt.
Welche Rolle spielt die Natur in Heidis Bildungsentwicklung aus der Sicht dieser Analyse?
Die Analyse hinterfragt die vereinfachte Vorstellung von Heidi als unbeschwertem Naturkind. Es wird untersucht, ob die Natur bzw. die Bergwelt selbst als ein mögliches Einschließungsmilieu betrachtet werden kann, das Heidis Entwicklung sowohl fördert als auch einschränkt.
Was ist die Relevanz der Verbindung von Foucaults Theorien und "Heidis Lehr- und Wanderjahre"?
Die Relevanz liegt darin, dass diese spezifische Verbindung in der bisherigen Forschung noch nicht hergestellt wurde. Die Analyse zielt darauf ab, neue Fragen an einen Kinderbuchklassiker zu stellen, indem sie die im Roman dargestellten Machtstrukturen und Diskurse aus einer foucaultschen Perspektive beleuchtet.
Welche Forschungslücken werden in der Einleitung angesprochen?
Es wird angemerkt, dass die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Spyris "Heidi" unzureichend vorangeschritten ist und Forschungslücken aufweist. Kritische Lesarten sind unterrepräsentiert und Uneinigkeit besteht bei der Einordnung des Textes als Bildungsroman.
Wer ist Tihomir Engler und wie positioniert er sich zu Heidi als "Naturkind"?
Tihomir Engler, ein Literaturwissenschaftler, bezeichnet Heidi nicht als Naturkind, sondern als "heimatlos gewordenes Zivilisationskind" mit Neugier für die Natur. Er argumentiert, dass ein wahres Naturkind, wie der Geißenpeter, die Natur nicht mehr bestaunt, da es von Geburt an darin lebt.
- Quote paper
- Student Thomas Roesnick (Author), 2020, Einschließungsmilieus in "Heidi Lehr- und Wanderjahre" von Johanna Spyri, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1076158