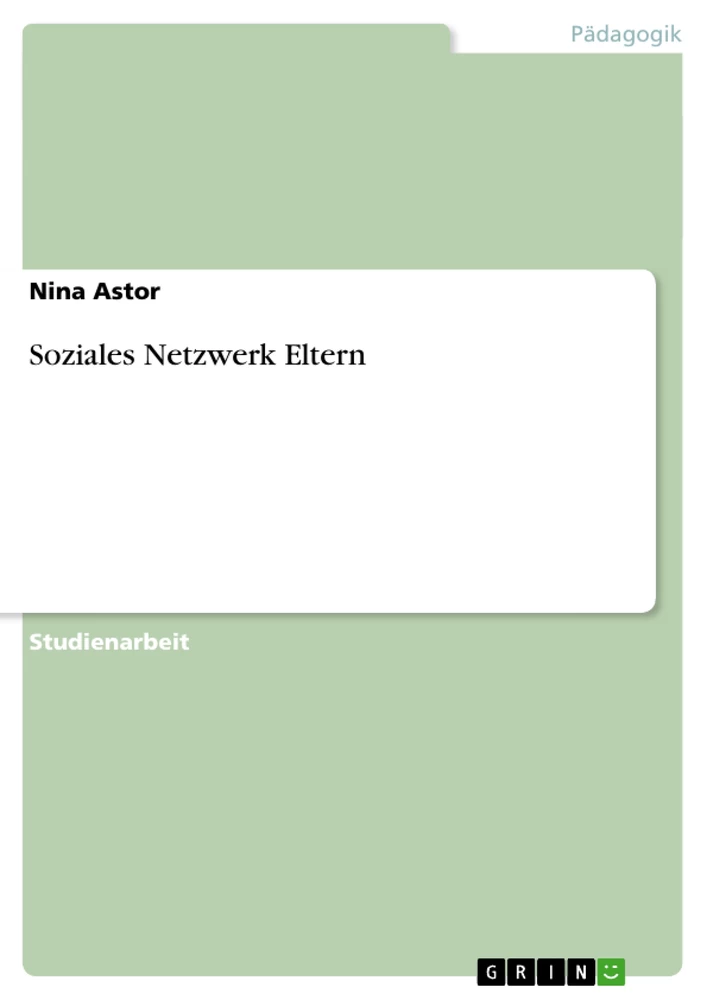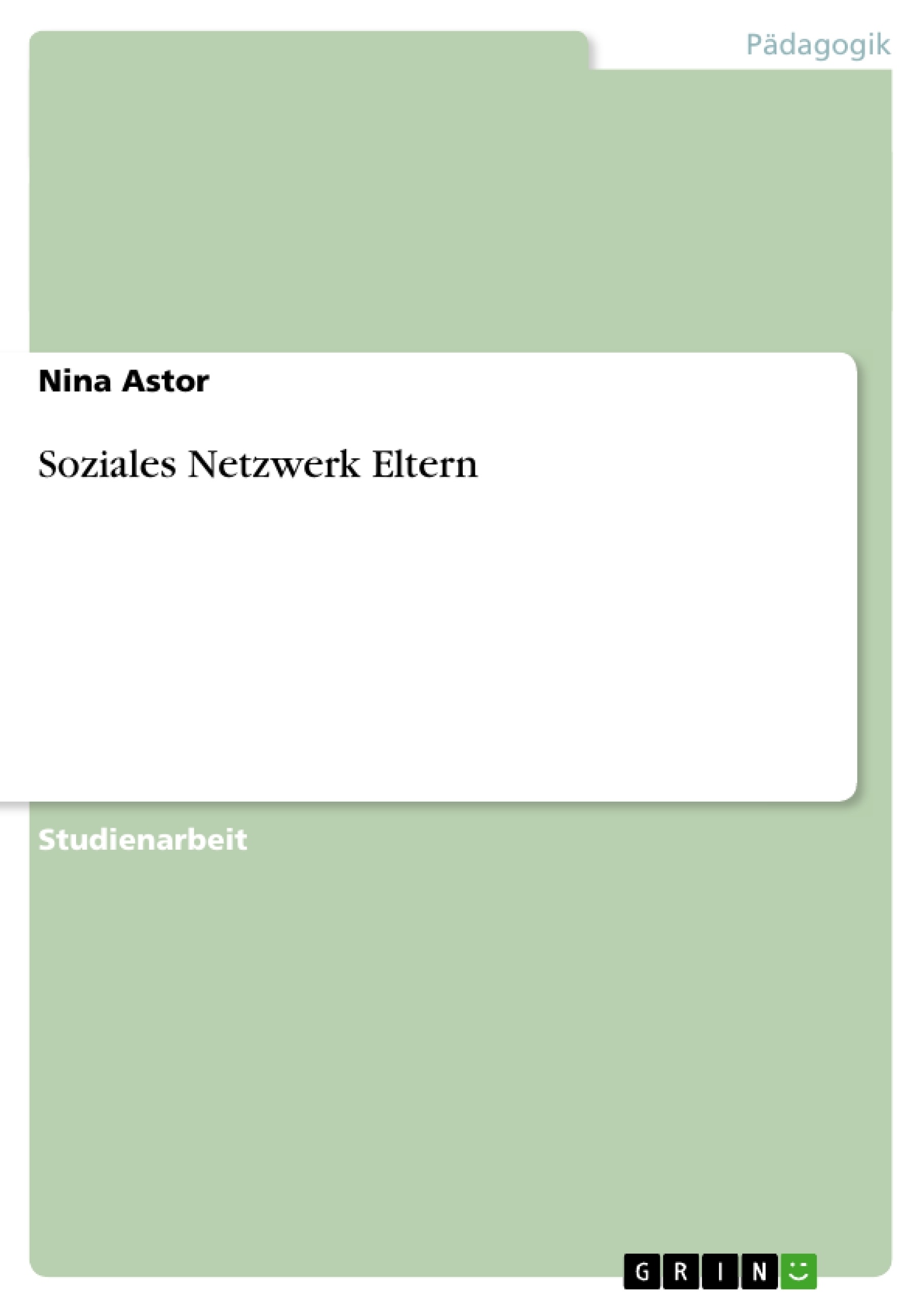Inhaltsverzeichnis
Einleitung... .
I Entwicklungen, die der Elternschaft vorausgehen
a) Der Begriff „soziales Netzwerk“
b) Das Individuum im Netzwerk
c) Frauennetze – Männernetze
d) Auf der Suche nach einem dauerhaften Partner
II Vom Paar zum Elternpaar
a) Soziale Bezugsgruppen
b) Erwartungen und Einstellungen
c) Veränderungen
Schlussbetrachtung
III Abbildungen
IV Literatur
Einleitung
In dieser Arbeit soll der Schwerpunkt auf dem Prozess der Veränderung sozialer Netzwerke liegen, der offensichtlich immer mit dem Prozess des „Elternwerdens“ einhergeht.
Es existieren viele Studien über die Zusammenhänge von äußeren Umständen und dem Empfinden der Elternschaft von Mutter bzw. Vater. Hierbei ist grundsätzlich von Eltern um die 30 in einer offiziellen Paarkonstellation die Rede, die ihr erstes Kind erwarten. Untersuchungsrelevant erscheint zumeist der Zeitraum von der Kenntnis beider Partner von der Schwangerschaft bis ungefähr zum vollendeten ersten Lebensjahr des Kindes.
Mit den statistischen Ergebnissen solcher Studien möchte ich mich jedoch nicht allzu ausgiebig befassen, sondern in erster Liniemit der Frage nach dem „Warum?“ Zentral dabei zwei Fragestellungen:, 1.Warum hat die Aussicht auf ein Kind so starken Einfluss auf die Erwartungen, Bedürfnisse und Empfindungen werdender Eltern?, 2. Warum ist die Rolle des sozialen Netzwerkes dabei gleichzeitig so wichtig, aber auch kritisch zu sehen?
Im ersten Teil meiner Ausführungen möchte ich deswegen zunächst kurz auf die Entwicklungen eingehen, die vor dem Ereignis „Elternschaft“ stehen, während der zweite Teil Antwort auf die beiden o.g. Fragestellungen zu geben versucht.
I Entwicklungen, die der Elternschaft vorausgehen
a) Der Begriff „soziales Netzwerk“
Aus ökonomischer Sicht[1]lässt sich „soziales Netzwerk“ definieren als vertrauensvolle Kooperation zwischen Individuen oder Korporationen zur Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen. Man verpflichtet sich auf gemeinsame Ziele, zu deren Realisierung jeder Partner seinen Beitrag leistet. Die Produktivität und Dynamik solcher Verbindungen liegt begründet in der ständigen Notwendigkeit des Verhandelns von Problemlösungen – diese Notwendigkeit stellt keine Schwäche dar, sondern ein Potential.
Aus dieser Definition geht deutlich hervor, dass die Partner bereit sind, Zeit und Mühe in den Auf-, den Ausbau und die Erhaltung des sozialen Netzwerks zu investieren, ganz klar aber dabei von einem Nutzen ausgehen, den ihnen ihr Aufwand bringen soll.
Diese Definition lässt sich direkt übertragen auf die zwischenmenschliche Ebene, auf der sie über materielle Aspekte in emotionaler Hinsicht noch mehr Tiefe erhält.
Der Begriff „Netz“ an sich verdeutlicht die Aufgabe des sozialen Netzwerks: etwas bzw. jemand soll aufgefangen werden – wie einen Akrobaten auf dem Hochseil soll es uns absichern und in bedrohlichen Situationen schützen.
Entwicklung ist quasi erst durch diese Absicherung möglich, denn wer wagt sich schon ohne Sicherheitsnetz auf das Hochseil? Situationen und Entwicklungsphasen, in denen der einzelne sich orientierungslos und unsicher fühlt, bedürfen sozialer Unterstützung. Ebenso wünscht der Mensch sich Bezugspersonen, mit denen er Positives teilen kann. Treffender formuliert findet sich dies bei Christine und Klaus Ettrich:
„Für die Entwicklung des Individuums ist von Bedeutung, dass über die sozialen Netzwerke seine Entwicklung über Anregung, Zuwendung und Kontrolle durch dir rasche Verfügbarkeit von Bezugspersonen und anderen unterstützenden Personen mit ihren psychosozialen und materiellen Ressourcen gesichert ist.“[2]
Dabei sind die Verbindungen in den sozialen Netzwerken von unterschiedlicher Intensität und Dauer, die verschiedenen Bereiche sozialer Netzwerke können einander ergänzen und auch überschneiden.
b) Das Individuum im Netzwerk
Unabhängig vom Geschlecht können wir davon ausgehen, dass das Individuum sich in den unterschiedlichen Bereichen seiner Netzwerke unterschiedlich präsentiert, da unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse wahrgenommen werden. Am Arbeitsplatz tritt die Leistungsfähigkeit in den Vordergrund, im Sportverein das Engagement, unter Bekannten der Unterhaltungswert einer Person. Je weniger emotional intensiv diese Relationen sind, desto selektiver werden einzelne Aspekte in den Vordergrund gerückt, eine Tatsache, der das Individuum durch Betonung dieser Aspekte gerecht zu werden versucht.
Es ließe sich praktisch sagen, dass der Einzelne in den verschiedenen Bereichen seiner sozialen Netzwerke jeweils unterschiedliche Rollen wahrnimmt.
Da sich der Mensch tagtäglich in den verschiedensten Umfeldern bewegt, finden sich eine Menge Möglichkeiten für das (Ver-)Knüpfen sozialer Netzwerke, z.B. die Schule bzw. der Arbeitsplatz, die Nachbarschaft oder der Sportverein. Wie der Einzelne seine Netzwerkmöglichkeiten wahrnimmt und nutzt, hängt nicht selten mit Faktoren wie Grad der Schulbildung, finanzielle Situation, Beruf sowie die Qualität der interfamiliären Beziehungen[3].
Denn als dem Individuum am nächsten stehend sind hier sicherlich die Familie im engeren Sinn (Eltern und Geschwister), die Verwandten sowie enge Freunde zu sehen. Diese
Bezugspersonen haben direkten Anteil am Leben des anderen, durch räumliche und/oder emotionale Bindung. Die stärkste sowohl räumliche als auch emotionale Bindung ist normalerweise die an die Familie. Dementsprechend sind auch hier die Erwartungen und Bedürfnisse am größten, von diesen Menschen erwartet man in jeder Situation sofortige und wirksame Unterstützung - dementsprechend anfälliger für Krisen sind aber diese von großer emotionaler Offenheit geprägten Beziehungen auch.
c) Frauennetze – Männernetze
Laut Literatur scheint es eine Tatsache zu sein, dass an die Frau generell nach wie vor höhere Anforderungen betreffend die soziale Unterstützung gestellt werden als an den Mann[4]. Vielleicht lässt sich dies in einem weiblichen Bedürfnis nach Harmonie begründen, welche in den einzelnen Bereichen der sozialen Vernetzung der Frau durch relativ intensive und damit aufwendigere Beziehungen zu selbst emotional unwichtigen Personen (dem Kollege am Arbeitsplatz, der Vorsitzenden des Sportvereins) abgesichert werden soll. Diese Beziehungen zu erhalten erfordert natürlich Unterstützung durch zusätzliche Ressourcen von anderer Seite, die jedoch nicht immer gestellt werden.
Männer hingegen setzen ihre sozialen und auch materiellen Ressourcen gezielter ein bzw. eher nur dort, wo der Einsatz durch Nutzen gerechtfertigt ist – Harmonie spielt dabei keine übergeordnete Rolle.
Daraus könnte man schließen, dass Frauen sensibler auf starke Veränderungen in der sozialen Vernetzung reagieren als Männer.
d) Auf der Suche nach einem dauerhaften Partner
Der Schritt zur Gründung einer eigenen Familie beginnt normalerweise mit einer dauerhaften Beziehung zu einem außerfamiliären Partner, von gleicher oder gar größerer Intensität, wie sie vorher meist nur zur Ur- Familie bestand. Solch eine intensive Beziehung fordert einen Großteil der individuellen Ressourcen, die z.T. von anderen Beziehungen abgezogen werden müssen.
Laut Ettrich und Ettrich ist es „der Partner bzw. die Partnerin [, die] als wichtigste Quelle der
sozialen Unterstützung genannt wird“[5]
Problematisch dabei ist, dass der Einzelne denkt, einen anderen Menschen zu seinem Partner gemacht zu haben, dessen Vorstellungen und Zielen größtenteils mit den eigenen übereinstimmen[6]. Die darüber hinausgehende Andersartigkeit wird als positiv und ergänzend angesehen – birgt aber natürlich Konfliktpotential Hier treffen nicht nur zwei Individuen mit ihren jeweils eigenen Bereichen sozialer Netzwerke aufeinander, sondern auch (wenn wir von einem heterogenen Verhältnis ausgehen) zwei Individuen, die recht unterschiedliche Einstellungen und Vorstellungen bezüglich sozialer Unterstützung haben.
Auch wenn mit der Wahl eines festen Partners eine gewisse Abgrenzung von der ursprünglichen Familie einhergeht, ist die Partnerbeziehung nichtsdestotrotz potentiell als zeitlich begrenzt zu sehen, was bei der Familie nicht möglich ist.
„[...] Eltern- und Kindschaft können nicht gekündigt werden. Sie sind auf Nähe, Leben an einem gemeinsamen Ort angelegt.“[7]
Dies ist allerdings nur bis zu dem Punkt vollkommen zutreffend, an dem das Individuum neben seiner Rolle als Kind gleichzeitig die Rolle des Elternteils wahrnehmen muss. Die Ur-
Familienmitglieder müssen sich von ihren bisherigen Rollen in solchem Maße distanzieren, dass Raum geschaffen werden kann für einen neuen wichtigen Knotenpunkt im sozialen Netz der Betroffenen – das Kind. Das Erwarten eines Kindes betrifft also nicht nur die Beziehung beider Partner, sondern auch ihre soziale Vernetzung.
II Vom Paar zum Elternpaar
a) Soziale Bezugsgruppen
Der „status quo ante“ ließe sich also folgendermaßen skizzieren: Es gibt zwei Hauptbereiche der soziale Vernetzung des Elternpaares, die beim Übergang zur Elternschaft eine wichtige Rolle spielen. Der erste Bereich betrifft die Vernetzung des Paares. Hier liegen zwei Ebenen vor (Abbildung 1).
Die erste ist die Ebene des individuellen Netzwerks, in dem es eine untergeordnete Rolle spielt, ob man sich in einer dauerhaften Beziehung befindet, z.B. im Sportstudio – aber vielleicht auch bei der langjährigen besten Freundin. Die zweite Ebene ist die des Paares, in der man sich deutlich als Teil einer Zweierkonstellation empfindet, z.B. im Bekanntenkreis des jeweils anderen, oder auch in den beiden Familienkreisen.
Zum Teil können sich diese Bereiche natürlich überschneiden.
Vom Zeitpunkt der sichtbaren Schwangerschaft an ist es (zumindest der Frau) nicht mehr möglich, auf der Ebene der individuellen Vernetzung a) ihre feste Gebundenheit zu „verbergen“ (bei der die Gesellschaft zunächst davon ausgeht, dass sie besteht), b) einen besonderen Status abzuwehren. Besonderer Status meint, dass Schwangere Frauen allgemein als besonders sensibel und natürlich mit zunehmenden Grad der Schwangerschaft als hilfebedürftiger angesehen werden.
Der zweite Hauptbereich betrifft den Bereich, der das Paar nun als werdende Eltern gegenübersteht (Abbildung 2). Da man sich durch ein Kind sehr fest bindet[8], liegt nun quasi ein
„Familienstatus“ vor. Das Kind selber als „Urheber“ dieses Statuswechsels wird dabei zunächst ausgeklammert.In diesen beiden Hauptbereichen verhält man sich unterschiedlich, man definiert sich über unterschiedliche Faktoren und wird dementsprechend auch unterschiedlich wahrgenommen.[9]
b) Erwartungen und Einstellungen
Auch wenn wir davon ausgehen, dass eine Schwangerschaft bzw. ein Kind vom Paar gewollt ist, muss doch klar sein, dass es sich hier um eine Krise[10]handelt, die den „status quo“ der Beziehung bedroht. Da bei der Partnerwahl aber von gemeinsamen Vorstellungen und Wünschen ausgegangen ist, erwarten werdende Eltern nach Ettrich und Ettrich
„[..] von ihrer Partnerin bzw. ihrem Partner jederzeitpraktische Hilfe,Unterstützungbei größeren Schwierigkeiten,vertrauenihm ganz, sind sich sicher, dass der andereemotional stützt, das Gefühl derGeborgenheitvermittelt [...]“.[11]
Ebenso erwartet das Paar diese Unterstützung auch von den anderen ihnen nahestehenden sozialen Bezugsgruppen, besonders von der eigenen Ur-Familie.
Hier liegen die Ursachen für Veränderungen im sozialen Netzwerk, die weniger in einer Veränderung bzw. einen Wechsel der Bezugspersonen resultieren, als viel mehr in einer Modifikation der bestehen Bindungen.
Je mehr Bezug das Individuum auf andere Personen nehmen muss, desto mehr wird es durch die zunehmende Forderung nach Anpassung eingeschränkt – auch, wenn zu diesen Personen eine Beziehung von großer emotionaler Offenheit besteht /Abbildung 3).
Durch ein Kind findet sich das Individuum in einer völlig neuen Rolle wieder, was einen neuen Anpassungsprozess des Individuums erfordert und die Erwartungen und Einstellungen aller sozialer Bezugspersonen zueinander verändert.
Diese „Anpassung an die veränderte Situation kann mehr oder weniger befriedigend vollzogen werden“[12].
c) Veränderungen
„Die Umwandlung der Dyade in eine Triade bringt ein Ungleichgewicht des Personen-Umwelt-Bezugs mit sich, dass sich in erlebten Veränderungen zeigt“ bzw. „[...] die von den Partnern eine Umgestaltung ihres Zusammenleben erfordert“
Vor der Geburt
Zwischen den beiden Partnern der Paarbeziehung hatte bereits ein Anpassungsprozess stattgefunden. Durch die neuen Rollenempfindungen der werdenden Eltern findet (wie bereits erwähnt) eine erneute Anpassung statt. Hierbei spielt der geschlechtsspezifische Unterschied im wahrnehmen sozialer Bindungen eine zentrale Rolle[13].
Die Frau ist durch die körperlichen Bedingungen den größeren Veränderungen unterworfen. Sie konzentriert sich sehr auf ihre Bedürfnisse, trägt sich doch die direktere Verantwortung für das ungeborene Kind. Ihr tägliches Umfeld begegnet ihr anders, zumeist in einer positiveren Art und Weise. Der Mann erfährt diese Veränderungen zunächst nur aus zweiter Hand, dennoch wird die vollste Unterstützung von ihm gefordert, während seine Partnerin ihre Ressourcen möglicherweise fast vollkommen auf sich selber und das Kind fokussiert[14].
Das heißt, es kommt sowohl während der Schwangerschaft als auch in den ersten Monat nach der Geburt des Kindes[15]zu einer teilweisen Entfremdung der Partner, die quasi eine Neudefinierung der Paarbeziehung zur Folge hat.
Je nachdem, wie gut das Paar diese Anforderungen bewältigen kann, ist die zusätzliche Unterstützung durch di jeweilige Ur-Familie gefordert. Problematisch hierbei ist, das mit der Gründung einer eigenen Familie eine Distanzierung einhergeht[16], man ist Kind und spürt gleichzeitig den Druck der kommenden Elternschaft, während die Ur-Eltern sich von ihrem Kind abnabeln müssen, um ihm neben der sozialen Unterstützung genug Entwicklungsfreiraum zu lassen . Dabei ist es wünschenswert, dass die Bestrebungen der Ur-Familie von männlicher Seite mit denen der Ur-Familie von weiblicher Seite übereinstimmen bzw. nicht konkurrieren, denn nach Bronfenbrenner (1989) ist „[wächst] das entwicklungsfördernde Potential eines Lebensbereiches mit der Anzahl der unterstützenden Verbindungen zu anderen Lebensbereichen.“
Da das Paar stark von den individuellen, beziehungstechnischen und familiären Veränderungsprozessen in Anspruch genommen wird, werden Verbindungen zu Freunden, seien es die gemeinsamen oder individuellen, eingeschränkt. Dabei kommt es sicherlich darauf an, ob es sich um Freunde handelt, die sich im gleichen Entwicklungsprozess befinden bzw. ihn bereits erfolgreich meistern konnten, oder ob es sich um Freunde handelt, sich mit der Vorstellung der Elternschaft überhaupt nicht identifizieren können. Effektivste soziale Unterstützung wird natürlich dort gesucht, wo Erfahrung vermutet wird. Deswegen ist es nicht ungewöhnlich, wenn alte Kontakte aufgrund der o.g. mangelnden Identifikation abbrechen bzw. neue Kontakte geknüpft werden.
Nach der Geburt
Somit kommt es zwar nach der Geburt wieder zu verstärkten Kontakten zu Freundeskreisen, jedoch hat hier z.T. ein Wechsel der Bezugspersonen stattgefunden[17].
In der Partnerschaft hat im positiven Fall eine gut Anpassung an die neuen Lebensumstände stattgefunden – generell bewirkt das erfolgreiche bewältigen einer Krisensituation eine Stärkung der emotionalen Bindung zueinander. Im umgekehrten Fall könnte sich das negative Erleben der Schwangerschaft und der Elternschaft möglicherweise eine unüberwindliche Kluft zwischen den Partner erzeugen und gleichermaßen den Grundstein für eine spätere Trennung legen. Natürlich würde sich eine solche Basis wahrscheinlich negativ auf die Kindesentwicklung auswirken:
„Sich stärker belastet fühlende Eltern erleben die Elternschaft negativer und entwickeln eher Gefühle der Enttäuschung, was sich auchauf die dem Kind gegenüber gezeigten Affekte [ ...] und allgemein auf die Reaktionsbereitschaft dem Kind gegenüber Auswirken kann. Diese Variablen wiederum sind mit der Entwicklung des Kindes eng verknüpft [...].“[18]
Zu den Ur-Familien herrscht nach der Geburt des Kindes zumeist auch eine bessere Beziehung, wohl auch bedingt durch den vorausgegangenen längeren Zeitraum, der zur Modifizierung der sozialen Verknüpfungen genutzt werden konnte, wenn er auch noch nicht abgeschlossen ist.
Schlussbetrachtung
Die Rolle der sozialen Netzwerke ist deswegen so bedeutsam für den Übergang zur Elternschaft, wie für alle anderen krisenhaften Ereignisse im Leben auch, da sie den Hintergrund, den Kontext für alle Entwicklungen im menschlichen Leben darstellen.
Dabei bleiben Verbindungen nicht konstant, sondern sind, wie in der vorliegenden Arbeit an einem prägnanten Beispiel erläutert, Veränderungsprozessen unterworfen.
Ob sie als positiv oder negativ empfunden werden, ist zum größten Teil gebunden an Handlungstypen, Kompetenzen und bereits gemachten Erfahrungen – in Bezug auf die Elternschaft zusammengefasst im Prozessmodell der elterlichen Fürsorge bei Belsky (Abbildung 4).
III Abbildungen
Abbildung 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Individuum
zunehmende Forderung (Ehe-)Paar
nach Anpassung Freunde
Familie im umfassenden Sinne
Gesellschaft
Abbildung 3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Arbeit Entwicklung des Kindes
Abbildung 4: Prozessmodell der Elternfürsorge nach Belsky[19]
IV Literatur
Bauer, M., Übergang zur Elternschaft: Erlebte Veränderungen, in: Psychologie in Erziehung und Unterricht, 39. Jg., S. 96-108 (1992), Ernst Reinhardt Verlag München Basel.
Buer, F., Cramer, A. und Reichwein, R., Umbrüche in der Privatsphäre, Bielefeld (1993), S. 237-266.
Ettrich, C., Ettrich, K., Die Bedeutung sozialer Netzwerke und erlebter sozialer Unterstützung beim Übergang zur Elternschaft. Ergebnisse einer Längsschnittstudie, in: Psychologie in Erziehung und Unterricht, 42. Jg., S. 29-39 (1995), Ernst Reinhardt Verlag München Basel.
Wicki, W. et al., Soziale und innerfamiliale Ressourcen beim Übergang zur Elternschaft, in: Psychologie in Erziehung und Unterricht, 42. Jg., S. 20-28 (1995), Ernst Reinhardt Verlag München Basel.
Weyer, J. (Hg.), Soziale Netzwerke – Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung (2000), Oldenbourg .
[...]
[1]Weyer, J. (Hg.), Soziale Netzwerke – Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung, Oldenbourg (2000).
[2]in: Psychologie in Erziehung und Unterricht, 42. Jg., S. 29-39 (1995), Ernst Reinhardt Verlag München Basel.
[3]Vgl. Wicki, W. et al., Soziale und innerfamiliale Ressourcen beim Übergang zur Elternschaft in: Psychol., Erz., Unterr., 42 Jg., S. 20-28 (1995)
[4]Vgl. Buer, Cramer & Reichwein, Umbrüche in der Privatsphäre, Bielefeld (1993), S. 258-259
[5]in: Psychol., Erz., Unterr., 42. Jg., S. 29-39 (1995).
[6]siehe Punkt1, a) Der Begriff „soziales Netzwerk“
[7]Vgl.: Buer, Cramer und Reichwein, S. 251
[8]siehe PunktI, d) Auf der Suche nach einem dauerhaften Partner
[9]siehe PunktI, b) Das Individuum im Netzwerk
[10]Vgl. Bauer, M. Übergang zur Elternschaft: Erlebte Veränderungen, in: Psyhol., Erz., Unterr., 39. Jg, S. 96-108 (1992)
[11]in: Psychol., Erz., Unterr., 42. Jg., S. 29-39 (1995)
[12]Wicki, W. et al., Soziale und innerfamiliale Ressourcen beim Übergang zur Elternschaft, in: Psyhol., Erz., Unterr., 42. Jg, S. 20-28 (1995)
[13]siehe PunktI, c) Frauennetze - Männernetze
[14]siehe Punkt II,b) Einstellungen und Erwartungen
[15]Die als weiteres kritisches Ereignis beim Übergang zur Elternschaft möglicherweise nähere Betrachtung verdient, was in dieser Arbeit jedoch nicht weiter ausgeführt werden soll.
[16]siehe Punkt I,d) Auf der Suche nach einem dauerhaften Partner
[17]Vgl. Ettrich und Ettrich, S. 37
[18]Wicki, W. et al., S 27
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Schwerpunkt dieser Arbeit zum Thema soziale Netzwerke und Elternschaft?
Der Schwerpunkt liegt auf dem Veränderungsprozess sozialer Netzwerke, der mit dem "Elternwerden" einhergeht. Die Arbeit untersucht, warum die Aussicht auf ein Kind die Erwartungen, Bedürfnisse und Empfindungen werdender Eltern beeinflusst und welche Rolle das soziale Netzwerk dabei spielt.
Welche Entwicklungen werden vor der Elternschaft betrachtet?
Die Arbeit geht auf den Begriff "soziales Netzwerk" ein, betrachtet das Individuum im Netzwerk, untersucht Unterschiede zwischen Frauen- und Männernetzwerken und beleuchtet die Suche nach einem dauerhaften Partner.
Wie wird der Begriff "soziales Netzwerk" definiert?
Aus ökonomischer Sicht wird "soziales Netzwerk" als vertrauensvolle Kooperation zwischen Individuen zur Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen definiert. Auf zwischenmenschlicher Ebene erhält diese Definition durch emotionale Aspekte noch mehr Tiefe.
Welche Rolle spielt das Individuum im Netzwerk?
Das Individuum präsentiert sich in den verschiedenen Bereichen seiner Netzwerke unterschiedlich, je nach den wahrgenommenen Erwartungen und Bedürfnissen. Es nimmt unterschiedliche Rollen in verschiedenen Umfeldern wahr.
Gibt es Unterschiede zwischen Frauen- und Männernetzwerken?
Laut Literatur werden an Frauen höhere Anforderungen bezüglich sozialer Unterstützung gestellt als an Männer. Frauennetzwerke sind möglicherweise harmonieorientierter und aufwendiger, während Männer ihre Ressourcen gezielter einsetzen.
Wie beeinflusst die Suche nach einem dauerhaften Partner die sozialen Netzwerke?
Eine dauerhafte Beziehung zu einem außerfamiliären Partner fordert einen Großteil der individuellen Ressourcen, die z.T. von anderen Beziehungen abgezogen werden müssen. Es treffen zwei Individuen mit unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich sozialer Unterstützung aufeinander.
Welche sozialen Bezugsgruppen spielen beim Übergang zur Elternschaft eine Rolle?
Es gibt zwei Hauptbereiche: Die Vernetzung des Paares (individuelles Netzwerk und Ebene des Paares) und der Bereich, der das Paar als werdende Eltern gegenübersteht (Familienstatus).
Welche Erwartungen und Einstellungen spielen eine Rolle?
Werdende Eltern erwarten praktische Hilfe, Unterstützung bei Schwierigkeiten, Vertrauen und emotionale Unterstützung von ihrem Partner und anderen Bezugsgruppen.
Wie verändern sich die sozialen Netzwerke während der Schwangerschaft und nach der Geburt?
Es kommt zu einer Modifikation der bestehenden Bindungen. Das Individuum findet sich in einer neuen Rolle wieder, was einen neuen Anpassungsprozess erfordert. Verbindungen zu Freunden können eingeschränkt werden, und es kann zu einem Wechsel der Bezugspersonen kommen.
Welche Rolle spielen die Ur-Familien beim Übergang zur Elternschaft?
Die Ur-Familien müssen sich von ihren bisherigen Rollen distanzieren, um Raum für einen neuen Knotenpunkt (das Kind) zu schaffen. Die Ur-Eltern müssen sich von ihrem Kind abnabeln, um Entwicklungsfreiraum zu lassen.
Wie wirkt sich die Elternschaft auf die Partnerschaft aus?
Es kommt sowohl während der Schwangerschaft als auch nach der Geburt des Kindes zu einer teilweisen Entfremdung der Partner, die eine Neudefinierung der Paarbeziehung zur Folge hat. Erfolgreiche Bewältigung stärkt die Bindung, während negative Erfahrungen eine Kluft erzeugen können.
Warum sind soziale Netzwerke für den Übergang zur Elternschaft wichtig?
Sie stellen den Hintergrund und Kontext für alle Entwicklungen im menschlichen Leben dar und sind somit auch für die Bewältigung krisenhafter Ereignisse wie der Elternschaft von Bedeutung.
Welche Modelle und Abbildungen werden in der Arbeit verwendet?
Es werden Abbildungen zur Veranschaulichung der sozialen Vernetzung des Paares und des Individuums sowie das Prozessmodell der Elternfürsorge nach Belsky verwendet.
- Quote paper
- Nina Astor (Author), 2002, Soziales Netzwerk Eltern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107600