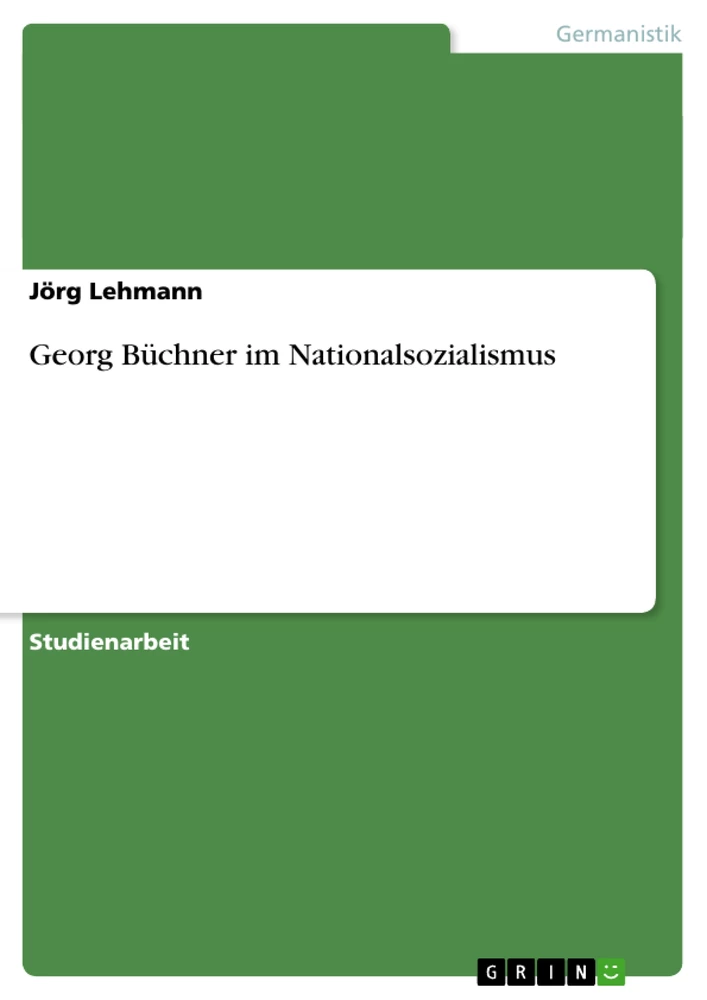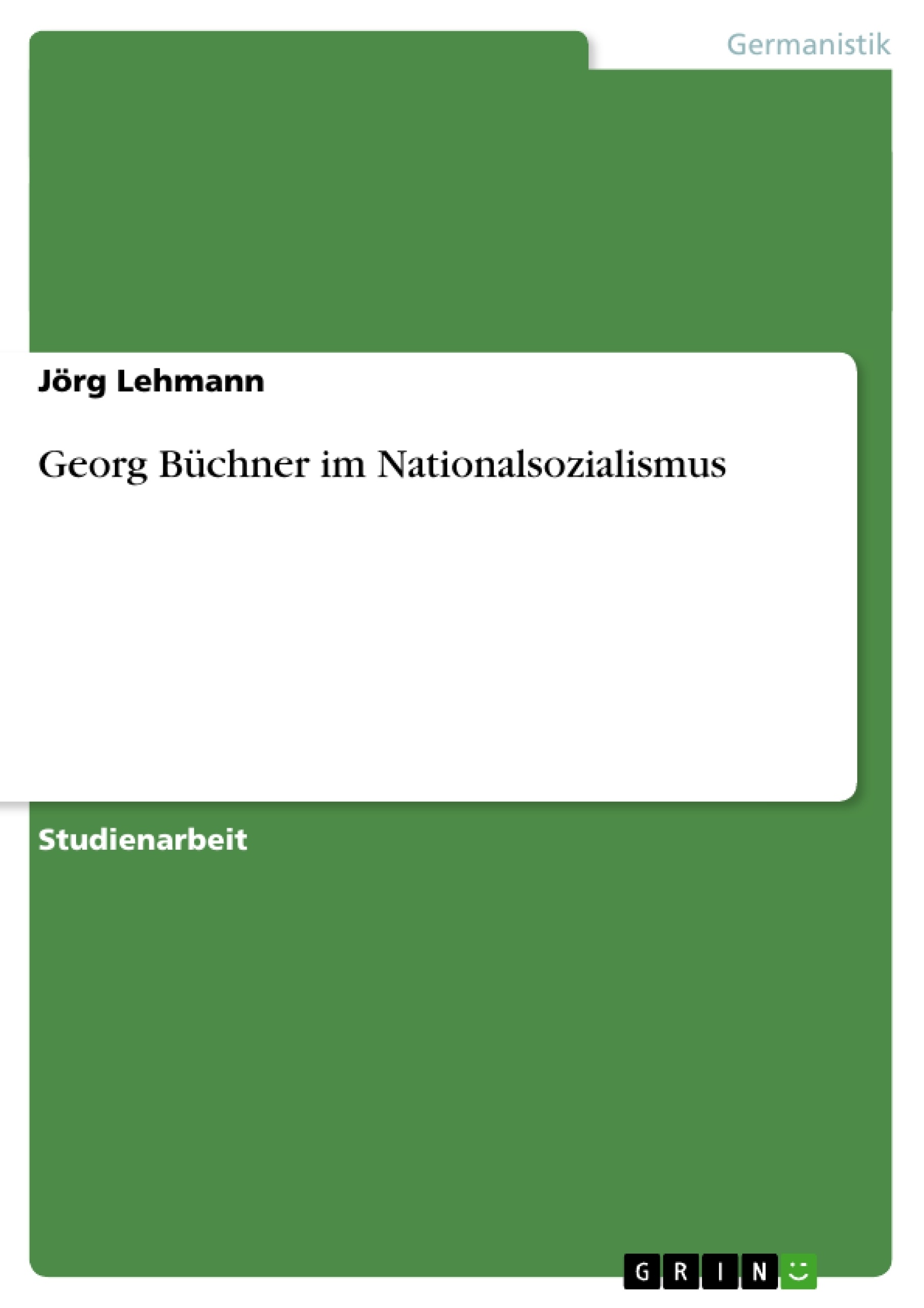Hier handelt es sich um eine Zusammenfassung mehrerer Biographien und Rezeptionsanalysen des Vormärzautors Georg Büchner mit Blick auf seine Interpretation während der Zeit des Nationalsozialismus.
Das NS-Regime versuchte ihn einerseits in seine Propaganda einzubauen andererseits war Büchner aber teilweise unbequem für die Ideologie des Nationalsozialismus...
Gliederung
A. Vorbemerkungen und Einleitung: Kunst und Nationalsozialismus
B. Hauptteil: Georg Büchner aus völkisch- nationaler Sichtweise
B.1. Vorgänger der nationalsozialistischen Büchnerinterpretationen
B.1.1. Adolf Bartels
B.1.2. Arthur Moeller van den Bruck
B.1.3. Josef Nadler
B.1.4. Friedrich Gundolf
B.2. Büchner in der Betrachtung durch Literatur- wissenschaftler des 3.Reiches
B.2.1. Vergleich der Büchnerreflexion zur Weimarer Zeit und im 3.Reich
B.2.2. Karl Vietor
B.2.3. Arthur Pfeiffer
B.2.4. Emil Staiger
B.2.5. Josef Magnus Wehner
B.2.6. weitere (darauf aufbauende) Interpretationsmodelle im 3.Reich
C. Schluss: Wertung / Zusammenfassung
D. Verwendete Literatur
A. Kunst und Nationalsozialismus
Bei der Beschäftigung mit der Kunstbetrachtung durch den Nationalsozialismus stößt man auf die Schwierigkeit, dass zumindest in den ersten 5 Jahren nach der Machtübernahme kein einheitliches Kunstverständnis, bzw. keine einheitliche nationalsozialistische Kunstpolitik existierte. Dieser Zustand hatte vor allem zwei Ursachen. Zum Einen stand der einheitlichen Kunstpolitik ein Kompetenzchaos im Wege, wie es eigentlich typisch für das national – sozialistische System war. Genauso wie sich bei Abwehr und Reichsicherheitshauptamt, bei Wehrmacht und SS oder bei NS-Ortsgruppenleitern und Bürgermeistern Kompetenzen überschnitten und ein ständiger Streit um deren Ausweitung herrschte, genauso wurde auch über die Prägung der Kunstpolitik gestritten. Auch wenn Propagandaminister Josef Goeppels seine Konkurrenten Wilhelm Frick, Alfred Rosenberg und Robert Ley im Streit um die Oberhoheit über die Kunstpolitik nacheinander ausschalten konnte, wurde auf niedrigerer Ebene immer noch gestritten. So „war Kunstpolitik im nationalsozialistischen Staat vor allem Personalpolitik“[1]. Inhalte spielten keine wesentliche Rolle.
Die zweite Ursache für das uneinheitliche Kunstverständnis im Nationalsozialismus war die Frage, was denn eigentlich „arische Kunst“ sei. Anders als Sprache, Geschichte und Geographie lässt sich Kunst nicht so einfach national eingrenzen. Und so wurde zunächst nur die von Juden und von „Gegnern der Volksgemeinschaft“, z.B. Kommunisten, produzierte Kunst als „nicht -deutsch“ betrachtet.[2]
Diese Uneinheitlichkeit im allgemeinen Kunstverständnis wirkte sich natürlich auch auf die Literatur, bzw. Literaturwissenschaft, als Teil der Kunst aus. Die Werke der Autoren, welche die Bücherverbrennung vom 10.05.1933 „überlebt“ hatten, wurden im Bezug auf ihr „Deutschsein“ oder ihre Vorbildfunktion für nationales Denken unterschiedlich, teils sogar widersprüchlich bewertet. Auch die Werke Georg Büchners sind so im 3.Reich nicht einheitlich rezensiert worden[3], weshalb im Folgenden keine einzelne nationalsozialistisch geprägte Büchnerrezensension dargestellt werden kann, sondern lediglich verschiedene Interpretationsansätze unterschiedlicher Literaten. Diese Arbeit soll daher einen Überblick über einzelne Rezensionen und Interpretationsmodelle, die im Sinne des herrschenden Zeitgeist entstanden, bieten.
B. Büchner aus faschistisch orientierter Sicht
B.1. Vorläufer der nationalsozialistischen Büchnerinterpretationen
Die Ideologie der Nazis war im Grunde eine Zusammenfassung bisheriger geistiger Strömungen, die ihren Ursprung vor allem im Kaiserreich und in der Weimarer Republik hatten. So stammen auch Elemente der Büchnerbetrachtung im 3. Reich aus Interpretationsansätzen, früherer Literaturbetrachter. In diesem Zusammenhang sind wahrscheinlich Adolf Bartels, Josef Nadler, Arthur Moeller van den Bruck und Friedrich Gundolf am bedeutendsten.
Ordnet man diese „Vorgänger“ chronologisch, ist zunächst Adolf Bartels zu nennen. In seiner Literaturgeschichte[4] wendet er sich gegen den sozialrevolutionären Charakter von Büchners Werken. Im Mittelpunkt seiner Kritik steht der Hessische Landbote mit seinem Aufruf zur sozialen Erneuerung und zur revolutionären Agitation. Damit hätte er „zahlreiche Freunde ins Verderben gestürzt“ und Hass verbreitet, den er durch gefälschte Tatsachen noch zusätzlich geschürt habe.[5] Deshalb wäre Büchner ein Vorbild für Bolschewisten und Juden.[6] Interessant bei den Ausführungen von Bartels ist - im Zusammenhang mit den folgenden faschistisch geprägten Büchnerinterpretatoren, dass er den „Nihilismus“, die „absolute Zersetzung alles Göttlichen und Menschlichen“[7] als Gefahr sieht, während andere völkisch-national denkenden Autoren(s.u.) gerade diesen Nihilismus als Interpretationsgrundlage für eine national – sozialistische Rezension Büchners eher positiv bewerten (s.u.).
Nach Bartels ist, will man mögliche Vorläufer der nationalsozialistischen Büchnerrezeption chronologisch aufzählen, als nächstes Arthur Moeller van den Bruck zu nennen, der 1904 ein Büchnerporträt erstellt[8]. Wie Bartels erkennt auch er den sozialen Aufruhr in Büchners Werk. Der Kunst- und Kulturpublizist teilt die bisherigen deutschen Dichter und Autoren, die er alle bis auf Goethe als problematisch bezeichnet, in die Kategorien „energische Naturen“ und „eigentliche Problematiker“ ein.[9] Letzteren rechnet Moeller auch Büchner zu. Die „eigentlichen Problematiker“ sind nach seiner Ansicht Autoren, die sich mit Problemen befassen, aber keine Lösung finden und somit im Problem „stecken bleiben“.[10]
Und so sind für Moeller Büchners Werke „wenig wertvoll“[11], auch wenn er sie als „differenzierteste und damit interessanteste Erscheinung“[12] charakterisiert. Im Unterschied zu Bartels sucht Moeller allerdings eine Erklärung für Büchners soziale und demokratische Ambitionen und führt dies auf dessen Schwermut und Krankheit zurück. Als Beweis dient ihm dabei die Novelle Lenz, die er als „Autopsychologie“ Büchners ansieht.
In eine etwas andere Richtung wie die beiden oben genannten Büchnerinterpretatoren geht der Ansatz von Josef Nadler. Er klagt nicht mehr die sozialrevolutionären Züge in Büchners Dichtung an. Statt dessen versucht er Büchner zu entpolitisieren[13], das heißt der Mittelpunkt ist jetzt die Erzählkunst Büchners und nicht die Anliegen, die in seinen Werken vorgebracht werden. Nadler geht sogar im Gegenteil von einem bürgerlichen Büchner aus und stellt zum Beispiel Woyzeck als einen durch seinen Fleiß aufstrebenden Mann aus dem Volk dar. So schreibt er: „Man geht von Anbeginn fehl, wenn man in dem Wehrmann und Füsilier Franz Woyzeck einen Unterdrückten sieht. Im Gegenteil, Hauptmann und Regimentsarzt behandeln ihn gut, mit einer Art wohlwollender Vertraulichkeit.“[14] Damit gibt Nadler die Schuld am Scheitern Woyzecks nicht den sozialen Umständen - also der Unterdrückung Woyzecks durch seine Vorgesetzten und seine Armut- sondern der Umgebung des Woyzeck, den „Lumpen, die er zu seinesgleichen hat“[15], bzw. der „Masse“, die alles aus ihr aufstrebende vernichten will.[16] So interpretiert ist Büchner kein Vorläufer des Kommunismus sondern sogar ein Gegner desselben, indem er vor einer klassenlosen Gesellschaft warnt, die den Aufstieg des Einzelnen gewaltsam zu verhindern versucht.[17]
Ein Jahr nach Nadlers Literaturgeschichte erschien ein Aufsatz von Friedrich Gundolfs zu Georg Büchner[18]. Im Grunde setzt er den von Nadler begonnen Prozess der Entpolitisierung fort und steigert diese zur Mystifikation Büchners und seiner Werke.
Gundolf leugnet nicht nur die politische Absicht Büchners oder deutet sie um wie Nadler, sondern er sieht dessen Werke als „autonom, zweckfrei“ und „von politischen wie gesellschaftlichen Bezügen gereinigte Dichtung“[19] an. Gerade die politische Färbung in Büchners Werken, welche sich in der Trennung der Gesellschaftsschichten äußert, wäre nach Gundolf eine „Stimmung“[20], bzw. ein Stilmittel, das wohl dem Büchner umgebenden revolutionären Zeitgeist Rechnung trägt[21].
Mit Gundolf sind die vier für die Büchnerbewertung im 3. Reich grundlegenden Autoren genannt[22]. Die Interpretationsansätze von Bartels, Moeller, Nadler und Gundolf enthalten bereits fast alle Tendenzen, die in der Literaturwissenschaft der Nationalsozialisten eine Rolle spielen und dort erkennbar sind - auch wenn sich einige der Ansätze teilweise gegenseitig widersprechen.
B.2. Büchner in der Betrachtung durch nationalsozialistische Literaturwissenschaftler
Im 3. Reich geriet Georg Büchner - verglichen mit der Reflexion seiner Werke während der Weimarer Republik - fast in Vergessenheit. Im Zeitraum 1919 -1932 wurden noch 22 Einzel- und Gesamtausgaben seiner Werke veröffentlicht, 7 Dissertationen verfasst und 5 Bücher über Georg Büchner und sein Werk geschrieben. Dagegen stehen im Zeitraum von 1933-1945 nur 4 Einzel- und Gesamtausgaben und 2 Dissertationen. Auch am Theater gingen die Büchnerinszenierungen stark zurück.
In der Weimarer Zeit wurden die Büchnerdramen Dantons Tod und Leonce und Lena ungefähr zehnmal sooft inszeniert, wie im 3. Reich. Das soziale Drama Woyzeck wurde fast vollständig verdrängt. Es fanden innerhalb der 12 Jahre des „Tausendjährigen Reiches“ nur zwei Inszenierungen statt.
Wogegen in den vorhergehenden 13 Jahren Woyzeck mit 65 Inszenierungen das am zweitmeisten aufgeführte Büchnerwerk nach Dantons Tod darstellte.[23]
Diese sich so stark unterscheidenden Zahlen zur Büchnerreflexion während Weimarer Republik und 3. Reich sind einerseits damit zu erklären, dass die Büchnerinszenierungen während der Weimarer Republik sehr beliebt waren. Einige Autoren dieser Zeitspanne, darunter auch Alfred Döblin und Hans Hennry Jahn, beschwerten sich sogar über die starke Konkurrenz durch die verstorbenen Autoren des frühen 19.Jahrhunderts am Theater[24].
Andererseits lag die geringe Zahl an Büchnerinszenierungen während der NS-Herrschaft daran, dass es der NS-Literaturwissenschaft nicht gelang, Büchner als völkisch-nationalen Dichter darzustellen.
Allerdings wurden vereinzelte Versuche in dieser Beziehung durch Literaturbetrachter des 3. Reiches unternommen. Vor allem in der Phase 1933 – 1937, als die personale und damit auch ideologisch einheitliche Führung der Kunst noch nicht hergestellt war[25], entwickelten sich verschiedene Modelle, mit denen versucht wurde, Georg Büchner und sein Werk völkisch-national oder sogar nationalsozialistisch „gleichzuschalten“.[26]
Das in diesem Zusammenhang bedeutendste Interpretationsmodell lieferte der Literatur- historiker Karl Vietor, dessen Werk „Die Tragödie des heldischen Pessimismus. Über Büchners Drama Dantons Tod“[27] vor allem zur Mystifikation Büchners beitrug.
Ganz im Sinne Gundolfs(s.o.) sieht Vietor Dantons Tod als „untendenziöse, reine Dichtung“, die besonders Büchners Fatalismus literarisch umsetzt. Die passive Resignation des Protagonisten Danton ist für Vietor „pessimistisches Heldentum“. Und indem er Büchner mit seinem Helden identifiziert, ist dieser ebenfalls so ein pessimistischer Held, der sieht, wie alte Ideale zerbrechen, aber keine neue Alternativen sieht und sich damit „entschlossen in das Nichts“ stellt[28]. Ausgangspunkt dieser Interpretation ist der sogenannten Fatalismusbrief Büchners von 1834, in dem er die Ohnmacht des Menschen gegenüber der Geschichte beklagt[29].
Der vom Nationalsozialismus vereinnehmbare Inhalt von Vietors Aussagen ist eine Konsequenz aus dem oben genannten Interpretationsmodell. Einerseits wird durch die Mythisierung von Büchners Werk ein großer Teil seiner politischen Aussagen relativiert, indem der äußeren Form gegenüber dem Inhalt eine größere Bedeutung zukommt.
Zum Anderen glaubt Vietor, dass der Nationalsozialismus die Lösung für den Fatalismus bietet, der sich bei Büchner vor allem in dessen Briefwerk aber nach Meinung Vietors auch in Dantons Tod äußert. In seinen 1933 erschienenen Manifesten[30] sieht er „ein Zeitalter mit heroischen Idolen und so stark willentlicher Haltung“ im Anbruch, das sich auf das Heldentum der Vergangenheit stützt.
Vietor hat, wenn auch ideologisch gefärbt, Büchner noch wissenschaftlich betrachtet und dessen Briefe und Werke erforscht.
Anders verfährt Arthur Pfeiffer, der in seiner Dissertation „Georg Büchner. Vom Wesen der Geschichte, des Dämonischen und Dramatischen“[31] Büchner umdeutet oder sogar „verfälscht“[32], indem er ihn nicht als Vormärz - Autor sondern als Vordenker der „nationalsozialistischen Revolution“ darstellt. Demnach soll Georg Büchner wie eine Art Nostradamus „aus Wirklichkeitsentfremdung und dämonischer Besessenheit weitvorgreifende Möglichkeiten“[33] gesehen haben, die erst „hundert Jahre“ später, also durch die Macht-übernahme, verwirklicht worden seien.
Eine weitere Umdeutung nimmt Pfeiffer auf einer ähnlichen Ebene wie Vietor vor. Er deutet Büchners Fatalismus, der von Vietor Pessimismus genannt wird, als „dämonisches Weltbild“. Damit sei Büchner neben Kleist einer der wenigen Dramatiker, die sich von der jüdisch-christlichen Weltanschauung, welche die bisherige deutsche Literatur beherrsche, nicht beeinflussen ließ, sondern sich „germanisch - dämonischer Dramatik“[34] zuwandte, welche Pfeiffer für den ursprünglich deutschen Literaturhintergrund hält. Die Geschichte würde, so deutet Pfeiffer Büchners Fatalismus, von „übermenschlichen“ Kräften gelenkt und Büchner sieht in seinen Werken die Möglichkeit in späteren Generationen, diese Kräfte zu überwinden, was nun mit der „NS-Revolution“ erreicht wäre. Ganz im Geiste des Nationalsozialismus sucht man bei Pfeiffer vergeblich nach Nachweisen für seine Folgerungen[35].
Das was bei Vietor „Pessimismus“ und bei Pfeiffer „dämonisch“ genannt wurde, bekommt von dem schweizer Literaturhistoriker Emil Staiger den Titel „Nihilismus“[36].
Wieder steht der Fatalismus Büchners im Mittelpunkt seiner Überlegungen. Bei Büchner, vor allem im Woyzeck, sei alles „grund- und ziellos, aber deshalb unermeßlich“[37]. Wie Pfeiffer trennt auch Staiger Büchner von den anderen Autoren des 19. Jahrhunderts. Er sieht einen Bruch vor allem mit dem zu Büchner zeitgenössischen „Jungen Deutschland“[38], das von den Nationalsozialisten als dekadent, artfremd und intellektuell überzüchtet angesehen wurde[39].
Emil Staiger, Karl Vietor und Arthur Pfeiffer ist die starke Betonung von Büchners Fatalismus gemeinsam. Damit „ordneten“ sie Büchner „in die Reihe Schopenhauer – Kierkegaard - Dostojewski - Strindberger und Heidegger ein“[40]
Noch stärker mystifiziert wurde Büchner von Josef Magnus Wehner, welcher den Geburtstag des Dichters, der mit dem Tag der Völkerschlacht von Leipzig übereinstimmt, nicht als Zufall anerkennt. Er sieht darin die Verbundenheit Büchners mit dem einheitlich kämpfenden deutschen Volk. Bestätigt sieht er seine These im Hessischen Landboten, aus dem er zitiert: „Das deutsche Volk ist ein Leib; ihr seid ein Glied dieses Leibes!“[41]. Als „Militarist“[42] verfälschte Wehner Büchner durch geschickte Zitatauswahl sogar zum Kriegsbefürworter. So zitiert er einen Brief Büchners an seine Familie vom Dezember 1934: „wenn aber die Russen über die Oder gehen, dann nehm ich den Schießprügel, und sollt ich `s in Frankreich tun.“[43]
Auch der Philologe Fritz Bergemann betonte ebenfalls 1937 die Verbundenheit Büchners mit Deutschland[44]. Allerdings übersah er auch nicht die Sozialkritik, die vor allem in Büchners Hessischem Landboten präsent ist. Jedoch konnte dieser „Sozialismus“ ohne große Mühe mit dem Nationalsozialismus gleichgeschaltet werden. Die NSDAP war nach eigener Definition aus einer Arbeiterpartei hervorgegangen. In der Idee der „Volksgemeinschaft“ und des „Volksgutes“ waren auch 1937[45], dem Erscheinungsjahr von Bergemanns Aufsatz noch sozialistische Elemente in der NS-Herrschaft vorhanden. Verbunden mit Pfeiffers „dämonischer Vorahnung“(s.o.), konnte also die Aufhebung der von Büchner kritisierten sozialen Mißstände danach mit der Machtübernahme gleichgesetzt werden.
Erwähnenswert im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Büchnerinterpretation sind noch die stark von der herrschenden Ideologie beeinflussten Autoren Walther Linden, Franz Koch, Heinz Kindermann und Gerhard Fricke. Im Anschluss Bergemann integrierten sie Büchner in die NS- Blut- und Bodenmythologie. Sie betonen eine tiefe Verwurzelung Büchners in seiner Heimat und eine starke Verbindung zu seiner Familie: „Im rheinhessisschen Stammestum wurzelt der gesunde Grund von Büchners Natur.[...]: ein kraftvolles Verhältnis zur Wirklichkeit und ein unmittelbares Verhältnis zum Volk sind Erbteil seiner Familie, wie sie seinem gesamten Stammestum eigen“[46]. Auch sie setzen Büchner gegen die „artfremden“ Literaten des „Jungen Deutschland“[47], die „Triebgebundenheit“ seiner Helden[48] gegen die vom rein intellektuellen ausgehenden Liberalen.
Auch erkennen Koch, Linden, Kindermann und Fricke die Sozialkritik in Büchners Werken. „Das Bedürfnis der Massen“ sei ein Hauptanliegen Büchners und dieses „Bedürfnis“ konnte erst durch die Machtübernahme gestillt werden. Büchner wartete quasi auf die nationalsozialistische Revolution, welche die Erlösung für das Volk bedeute[49]. Diese stark vom faschistischen Weltbild geprägte Büchnerrezeption war im Grunde der Abschluss der nationalsozialistischen Bemühungen um Büchner.
Nachdem zum hundertsten Todesjahr 1937 ein regelrechter „Boom“ von Büchner-bewertungen eingesetzt hatte[50], sind ab 1938 schlagartig kaum noch Reflexionen, bzw. Rezensionen zu Georg Büchner zu finden. Lediglich 1942 wurde der Aufsatz „War Georg Büchner ein Revolutionärer Dichter?“ des Literaturhistorikers Ernst Alker veröffentlicht[51]. Allerdings steuert Alker keine neuen Interpretationsansätze bei. Teilweise sogar übereinstimmend mit Vietor wendet er sich gegen die „allgemein verbreitete Meinung, dass Georg Büchner nicht nur in künstlerischer, sondern auch politischer Hinsicht ein revolutionärer Dichter gewesen sei“[52]. Er wiederholte etwa 10 Jahre nach Vietor dessen Entpolitisierung der Büchnerwerke.
Mit Ernst Alker enden die veröffentlichten Büchnerbewertungen im 3.Reich endgültig.
C. Wertung/Zusammenfassung
Wie oben erwähnt, lässt sich keine einheitliche Bewertung von Büchners Werken im 3. Reich feststellen. Seine offenen Angriffe gegen die Ausbeutung des Volkes durch das herrschende System und auch die Tatsache, dass Büchners Werke von Juden „überliefert, verbreitet und nachgeahmt“[53] wurden, machten es schwer, Büchner als Vorläufer des Nationalsozialismus zu sehen. Dennoch wurde Büchner am 10.05.1933 nicht „mitverbrannt“. Sogar die NS-Propaganda äußerte sich zwiespältig zu einzelnen Büchneraufführungen. Während „Der Völkische Beobachter“ - anlässlich einer Inszenierung von Leonce und Lena an der Berliner Volksbühne - Büchner zum „Vorläufer der nationalen Revolution“ erhob, brachte „Der Stürmer“ seine „deutliche Ablehnung“ zum Ausdruck[54]. Dies zeigt, dass schwer für die „Literaten“ des 3. Reiches war, Büchner einzuordnen, bzw. zu schematisieren. Man konnte ihn weder vollständig ablehnen noch für den Nationalsozialismus einvernehmen[55], obwohl beides - wie gezeigt- versucht wurde. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Büchnerrezeption von 1933 –1945 - zumindest in Deutschland – weitgehend stagnierte[56].
Zusammenfassend wurde unter der Herrschaft des Nationalsozialismus Büchner bei der Interpretation entpolitisiert, als Vorläufer der nationalsozialistischen Revolution gesehen oder mystifiziert. Der Vormärz-Autor wurde als Gegenbild zum „Jungen Deutschland“ oder zur „jüdisch-christlichen Epik“ aufgebaut. Soweit sich Büchner nicht in das völkisch-nationale Denken einfügen ließ, wurde er für krankhaft, bzw. geistesgestört erklärt.
Die Epoche des 3. Reiches hatte auf die nachfolgende Büchnerinterpretation wenig Einfluss, auch wenn einige Interpretationsansätze sogar von nichtfaschistischen Autoren übernommen worden waren[57]. Allerdings muss in diesem Zusammenhang in Erinnerung gerufen werden, dass wohl keine Interpretation wertfrei ist und immer die soziale Umgebung und auch die politische Situation auf jede Textbetrachtung einwirkt. Ebenso muss beachtet werden, dass der immer größer werdende zeitliche Abstand
Mit dem Namen Georg Büchner wird heute ein Dichter verbunden, der schon vor Marx auf das Elend des einfachen Volkes aufmerksam machte und literarisch Gewandt zur Änderung der Verhältnisse aufrief.
D. Verwendete Literatur
- Konrad Dussel: Der NS-Staat und die deutsche Kunst. In: Bracher / Funke / Jacobsen (Hrsg.): Deutschland 1933-1945. Neue Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft. 2.Aufl. Bonn. 1993, S.256-273.
- Dietmar Goltschnigg(Hrsg.): Büchner im 3.Reich. Mystifikation- Gleichschaltung- Exil. Eine Dokumentation. Bielefeld.1990[i]
- Dietmar Goltschnigg: Materialien zur Rezeptions- und Wirkungsgeschichte Georg Büchners. Kronberg/Ts. 1975
- Gerhard Knapp: Georg Büchner. 3. Aufl. Stuttgart. 2000
- Georg Lukacs: Der faschistisch verfälschte und der wirkliche Georg Büchner. Zu seinem 100. Todestag am 19.Februar 1937. In ders.: Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts. Berlin 1953, S. 66-88
- BpB(Hrsg.): Informationen zur politischen Bildung. Nationalsozialismus I. Heft 251. München. 2000.
[...]
[1] Dussel 1993. S.260
[2] Zum Inhalt der Vorbemerkungen vgl. Dussel 1993
[3] Vgl. Goltschnigg 1990, S. 8 u.40
[4] Adolf Bartels: Geschichte der deutschen Literatur. 2 Bände. Leipzig. 1901/02. Ausschnittsweise zitiert in: Goltschnigg 1990, S. 45-49
[5] Vgl. Goltschnigg 1990, S.10
[6] Vgl. ebd. S.10
[7] ebd. S.10
[8] Arthur Moeller van den Bruck: Georg Büchner. In ders.: Verirrte Deutsche. Breslau(?). 1904. Zitiert in:
Goltschnigg 1990. S.49-58.
[9] Vgl. ebd. S.11
[10] sinngemäß zitiert nach Goltschnigg 1990, S.11
[11] Arthur Moeller van den Bruck: Georg Büchner. In ders.: Das ewige Reich. Neuaufl. Bd.2. Breslau.1934.
Zitiert in: Goltschnigg 1990, S.12
[12] Ebd., S.12
[13] Goltschnigg 1990 S.13 sieht darin schon eine Anbiederung an das nahende 3. Reich. Dies halte ich angesichts des Erscheinungsdatums von Nadlers Buch 1928 (siehe Anm. 14) für nicht adäquat. DNVP und NSDAP hatten im Wahljahr 1928 zusammen nur knapp 17% der Stimmen erhalten. Gegenüber der vorherigen Wahl waren sogar geringe Einbusen zu verzeichnen (siehe IzpB S.16). Nadlers Position wird daher vermutlich seiner eigenen Überzeugung entsprechen
[14] Josef Nadler: Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften. Regensburg. 1928. Als Ausschnitt zitiert in: Goltschnigg 1990, S. 59-63
[15] zitiert ebd. S. 13
[16] Dazu Nadler zitiert ebd.: „Durch tausend tägliche Tragödien zerstört die Masse selber am eigenen Organismus die Keime eines besseren selbst.“
[17] Anders als Goltschnigg 1990 S.13, der davon ausgeht, dass Nadler hier die Erwartung eines Retters und Führers der „Masse“ in Büchner hineininterpretiert, sehe ich hier nur eine Ablehnung des Kommunismus durch Nadler. Der Führergedanke war bei 97,4% des Volkes noch nicht präsent(siehe auch Anm.13).
[18] F.Gundolf: Georg Büchner. In: Zeitschrift für Deutschkunde 43 (1929), S. 1-12. Zitiert in Goltschnigg 1990, S.64-74
[19] Goltschnigg 1990, S.14
[20] Dazu Gundolf bezogen auf Woyzeck zitiert in Goltschnigg 1975 S. 67f: „[...] mag Büchner auch zuerst eine soziale Anklage gemeint haben: entstanden ist weder ein Tendenzstück noch eine Elendsstudie, sondern ein Schicksalstraum aus unterer Sphäre. Die Gesellschaftsschicht ist im Woyzeck eine Stimmung,[...]entledigt aller Zwecke, der Politik, der Moral, ja selbst der Vernunft. Hier wacht nur die Schicksalslandschaft mit ihrem Seelenwesen.“
[21] Oder wie Lukacs 1953 anführt, wird damit aus Büchner: „nur ein verspäteter Romantiker, ein Dichter der Stimmung“
[22] Goltschnigg 1990 nennt als „Vorläufer“ noch Herbert Cysarz, Emil Ermatinger und Paul Fechter, auf die jedoch hier nicht weiter eingegangen wird, da sie keine grundlegend neuen Interpretationsansätze liefern , sondern sich den 4 genannten anschließen. Sie sind daher für den direkten Bezug der nationalsozialistischen Literaturwissenschaft, meiner Ansicht nach, weniger relevant.
[23] Zu den Zahlen vgl. Goltschnigg 1990, S. 8
[24] Vgl. Goltschnigg 1975, S. 65
[25] siehe A. Vorbemerkungen
[26] Vgl. Lukacs 1953, S.66. G.L. nennt dies „faschisieren“
[27] Karl Vietor: Die Tragödie des heldischen Pessimismus. Über Büchners Drama Dantons Tod. In DVjs. 12 (1934), S. 173-209. Zitiert in Goltschnigg 1990, S.90-117
[28] vgl. Goltschnigg 1990, S.18. Zitate ebd.
[29] Vgl. Knapp 2000, S. 18f
[30] Karl Vietor: Die Wissenschaft vom deutschen Menschen in dieser Zeit. In: Zeitschrift für deutsche Bildung 9 (1933), S. 342-348
[31] Arthur Pfeiffer: Georg Büchner. Vom Wesen der Geschichte, des Dämonischen und Dramatischen. Frankfurt/M. 1934. Ausschnitte zitiert in: Goltschnigg 1990, S. 117-125
[32] Ausdruck zitiert von Lukacs 1953, S.66
[33] Arthur Pfeiffer zitiert in Goltschnigg 1990 S.20
[34] Goltschnigg 1990, S.20
[35] Zu dieser Zeit (1934) sprach Hitler noch selten von der „Vorsehung“. Ansonsten wäre Pfeiffer auch mit der nationalsozialistischen Ideologie widerlegt worden.
[36] Emil Staiger: Georg Büchner. (Festrede zur Büchnerfeier im Schauspielhaus Zürich). Zürich 1937. Zitiert in Goltschnigg 1990, S. 140-147
[37] Goltschnigg 1990, S. 24
[38] In diese Richtung wird auch von Günther Weydt gegangen, der schon in Dantons Tod eine Entwicklung Büchners, weg von der Idee der Revolution sieht. Vgl. Goltschnigg 1990, S. 25f
[39] Goltschnigg 1990, S. 41
[40] sinngem. Lukacs 1953, S. 67
[41] zitiert in Goltschnigg 1990, S. 22
[42] ebd., S. 23
[43] zitiert ebd., S. 23
[44] Fritz Bergemann: Georg Büchner. Zur Erinnerung an den 19.02.1837. Zitiert in Goltschnigg 1990, S. 147-152
[45] Mit dem Röhm-Putsch war allerdings die „Linke“ der NSDAP beseitigt worden, da ihre Hauptvertreter, wie z.B. Georg Strasser zu den Opfern der Mordaktionen des 30.06.1934 gehörten. Siehe BpB 2000, S. 55
[46] Walther Linden 1938. Zitiert in Goltschnigg 1990, S. 27
[47] so nennt zum Beispiel Koch Büchners Dichtung „volkhaft“ und die des Jungen Deutschland „Verfallsschrifttum“
[48] dazu Koch 1937 zitiert in Goltschnigg S. 28: „Triebgebunden sind seine Menschen, seine Danton und Robespierre, sein Lenz, sein Woyzeck, blind, sich selbst ein Rätsel, gehorchen sie jenem dunklen, eisernen Muss“.
[49] Dazu Fricke zitiert in Goltschnigg 1990, S.28: Das „Wunder der deutschen Wende hat allen Geschichtsfatalismus überwunden und den Weg zur Selbstverwirklichung der deutschen Nation aus dem eigensten Wesensgesetz freigelegt“.
[50] Allein mindestens 6 durch völkisch-nationale Autoren verfasste Arbeiten.
[51] Ernst Alker: War Georg Büchner ein revolutionärer Dichter?. Zitiert in Goltschnigg 1990, S. 175-181
[52] zitiert in Goltschnigg 1990, S. 30
[53] ebd., S. 11. Gemeint seien Karl Gutzkow und Karl Emil Franzos
[54] Vgl. bzw. siehe Goltschnigg 1990, S.8
[55] Vgl. Knapp 2000, S.46
[56] Siehe B.2.1.
[57] z.B. Gerhard Pohl, der Büchner im Sinne Nadlers entpolitisiert und ihn wie Gundolf mythisiert. Oder der Amerikaner John Kresh, der 1933 - ähnlich der Kernaussage Wehners - schreibt: „Nervertheless, to one principle he [Büchner] remaind constant. This single positiv factor in Büchner´s political and social credo was nationalism[...]“(zitiert in Goltschnigg 1990, S. 16)
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments über Büchner im Nationalsozialismus?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Analyse der Rezeption von Georg Büchners Werken während der Zeit des Nationalsozialismus (Drittes Reich) in Deutschland. Es untersucht, wie Literaturwissenschaftler und Intellektuelle im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie versuchten, Büchners Werk zu interpretieren, zu vereinnahmen oder abzuwerten. Das Dokument gliedert sich in Vorbemerkungen zur Kunst und Nationalsozialismus, einen Hauptteil über Büchner aus völkisch-nationaler Sicht, einen Schlussteil mit Wertung und Zusammenfassung sowie ein Literaturverzeichnis.
Welche Schwierigkeiten gab es bei der Kunstbetrachtung im Nationalsozialismus?
Es gab kein einheitliches Kunstverständnis in den ersten Jahren des Nationalsozialismus. Dies lag zum einen an einem Kompetenzchaos zwischen verschiedenen Akteuren (Goeppels, Frick, Rosenberg, Ley) und zum anderen an der Schwierigkeit, "arische Kunst" klar zu definieren. Zunächst wurde Kunst von Juden oder "Gegnern der Volksgemeinschaft" als "nicht-deutsch" betrachtet.
Welchen Einfluss hatte das auf die Bewertung von Büchners Werken?
Die Uneinheitlichkeit im Kunstverständnis wirkte sich auch auf die Literaturwissenschaft aus. Büchners Werke wurden unterschiedlich und teils widersprüchlich im Hinblick auf ihr "Deutschsein" oder ihre Vorbildfunktion für nationales Denken bewertet.
Wer waren die Vorläufer der nationalsozialistischen Büchnerinterpretationen?
Bedeutende Vorläufer waren Adolf Bartels, Arthur Moeller van den Bruck, Josef Nadler und Friedrich Gundolf. Ihre Interpretationsansätze enthielten bereits viele Tendenzen, die später in der Literaturwissenschaft des Nationalsozialismus eine Rolle spielten.
Wie bewertete Adolf Bartels Büchners Werke?
Bartels kritisierte den sozialrevolutionären Charakter von Büchners Werken, insbesondere den "Hessischen Landboten", und sah in Büchner ein Vorbild für Bolschewisten und Juden.
Wie sah Arthur Moeller van den Bruck Büchner?
Moeller erkannte ebenfalls den sozialen Aufruhr in Büchners Werk, ordnete Büchner aber als "eigentlichen Problematiker" ein, der sich mit Problemen befasst, aber keine Lösung findet.
Wie versuchte Josef Nadler, Büchner zu interpretieren?
Nadler versuchte, Büchner zu entpolitisieren und die Erzählkunst in den Mittelpunkt zu stellen. Er ging von einem bürgerlichen Büchner aus und deutete Woyzeck beispielsweise als einen durch Fleiß aufstrebenden Mann aus dem Volk.
Welche Rolle spielte Friedrich Gundolf bei der Büchnerbewertung?
Gundolf setzte den von Nadler begonnenen Prozess der Entpolitisierung fort und steigerte diesen zur Mystifikation Büchners und seiner Werke. Er sah Büchners Werke als "autonom, zweckfrei" und "von politischen wie gesellschaftlichen Bezügen gereinigte Dichtung".
Wie unterschied sich die Büchner-Rezeption während der Weimarer Republik und des 3. Reiches?
Während der Weimarer Republik gab es eine intensive Auseinandersetzung mit Büchners Werken, einschließlich zahlreicher Aufführungen seiner Dramen. Im 3. Reich ging die Auseinandersetzung mit Büchner deutlich zurück, da es der NS-Literaturwissenschaft nicht gelang, ihn als völkisch-nationalen Dichter darzustellen.
Welche Interpretationsmodelle wurden im 3. Reich entwickelt?
Ein bedeutendes Modell lieferte Karl Vietor, der "Dantons Tod" als "untendenziöse, reine Dichtung" sah und Büchners Fatalismus betonte. Arthur Pfeiffer deutete Büchner als Vordenker der "nationalsozialistischen Revolution". Emil Staiger bezeichnete Büchners Haltung als "Nihilismus".
Wie wurde Büchner von Josef Magnus Wehner mystifiziert?
Wehner sah im Geburtstag Büchners, der mit dem Tag der Völkerschlacht von Leipzig zusammenfiel, ein Zeichen für Büchners Verbundenheit mit dem deutschen Volk. Er verfälschte Büchner durch geschickte Zitatauswahl sogar zum Kriegsbefürworter.
Welche weiteren Autoren beeinflussten die nationalsozialistische Büchnerinterpretation?
Autoren wie Walther Linden, Franz Koch, Heinz Kindermann und Gerhard Fricke integrierten Büchner in die NS-Blut- und Bodenmythologie und betonten seine tiefe Verwurzelung in seiner Heimat.
Gab es nach 1937 weitere Auseinandersetzungen mit Büchner im Nationalsozialismus?
Nach 1937 gab es kaum noch Reflexionen zu Büchner. 1942 wurde noch ein Aufsatz von Ernst Alker veröffentlicht, der sich gegen die Meinung wandte, Büchner sei ein revolutionärer Dichter gewesen.
Wie lässt sich die Büchner-Rezeption im Nationalsozialismus zusammenfassen?
Büchner wurde entpolitisiert, als Vorläufer der nationalsozialistischen Revolution gesehen oder mystifiziert. Der Vormärz-Autor wurde als Gegenbild zum "Jungen Deutschland" aufgebaut. Soweit sich Büchner nicht in das völkisch-nationale Denken einfügen ließ, wurde er für krankhaft erklärt.
Welchen Einfluss hatte die Epoche des 3. Reiches auf die nachfolgende Büchnerinterpretation?
Die Epoche des 3. Reiches hatte wenig Einfluss auf die nachfolgende Büchnerinterpretation, obwohl einige Interpretationsansätze übernommen wurden.
- Quote paper
- Jörg Lehmann (Author), 2002, Georg Büchner im Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107552