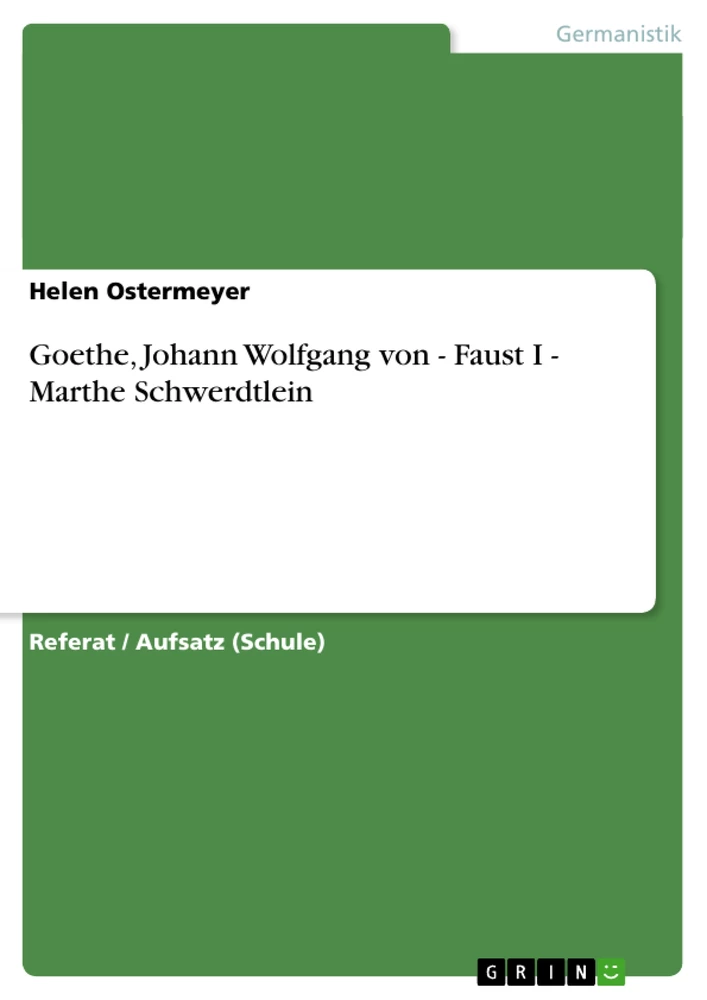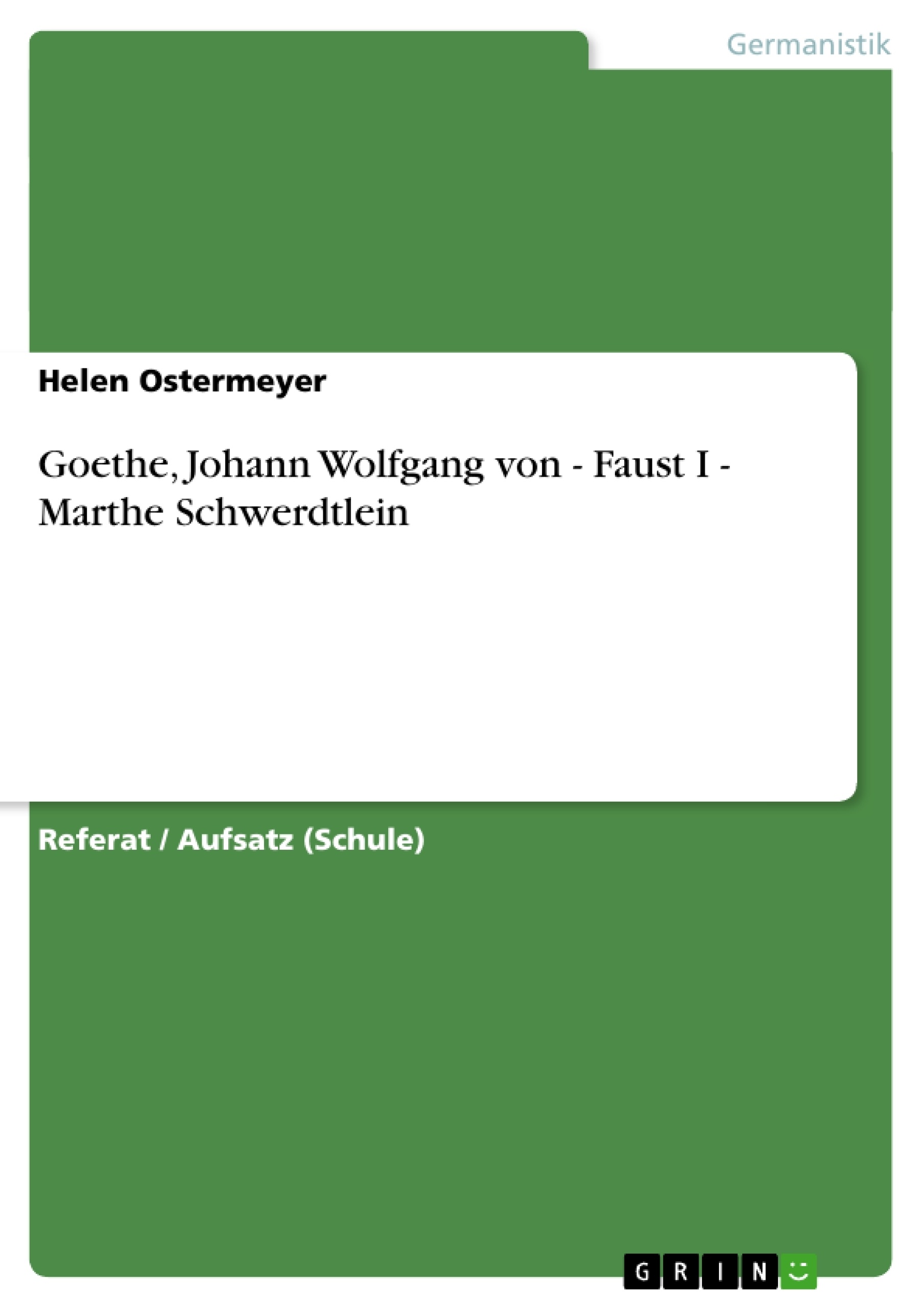Was geschieht, wenn Moral auf Eigeninteresse trifft? Tauchen Sie ein in die komplexe Welt von Marthe Schwerdtlein aus Goethes "Faust I", einer Figur, die weit mehr ist als nur Gretchens Nachbarin. Diese Analyse enthüllt Marthes entscheidende Rolle in der Tragödie, beginnend mit ihrer ersten Begegnung mit Gretchen, bei der sie ihr rät, heimlich Schmuck zu tragen und sie so von ihrer Tugendhaftigkeit abbringt. Marthe, die selbst eine Vergangenheit voller Verlassenheit und unerfüllter Sehnsüchte birgt, wird zur Schlüsselfigur in Mephistopheles' Plan, Faust und Gretchen zu verkuppeln. Ihre vermeintliche Trauer um ihren verschollenen Ehemann entpuppt sich als Fassade, hinter der sich der Wunsch nach einem Totenschein und einem Neubeginn verbirgt. Marthe wird als Kupplerin entlarvt, die ihren Garten bereitwillig für ein Treffen zwischen Faust und Gretchen zur Verfügung stellt, ohne Rücksicht auf die moralischen Konsequenzen. Der Vergleich zwischen Marthe und Gretchen verdeutlicht die Gegensätze zwischen Berechnung und Unschuld, zwischen dem Streben nach irdischer Lust und der reinen Liebe. Während Gretchen das Idealbild des Kleinbürgertums verkörpert, steht Marthe für das Gegenteil: Sie ist heuchlerisch, vulgär und bereit, ihre Moral den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Entdecken Sie, wie Marthe durch ihre Handlungen und ihre Gegensätzlichkeit zu Gretchen Gretchens kindliche Unschuld und ihren reinen Charakter zusätzlich unterstreicht. Diese tiefgründige Untersuchung beleuchtet Marthes Bedeutung im Stück und zeigt, wie sie die Entwicklung der Liebesbeziehung zwischen Faust und Gretchen entscheidend beeinflusst, obwohl sie um die moralische Verwerflichkeit ihrer Handlungen weiß. Erfahren Sie, wie Marthe, mehr als nur eine Randfigur, zur Katalysatorin für Gretchens Fall wird und somit eine unverzichtbare Rolle in Goethes Meisterwerk einnimmt. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Intrigen, Verführung und moralischer Zwiespälte, in der die Fassade des Kleinbürgertums Risse bekommt und die wahren Beweggründe der Charaktere ans Licht kommen.
Inhalt
1. Szenen, in denen Marthe auftritt
2. Charakterisierung
3. Vergleich zwischen Marthe und Gretchen
4. Bedeutung im Stück
5. Quellenangaben
6. Versicherung
1. Szenen, in denen Marthe auftritt
Marthe Schwerdtlein, eine Person in der Tragödie „Faust I“ von Johann Wolfgang Goethe, tritt in drei Szenen auf. Zum ersten Mal stößt der Leser in der Szene „Der Nachbarins Haus“ (Vers 2865-3024) auf sie, als Gretchen Marthe ihren neuen Schmuck zeigt. Marthe rät Gretchen diesen in Marthes Haus heimlich zu tragen (V. 2885ff). In dieser Szene berichtet Mephistopheles Marthe, dass ihr Mann gestorben sei (V. 2916), was allerdings eine Lüge ist. Mephistopheles hofft so ein Rendezvous zwischen Faust und Gretchen zu arrangieren. Er will Faust als Zeugen bringen, um den Tod für den Totenschein ihres Gatten zu bestätigen (V. 3013). Deshalb vereinbart er mit Marthe ein Treffen in ihrem Garten, bei dem auch Gretchen anwesend sein soll (V. 3019ff).
Der „Garten“ (V. 3073-3206) bildet die Grundlage für den nächsten Auftritt Marthes. In dieser Szene treten zwei Paare auf: zum einen Gretchen und Faust, zum anderen Marthe und Mephistopheles. Faust gesteht Gretchen seine Liebe, während Marthe verzweifelt versucht, sich Mephistopheles zu nähern. Der weist aber ihre offensichtlichen Anträge ab. In der Szene „Nacht“ (V. 3620-3775) redet Marthe zum letzten Mal. Nachdem Gretchens Bruder Valentin von Faust und Mephistopheles lebensgefährlich verletzt wurde, ist Marthe eine der erste, die den Sterbenden entdeckt (V. 3716ff).
In einer vierten Szene stellt Marthe ihren Garten als Treffpunkt zur Verfügung. Diese Szene heißt „Marthens Garten“ (V. 3413-3544) und handelt von der Frage Gretchens an Faust nach dem Glauben. Faust verspricht Gretchen ein weiteres Treffen und gibt ihr einen Schlaftrunk für ihre Mutter (V. 3510).
2. Charakterisierung
Marthe Schwerdtlein ist Gretchens Nachbarin und Freundin und gehört so zu Gretchens Welt. Marthe ist wesentlich älter als Gretchen: sie ist bereits verheiratet und hat Kinder, die aber nicht mehr bei ihr leben. Ihr Mann ist vor längerer Zeit weggelaufen und sie weiß nicht einmal mehr, ob er noch lebt. Das geht aus ihrem Lied hervor, das sie in „Der Nachbarins Haus“ singt (V. 2865-2872):
Referatsthema: Marthe Schwerdtlein und ihre Bedeutung in der Tragödie „Faust I“
Gott verzeih´s meinem lieben Mann,
Er hat an mir nicht wohl getan!
Geht da stracks in die Welt hinein
Und läßt mich auf dem Stroh allein.
Tät ihn doch wahrlich nicht betrüben,
Tät ihn, weiß Gott, recht herzlich lieben. (Sie weint.)
Vielleicht ist er gar tot! - O Pein! - -
Hätt ich nur einen Totenschein.
Sie macht ihrem Mann Vorwürfe, dass er sie und ihre Kinder allein gelassen hat, scheint aber auch sehr an ihm zu hängen, denn sie weint, während sie singt.
Als sie später von Mephistopheles erfährt, dass ihr Mann gestorben sei, scheint sie zuerst ziemlich traurig (V. 2917: „Ist tot? Das treue Herz! O weh! Mein Mann ist tot! Ach ich vergeh!“). Nachdem sie dann aber erfahren hat, wo ihr Mann begraben liegen soll, fragt sie, als ob nichts passiert wäre, ob Mephistopheles „sonst nichts an sie zu bringen habe“ (V. 2929). Marthe zeigt hier, dass ihre Trauer nur gespielt ist. Sie ist nur auf ihr Erbe aus (V. 2933: „Was! nicht ein Schaustück? Kein Geschmeid? Was jeder Handwerksbursch im Grund des Säckels spart, Zum Angedenken aufbewahrt, Und lieber hungert, lieber bettelt!“). Marthe möchte einen amtlichen Totenschein, damit sie frei ist und eine neue Beziehung eingehen kann. In diesem Gespräch mit Mephistopheles zeigt sich also deutlich, dass sie heuchlerisch ist. Zuerst beweint sie den Tod ihres Mannes, dann ist sie wiederum empört über ihn (V. 2961 und 2968f.). Marthe versucht sich nach außen als moralisch guten Menschen hinzustellen. Gegenüber Gretchen und Mephistopheles zeigt sie aber ihr wahres Gesicht. Sie biegt sich ihre Moral so zurecht, dass sie einen Vorteil dadurch erlangt. Dies wird besonders in der Situation deutlich, als sie erfährt, dass ihr Mann tot sei. Nach außen für ihre Umwelt spielt sie die trauernde Witwe, in Wirklichkeit ist sie nur auf den Totenschein aus, um eine neue Beziehung eingehen zu können.
Weiter stellt sich heraus, dass Marthe eine Kupplerin ist. Marthe und Mephistopheles vereinbaren ein Treffen in Marthes Garten, bei dem auch Faust und Gretchen anwesend sein sollen. Marthe fragt aber gar nicht Gretchen nach ihrer Meinung, sondern bietet bereitwillig ihren Garten als Treffpunkt an (V. 3022: „Da hinterm Haus in meinem Garten Wollen wir der Herrn heut abend warten.“). Auch Mephistopheles beschreibt Marthe als „ein Weib wie auserlesen zum Kuppler- und Zigeunerwesen!“(V. 3029f).
In der Garten-Szene erkennt man nun endgültig, dass Marthes Trauer nur gespielt war, denn sie zeigt Interesse an Mephistopheles. Sie versucht sich Mephistopheles zu nähern und redet offen über „Lust“ (V. 3156), was erneut ihre wahren Beweggründe zeigt. Sie wirkt vulgär und ist dabei sehr direkt, wird aber von Mephistopheles absichtlich nicht verstanden.
3. Vergleich mit Gretchen
Gretchen verkörpert das Idealbild des Kleinbürgertums. Sie ist bescheiden (V. 3115ff.), äußerst fleißig (sie zog ihre Schwester auf und arbeitet in der Wirtschaft ihrer Mutter) und weiß ihre Tugend zu bewahren.
Marthe gehört zwar auch dem Kleinbürgertum an, aber sie entspricht nicht dem Idealbild, mit dem Gretchen identifiziert wird. Bereits in der Szene „Der Nachbarins Haus“ wird deutlich, dass Marthe gegensätzlich zu Gretchen ist. Während Marthe ihre Trauer nur spielt, ist Gretchen bestürzt über den Tod (V. 2942: „Gewiß, ich will für ihn manch Requiem noch beten.“).
Besonders deutlich werden die Gegensätze in der Szene „Garten“. Die zwei Paare, auf der einen Seite Marthe und Mephistopheles, auf der anderen Seite Gretchen und Faust, spiegeln die Gegensätzlichkeit wider. Geht es bei Gretchen um wirkliche Liebe zu Faust, ist Marthe nur an der Ehe an sich interessiert. Während Marthe offen von „Lust“ spricht, will Gretchen nichts von alle dem wissen: als Faust ihr seine Liebe gesteht, läuft sie weg (V.3185f.). Gretchen ist die Unschuldige, was durch ihr Blumenspiel (V. 3180ff.) deutlich wird. Marthe dagegen ist gleich nach dem Tod ihres Mannes auf eine neue Beziehung aus. Während Gretchen spürt, dass Mephistopheles, Fausts Begleiter, böse ist (V. 3472ff.) bemerkt Marthe das Böse in ihm nicht, denn sie versucht mit allen Mitteln Mephistopheles für sich zu gewinnen. Während Gretchen und Faust die Liebe und Unschuld vertreten, stehen Mephistopheles und Marthe für Berechnung.
Gretchen sagt alles so wie sie denkt, in naiver Unschuld, Marthe hingegen ist berechnend und heuchelt Gefühle vor, die sie nicht empfindet.
Durch die Figur der Marthe und ihre Gegensätzlichkeit zu Gretchen wird Gretchens kindliche Unschuld und ihr reiner Charakter zusätzlich unterstrichen.
4. Bedeutung im Stück
Auf den ersten Blick scheint es, als ob Marthe nur Gretchens Freundin sei und eigentlich keine besondere Rolle spiele. Marthe spielt aber eine entscheidende Rolle in der Tragödie „Faust I“.
Gleich in ihrem ersten Auftritt beeinflußt sie Gretchen entscheidend. Sie rät ihr den Schmuck, den sie von Faust als Geschenk bekam, nicht wie beim ersten Mal ihrer Mutter zu zeigen, sondern den Schmuck heimlich in Marthes Haus zu tragen. Sie bringt so Gretchen von ihrer Sittsamkeit ab. Denn Gretchens Stand ist es nicht erlaubt einen solchen Schmuck zu tragen. Marthe verführt sie etwas Verbotenes zu tun und beschmutzt so Gretchens reine Weste. Marthe wird von Mephistopheles dazu benutzt, Faust und Gretchen zu verkuppeln. Sie sorgt für die weitere Entwicklung der Liebesbeziehung zwischen Faust und Gretchen, indem sie ihren Garten zur Verfügung stellt, in dem sich Faust und Gretchen das erste Mal näher kennen und lieben lernen. Marthe ebnet so der Liebe zwischen Faust und Gretchen den Weg, obwohl sie weiß, dass diese Treffen moralisch verwerflich sind.
5. Quellenangaben
- J.W. Goethe: Faust - Der Tragödie erster Teil, Philipp Reclam jun. Stuttgart
- Ulrich Gaier: Erläuterungen und Dokumente, Johann Wolfgang Goethe, Faust, Der Tragödie Erster Teil, Philipp Reclam jun. Stuttgart
- Jochen Schmidt: Goethes Faust, Erster und Zweiter Teil, Grundlagen - Werk - Wirkung, Verlag C.H. Beck München
- Ralf Sudau: Johann Wolfgang Goethe, Faust I und Faust II, Oldenbourg Interpretation Band 64, Oldenbourg Verlag München
- http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/del/15812.html
6. Versicherung
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments "Marthe Schwerdtlein und ihre Bedeutung in der Tragödie „Faust I“"?
Dieses Dokument ist ein Referat, das sich mit der Figur Marthe Schwerdtlein in Johann Wolfgang Goethes "Faust I" auseinandersetzt. Es behandelt ihre Auftritte in verschiedenen Szenen, ihre Charakterisierung, einen Vergleich mit Gretchen und ihre Bedeutung für das Stück. Außerdem enthält es Quellenangaben und eine Versicherung, dass das Referat selbstständig erarbeitet wurde.
In welchen Szenen tritt Marthe Schwerdtlein in "Faust I" auf?
Marthe tritt hauptsächlich in drei Szenen auf: "Der Nachbarins Haus", "Garten" und "Nacht". Zusätzlich wird ihr Garten in der Szene "Marthens Garten" als Treffpunkt genutzt, obwohl sie selbst dort nicht aktiv agiert.
Wie wird Marthe Schwerdtlein charakterisiert?
Marthe wird als Gretchens Nachbarin und Freundin dargestellt, die jedoch wesentlich älter und erfahrener ist. Sie ist verwitwet (oder zumindest glaubt das), heuchlerisch, triebgesteuert und versucht, sich durch die Vermittlung von Beziehungen Vorteile zu verschaffen. Sie ist das Gegenteil von der naiven und tugendhaften Gretchen.
Wie unterscheidet sich Marthe von Gretchen?
Gretchen verkörpert das Idealbild des Kleinbürgertums: Bescheidenheit, Fleiß und Tugend. Marthe hingegen ist heuchlerisch, an ihrem Vorteil interessiert und weniger moralisch. Sie steht im Kontrast zu Gretchens Unschuld und Reinheit. Während Gretchen wahre Liebe sucht, ist Marthe an der Ehe als Institution an sich interessiert.
Welche Bedeutung hat Marthe für die Handlung von "Faust I"?
Marthe beeinflusst Gretchen maßgeblich, indem sie ihr rät, den Schmuck heimlich zu tragen, was Gretchen von ihrer Sittsamkeit abbringt. Sie wird von Mephistopheles benutzt, um Faust und Gretchen zu verkuppeln, indem sie ihren Garten als Treffpunkt zur Verfügung stellt. Sie ebnet so den Weg für die Liebesbeziehung zwischen Faust und Gretchen, obwohl diese moralisch fragwürdig ist.
Welche Quellen wurden für das Referat verwendet?
Das Referat stützt sich auf folgende Quellen: die Ausgabe von "Faust I" aus dem Philipp Reclam jun. Verlag, Erläuterungen und Dokumente von Ulrich Gaier (ebenfalls Reclam), "Goethes Faust" von Jochen Schmidt (Verlag C.H. Beck), "Johann Wolfgang Goethe, Faust I und Faust II" von Ralf Sudau (Oldenbourg Verlag) und einen Eintrag von Hausarbeiten.de.
- Quote paper
- Helen Ostermeyer (Author), 2003, Goethe, Johann Wolfgang von - Faust I - Marthe Schwerdtlein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107483