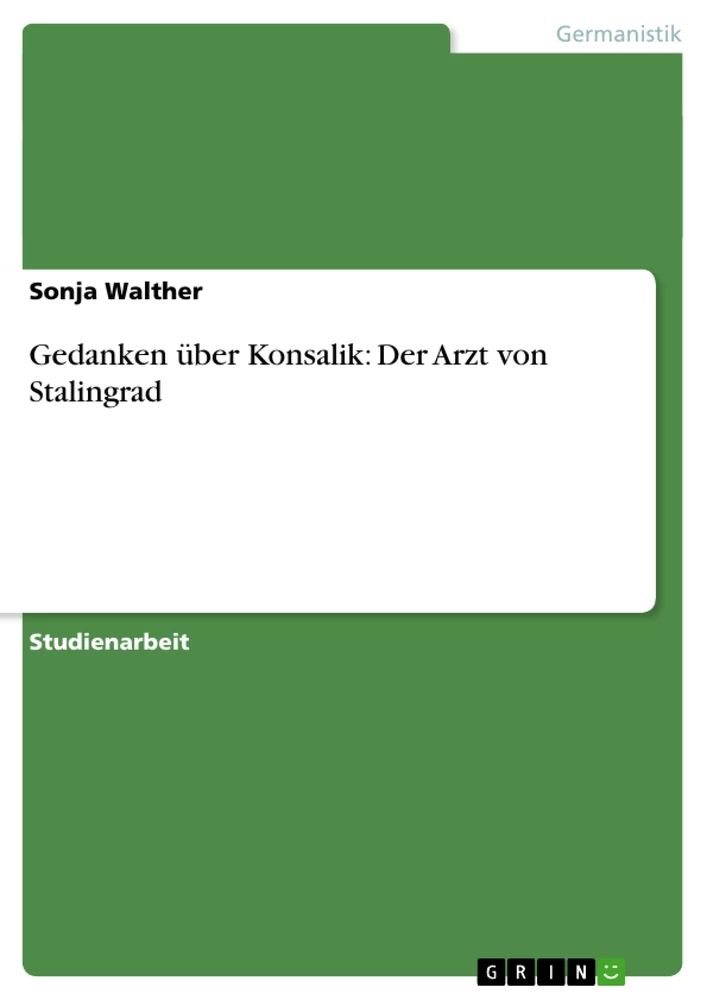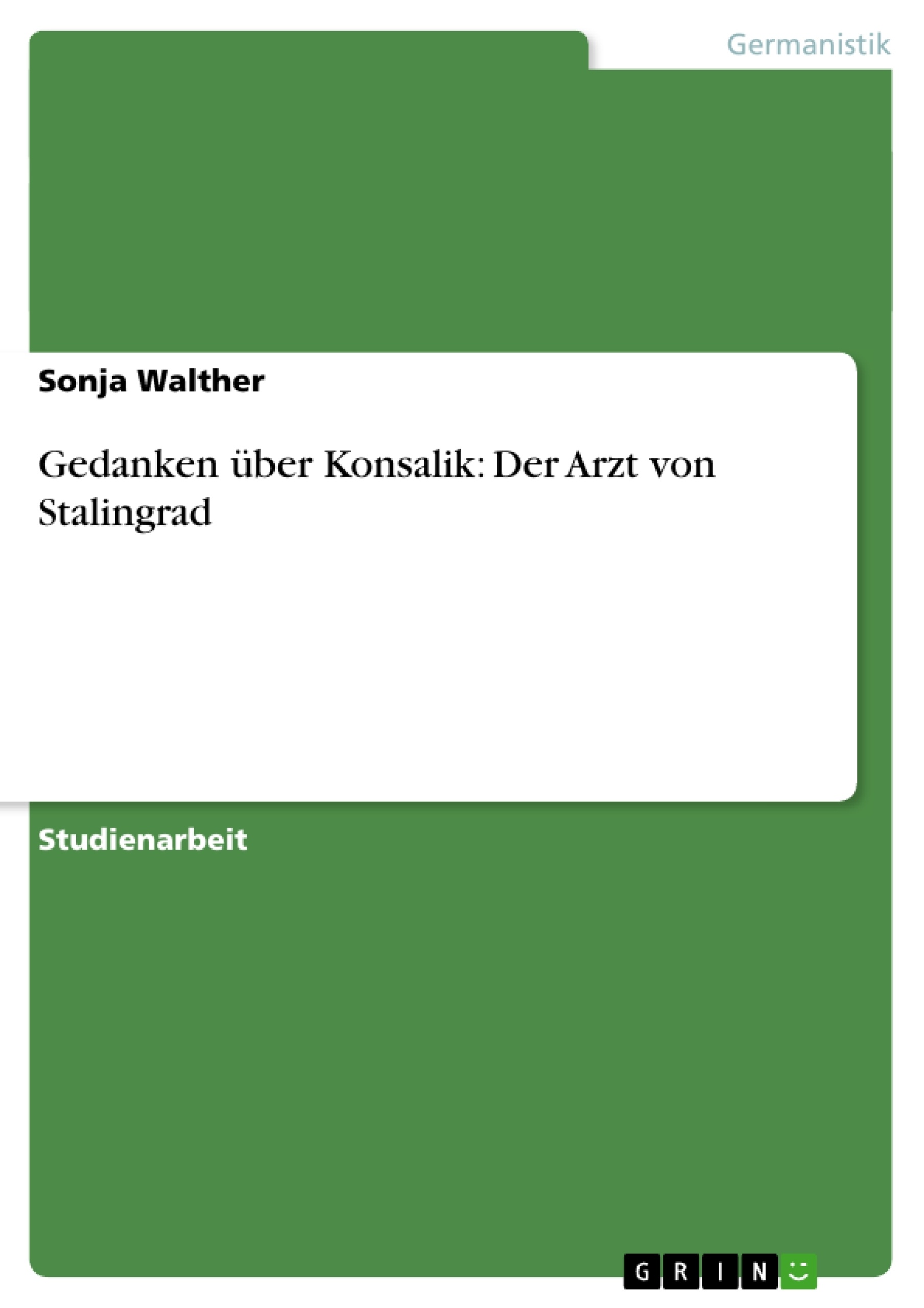Hinter Stacheldraht und eisiger Kälte, jenseits der zerstörten Mauern Stalingrads, entfaltet sich ein erschütterndes Drama um Leben, Tod und die unerbittliche Suche nach Menschlichkeit. In einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager, fernab von der Heimat, kämpfen deutsche Ärzte ums Überleben – und um das ihrer Patienten. Dr. Böhler, ein brillanter Chirurg, avanciert zur Legende, als er unter widrigsten Bedingungen medizinische Wunder vollbringt. Mit improvisierten Instrumenten und unerschütterlichem Willen trotzt er dem Tod und beweist die Kraft des menschlichen Geistes. Doch die Schatten der Vergangenheit reichen tief in das Lager hinein. Vergewaltigung, Verrat und ideologischer Hass drohen, die letzten Funken Hoffnung zu ersticken. Zwischen dem fanatischen Hass eines russischen Offiziers und der Verzweiflung der Gefangenen entbrennt ein Kampf um Würde und Gerechtigkeit. Konsalik zeichnet ein düsteres Bild der Nachkriegszeit, in dem die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen. Der Leser wird Zeuge von unglaublichen Operationen, die an Wunder grenzen, und erlebt die Grausamkeit des Krieges hautnah. Kann Dr. Böhler, der "Arzt von Stalingrad", seine Ideale bewahren und inmitten von Leid und Elend die Menschlichkeit retten? Eine fesselnde Geschichte über die Schrecken des Krieges, die Macht der Medizin und die unbezwingbare Hoffnung auf eine bessere Zukunft, angesiedelt im Spannungsfeld zwischen deutscher Kriegsgefangenschaft, sowjetischer Propaganda und dem Ringen um die eigene Identität. Ein bewegendes Zeitdokument, das die Leser in seinen Bann zieht und lange nach dem Zuklappen des Buches noch beschäftigt. Die intensive Schilderung des Lagerlebens, die dramatischen medizinischen Eingriffe und die vielschichtigen Charaktere machen diesen Roman zu einem unvergesslichen Leseerlebnis. Tauchen Sie ein in eine Welt der Entbehrungen, der Verzweiflung und des unerschütterlichen Glaubens an die Kraft der Menschlichkeit. Konsaliks Werk ist ein Spiegelbild der deutschen Nachkriegszeit, in dem die Traumata des Krieges und die ideologischen Gräben die Gesellschaft spalten. Ein aufrüttelndes Plädoyer für Frieden, Versöhnung und die unbedingte Achtung der Menschenwürde. Entdecken Sie die erschütternde Wahrheit hinter den Mauern von Stalingrad und lassen Sie sich von der unsterblichen Geschichte des "Arztes von Stalingrad" berühren.
Heinz G. Konsalik: Der Arzt von Stalingrad (1956)
Historischer Hintergrund:
Die Vergangenheitsbewältigung der 50er Jahre führte zu einem historischen Revisionismus, „der darauf angelegt war, die deutsche Wehrmacht und deren Kriegsführung von den in der Sowjetunion verübten Kriegsverbrechen zu distanzieren und den deutschen Soldaten als Opfer hinzustellen“1 Die Öffentlichkeit der 50er war der Meinung, dass „die Wehrmacht im Unterschied zur Waffen-SS und anderen NS-Formationen ‚ ‚anständig’ und ‚sauber’ geblieben sei [...]“2. Hinzu kam, dass ein Arzt, in diesem Roman ein Chirurg, sich nicht vor sich selbst und der Öffentlichkeit verteidigen musste, da der hippokratische Eid eines Arztes dem Eid auf den Führer entgegenzustehen schien; die Tatsache, dass Wehrmachtsärzte genauso wie solche der SS auf Hitler vereidigt wurden, wurde nicht beachtet3. Der Nürnberger Ärzteprozess im Jahre 1947 wurde kaum wahrgenommen. Auch dessen Dokumentation, die 1960 unter dem Titel „Medizin ohne Menschlichkeit“ erschien, fand kaum Leser und Leserinnen. Sie verdeutlicht, dass eben nicht nur SS-Ärzte, sondern auch General- und Stabsärzte an den Medizinverbrechen des 2. Weltkrieges beteiligt waren.4 Des weiteren führte der Besuch Adenauers in Moskau 1955 und die daran anschließende Freilassung deutscher Kriegsgefangener aus der Sowjetunion5 zu einem Klima, dass den Trivialroman Konsaliks zum Bestseller werden ließ. Die Gründung der Bundeswehr 1955 und die Wiedereinführung der Wehrpflicht im März 1956 erforderte einen Rückgriff auf ehemalige Wehrmachtsgrade, so dass Konsaliks „Verbindung von Ehrenrettung der Wehrmacht“ und „Warnung vor sowjetischer Aggression“ sich großer Leserschaft erfreute6.
Vorbemerkungen zum Text:
Konsaliks Roman „Der Arzt von Stalingrad“ wird zur Trivialliteratur7 gerechnet. Der Titel lässt vermuteten, die Handlung spiele im Stalingrad von 1942/43. Der Handlungsort des Romans ist aber ein sowjetisches Lager für deutsche Kriegsgefangene außerhalb von Stalingrad. „Stalingrad“ fungiert hier also nur als Reizwort, da die Handlung ebenso gut in einem anderen Lager hätte stattfinden können8. Die erzählte Zeit erstreckt sich über die Jahre 1947-1954. Sie lässt sich allerdings schwierig herausfinden, da der Autor nur wenig Jahreszahlen nennt und der Roman mit zahlreichen Naturbeschreibung angereichert ist. Ziel dieses Erzählens ist die Entrealisierung9 und Enthistorisierung des Kriegsgeschehens. Hinzu kommt, dass die Verbrechen bzw. Kriegsaktivitäten der Soldaten unerwähnt bleiben. Dargestellt wird lediglich das Ausharren und die Qualen der deutschen Soldaten im Gefangenenlager der Sowjets. Die Perspektive, die auch der Leser einnehmen muss, ist die der deutschen Soldaten. Sie sind Opfer der Brutalität und Aggressivität der „Russen“.
Inhaltlicher Abriss:
Im Mittelpunkt des Geschehens stehen die deutschen Ärzte Dr. Schulheiß, Dr. von Sellnow und Dr. Böhler. Letztgenannter ist das Vorbild der anderen, auch der russischen Ärzte, und wird im Laufe des Romans zur Heilsfigur stilisiert. Ihm gelingen unter den schlechtesten Voraussetzungen schwierige Operationen, die er ohne medizinische Grundausrüstung, meistert. Mit einem Taschenmesser und einem Seidenfaden, der einem Seidenschal entstammt, vollzieht er zu Beginn der Handlung eine Blinddarmoperation, die ihm natürlich glückt. Später erkrankt sein Kollege, Dr. von Sellnow, an einem Gehirntumor, den Dr. Böhler mit Hilfe eine Meißels und eines einfachen Bohrers entfernt. Höhepunkt seiner Glanzleistungen bildet eine Magenkrebsoperation, die Dr. Böhler vor hundert russischen Studenten durchführt. Professor Taij Pawlowitsch, Russlands größter Chirurg und Stalinpreisträger, der sich der Behandlung des Kranken entzogen hatte, bezeichnet dieses Wagnis als eine Operation, „die es in der russischen Medizingeschichte noch nicht gegeben habe.“10 Insgesamt erscheinen die deutschen Ärzte, insbesondere Dr. Böhler, als Wunderärzte und Übermenschen. Ihre sensationellen Operationen gehören in den Bereich des Phantastischen11.
Neben diesen drei Wunderheilern treten russische Ärzte und Ärtzinnen, deutsche Kriegsgefangene, sowjetische Bewacher, Offiziere, Patienten und Hilfspersonal, wie z.B. der Sanitäter Emil Pelz, auf.
Auch die für den Trivialroman üblichen Sexualszenen sind trotz des düstergestalteten Handlungsortes eines Gefangenenlagers enthalten. Dr. von Sellnow vergewaltigt die russische Ärztin Alexandra Kasalinsskaja, die ihm nach der Vergewaltigung hörig wird. Dies geht sogar so weit, dass sich sich die Pulsadern aufschneidet, als Dr. von Sellnow verhaftet wird und scheinbar die Todesstrafe zu erwarten hat12. Dr. Schultheiß hat ein Liebesverhältnis mit der lungenkranken Brigadeführerin Janina Salja. Die einzige standhafte Figur ist Dr. Böhler, der auch in dieser Hinsicht Vorbild bleibt. „Seine Reinheit ist offensichtlich durch seine Rolle als ‚deutscher Wunderarzt’ und opferbereites Vorbild bedingt und reflektiert die Kontinuität der NS-Rassen-Ideologie im Trivialroman“13.
Die beiden russischen Frauen Janina Salja und Alexandra Kasalinsskaja werden als triebhaft geschildert und entsprechen dem Dirnen-Klischee, so bezeichnet sich Janina selbst als Tier, das nicht gegen seine Triebe ankommt14. Währenddessen wird von den deutschen Frauen nichts negatives transportiert. Sie erfüllen ihre Pflichten als Krankenschwester oder als Ehefrauen. So erfährt der Leser z.B. von der Ehefrau Dr. von Sellnows, namens Luise, dass sie eine blonde, starke Frau sein muss, die in der Heimat standhaft die gemeinsamen Kinder versorgt und auf ihren Mann wartet, den sie immer noch liebt, auch wenn dieser bereits seit mehr als 6 Jahren in Gefangenschaft ist.
Der Roman nutzt jede Gelegenheit zu „primitiv propagandistischen Ausfällen gegen Kommunismus, DDR und Sowjetunion.“15 Sofern es möglich ist, wird von einer Person auf die ganze russische bzw. deutsche Nation geschlossen. Der Russe steht dem Deutschen konträr gegenüber. Nie ist jemand nur ein Mensch, nein, er ist immer ein Deutscher oder ein Russe, der seine Nation verkörpert.
Es wird ein Hassbild des Russen gezeichnet, dass vor allem an der Figur Piotr Markow, einem russischen Offizier im Lager, evident wird. Schon sein Äußeres verrät nichts Positives: „Der Mann trug eine abzeichenlose Uniform, sein fettes, schwarzes Haar glänzte matt. Über seinen dicken Lippen trug er einen buschigen schwarzen Schnurbart.“16 Besonders seine Äußerungen und Gedanken, die dem Leser, wo immer möglich mitgeteilt werden, zeigen seine Bestialität und seinen Hass auf Deutsche. Das Leben der deutschen Gefangenen interessiert ihn nicht. So behauptet er z.B. „Ein russischer Schal ist mehr wert als 10.000 deutsche Leben!“17 Eine andere Textstelle verdeutlicht noch mehr seinen Sadismus: „Er sah das Blut aus dem Gesicht Sauerbrunns rinnen und hätte jauchzen können, daß es deutsches Blut war. Er hatte das unheimliche Verlangen, dieses rinnende Blut zu trinken, um schreien zu können: ’Ich fresse einen Deutschen...’“18 Allerdings ist das Bild der Unmenschlichkeit und Grausamkeit der Russen nicht auf diese Figur beschränkt. Auch der Lagerkommandant Major Worotilow verhält sich fast überall grausam, was von ihm selbst als typisch russisch bezeichnet wird. Auf diese Weise wird „den Sowjets im Zeichen der Totalitarismus-Theorie die Rolle der Nazis zugeschoben.19 “ Worotilow vertritt das Prinzip der Härte. „Weil die Grausamkeit die einzige Stärke ist, die wir euch Deutschen voraushaben.“20 antwortet er im Gespräch mit Dr. Böhler, als dieser fragt, wie ein Prinzip, nämlich das der Russen, die Deutschen unterkriegen zu wollen, solche Grausamkeit erzeugen kann. Vor dieser Antwort gibt Worotilow außerdem zu, dass die Russen die Deutschen bewunderten und der Deutsche schon oft geschichtliche Lehrmeister der Russen gewesen sei.
Diese Szene verdeutlicht zweierlei: Zum einen wird die absolut grundlose Brutalität der Russen dem Leser vor Augen geführt, zum anderen weist die Stelle auf die Unterentwicklung der Russen bzw. auf die Höherentwicklung der Deutschen hin, was auch an anderen Stellen deutlich wird. Damit tritt neben das Bild des hassenden, brutalen Russen, das des armen, unwissenden Russlands, das Deutschland als Lehrmeister braucht21. Als beispielsweise die deutschen Gefangenen erstmals seit vier Jahren Pakete aus der Heimat erhalten dürfen, tritt die scheinbare Unwissenheit der Russen zu Tage. Piotr Markow soll den Inhalt der Pakete untersuchen, bevor sie den Deutschen ausgehändigt werden. Hierbei wird seine Unkenntnis vorgeführt, die stellvertretend für das arme Russland steht. Er erkennt nämlich eine Kokosnuss nicht, da er so etwas in seinem Leben noch nie gesehen hat. Auf diese Weise macht er sich vor den „deutschen Plennis“ lächerlich, die ihm vorgaukeln, es handele sich um ein Elefantenei22. Noch deutlicher wird die ökonomische Unterlegenheit Russlands anhand „Eiermanns Schnellpudding“. Der Gefangene Peter Fischer hat mehrere Päckchen dieses Puddings, den man ohne Kochen und ohne Zucker einfach in kaltes Wasser anrühren muss, aus Deutschland geschickt bekommen Mit diesem geht Peter Fischer zu Michail Pjatjal, einem russischen Küchenjungen, und führt ihm den Pudding vor. Peter bezeichnet den Pudding als einfachen, deutschen Arbeiterpudding, den jeder erschwingen könnte, während Michail vor vier Jahren das letzte Mal Pudding gegessen hat und einen solchen Wunderpudding noch nie gesehen hat23. Dies zeigt zum einen die wissenschaftliche Weiterentwicklung Deutschland, hier im lebensmitteltechnischen Bereich, zum anderen wird wieder deutlich, dass es dem einfachen Menschen in Deutschland aus ökonomischer Sicht besser geht als dem in Russland. Dies ist also auch eine Kritik an der Planwirtschaft Russland, die mit dem politischen System des Kommunismus einhergeht. Allerdings wird an anderen Stellen explizit Kritik am Kommunismus genommen. So z.B. in der Argumentation Piotr Markow: „’Wir haben immer Krieg, solange die Welt nicht restlos kommunistisch ist!’ Markow wurde erst. Der Funke des Fanatismus glomm in seinen Augen. Sein Gesicht wurde kantig und brutal. ‚Erst wenn die rote Fahne die Weltflagge ist, gibt es Ruhe auf der Welt, solange kämpfen wir gegen alle und alles...’“.24 Nicht nur der angebliche Fanatismus des Kommunismus wird dargestellt, auch die Machtlosigkeit des Einzelnen, der, so mächtig er auch ist, immer einen mächtigeren über sich hat.. Fällt das Wort Moskau, das heißt ein Befehl von ganz oben, sind alle Offiziere und auch Stalinpreisträger machtlos. So argumentiert Dr. Kresin, der russische Kollege Dr. Böhlers im Lager, gegenüber des Oberarztes unter der Leitung Pawlowitschs, der den genesenden Dr. von Sellnow für seine Zwecke weiter im Staatskrankenhaus behalten will: „Oder soll ich nach Moskau melden, daß der Oberarzt von Stalingrad es wagte, einen Mann festzuhalten, der schon eine Transportnummer für die Fahrt nach Deutschland hat? Soll ich das, Brüderchen? Man wird dir dann in den Hintern treten und dich in die Sümpfe schicken.[...]“25.
Die DDR findet zwar wenig, aber wenn negative Bemerkung. Als die deutschen Gefangenen Briefe aus der „Heimat“ erhalten und deutsche Zeitungen lesen dürfen, dies alles entspricht übrigens dem neuen Kurs Moskaus, das erkannt hat, dass gutgenährte und zufriedene Gefangene besser arbeiten als unzufriedene und hungernde, erfährt der Leser, dass die Menschen in der sowjetischen Besatzungszone 1947 noch hungern (aus der Zeitung „Tägliche Rundschau“) während die Bevölkerung in Westdeutschland ausreichend versorgt ist (aus einem Brief von der Mutter eines Gefangenen).26.
Als Dr. Böhler drei Jahre später als seine Kollegen Dr. Schultheiß und Dr. von Sellnow, „deutschen Boden betritt“, so ist es nicht etwa bei Frankfurt an der Oder, sondern in „Helmstedt an der Zonengrenze“27.
Fazit:
Der Roman ist durchtränkt mit Hassbildern der Sowjets. Hinzu kommt die generelle Verdrehung der Tatsachen: Die deutschen Gefangenen erscheinen als Opfer. Die nachgewiesene Misshandlung sowjetischer Gefangener in deutschen Kriegsgefangenenlagern wird deutlich verleumdet; Dr. Böhler bezeichnet sie als „Greuelmärchen“28. Umgekehrt wird auch die Schuld der Ärzte: hier ist es der sowjetische Professor, der intrigiert und lügt, Dr. Böhlers Verdienste als seine eigenen verkaufen möchte und es gerne gesehen hätte, wenn Dr. von Sellnow seinem Gehirntumor erlegen wäre, um an ihm Versuche zu machen. Hingegen werden die Verbrechen der beiden SS-Ärzte, die zugeben mit Choleraviren versuche an lebenden Menschen gemacht zu haben, vor dem Leser gerechtfertigt.
Insgesamt beschönigt der Roman die Vergehen der Deutschen, in dem er sie rechtfertigt oder ausspart, und bietet eine Hetzpropaganda gegen die Sowjets, den Kommunismus und die DDR. Die Denkstrukturen des Autor sind in kriegerischen Feindbildern verhaftet, was sich neben der inhaltlichen Ebene in der Sprache deutlich zeigt: Die Deutschen und die Russen, die Heimat und Mütterchen Russland. Konsalik schaffte durch die „Mobilisierung von latent rassistischen Urteilen“29 einen großen Erfolg und seinen Durchbruch als freier Schriftsteller.
Aspekte des Kriegsromans:
1. Die verlorengegangene Generation (lost generation):
- „Man hat mir nichts genommen als meine Jugend. Aber dafür liegt das Leben noch vor mir...“(S. 32; Dr. Schultheiß)
- „Er wurde sich des Betruges seiner Jugend bewusst, und er schwieg, weil er keinen Trost wusste, der Janina und ihn selbst hätte trösten können.“( S.76, Dr. Schulheiß)
2. Der Aspekt der Heimat (kommt immer nur in Briefen, Erinnerungen als Gegensatz zu dem „Kriegsschauplatz“):
- Dr. Sellnow und der Unterarzt Dr. Jens Schultheiß standen am Fenster und blickten hinaus in die Abendsonne, die dort unterging, wo Tausende von Kilometern entfernt die Heimat lag. ‚Jetzt ist in Berlin sonniger Nachmittag’ meinte Sellnow düster. ‚Und bei Ihnen in Köln, Dr. Böhler, gehen sie jetzt im Stadtwald bummeln. Schöne Frauen flirten mit netten Männern in teuren englischen Maßanzügen und können es nicht erwarten, bis der Abend kommt ... Und wir hier? Es ist zum Kotzen!’“ (S. 30)
3. Passives Heldentum:
- Die gefangenen deutschen Soldaten gelten als Helden, weil sie ausharren und durchhalten.
- Anders aber die deutschen Ärzte, besonders Dr. Böhler, die als aktive Helden erscheinen.
4. Die Helden scheitern wegen äußerer Umstände, nie wegen ihrem eigenen Unvermögen:
- So auch Dr. Böhler, der alle Operationen meistert, trotz der widrigen Bedingungen.
- In einer Erinnerung Dr. Böhlers erzählt er aber von Soldaten, die er nicht retten konnte. „Tausende konnten wir helfen ... aber noch mehr starben, weil die äußeren Umstände sie sterben ließen - nicht wir, die Ärzte!“ (S. 63)
5. Das Thema Kameradschaft und Desertion/Fahnenflucht/Überläufer:
- Dr. Böhler will „streiken“, da die Nahrungsmittel im Lager gekürzt worden.
Worotilow macht ihm klar, dass wenn er nicht operiert, es kein anderer tun dürfte:
„Was wird, ist wichtig, nicht das Heldentum! Und gerade war er dabei, seine Kameraden zu verlassen, sie zu verraten, sie einfach sterben zu lassen, weil er im Zorn über die Strafmaßnahme der Lagerleitung sein Amt zur Verfügung stellt.“ Dr. Böhler gibt also auf und fügt sich der Kameradschaft unter. (S. 283)
- Auch der Umgang mit Walter Grosse, der in Todesangst V-Mann für die MWD wird und seine Kameraden bespitzelt, zeigt die Überbewertung von Kameradschaft. Es wird versucht, Walter Grosse im Kot zu ertränken. Nachdem Dr. Böhler ihn rettet, was ihm seine Pflicht als Arzt abverlangt, setzt er Grosse unter Druck, niemanden etwas über die Täter zu sagen, ansonsten würde er ihn nicht mehr behandeln (S. 272). Auch bei dem russischen Worotilow gilt er insgeheim als „Verräter“!
- Die Szene mit Hans Sauerbrunn verdeutlicht den Status der kameradschaftlichern Treue am stärksten. Er hatte sich als Essenholer verirrt und war in die russischen Linie gelaufen. So kam er in die Gefangenschaft. Es wird von russischer Seite vermutet, dass Hans in Wirklichkeit Sauerbruch heiße und Sohn eines Arztes in Berlin sei, der bei den Russen hohes Ansehen genoss. Würde Sauerbrunn nun zugeben, dass er eben dieser Sauerbruch sei und mit Absicht zu den Russen übergelaufen wäre, wäre er wohl binnen kurzer Zeit ein freier Mann. Doch er weigert sich. Aus Kameradschaft! (S. 84ff)
6. Der Roman des Obergefreiten
- Der deutsche Kriegsroman wird meist aus der Perspektive eines einfachen Soldaten geschildert, der an den Entscheidungen der Großen und Mächtigen unschuldig ist.
Hier wird von einem auktorialen Erzähler berichtet, allerdings aus der Perspektive der deutschen Ärzte. Aber auch die Sicht der armen Landser spart der Roman nicht aus: „Es waren Landser, arme Schweine, die nur ihre Pflicht taten, die im Dreck lagen, weil man es ihnen befahl, und die in Gefangenschaft kamen wie eine Herde Lämmer, die dem Leitbock nachtrottete.“ (S. 425)
[...]
1 Helmut Peitsch: Towards a History of Vergangenheitsbewältigung. East and West German War Novels of the 50s. In: Monatshefte 87 (1995), S. 287-308.
2 Ehrhard Bahr, Defensive Kompensation. Peter Bamm: Die unsichtbare Flagge (1952) und Heinz G. Konsalik: Der Arzt von Stalingrad (1956), in: S. 200.
3 Ebd., S. 201.
4 Ebd., 201-202.
5 Ebd., S. 203.
6 Ebd..
7 „Frz. Trivial: allbekannt, gewöhnlich; Literarische Schriften, die inhaltlich und sprachlich als minderwertig gelten, meist Werke, in denen immer die selben Themen (Liebe, Abenteuer, Krieg, Verbrechen, Heimat, Science Fiction) in abgedroschener, d.h. klischeehafter Weise abgehandelt werden, gelten als Trivialliteratur“, aus: Metzler Literaturlexikon. Begriffe und Definitionen, 1990.
8 Bahr, S. 203.
9 Ebd., S. 205.
10 Zitiert nach Heinz G. Konsalik, Der Arzt von Stalingrad, Kindler-Ausgabe 1956, S. 357.
11 Bahr, S. 208-209.
12 Konsalik, S. 293.
13 Bahr,S. 209.
14 Konsalik, S. 146.
15 Ebd., S. 203.
16 Konsalik, S. 27.
17 Ebd., S. 37.
18 Ebd., S. 85-86.
19 Bahr, S. 210.
20 Konsalik, S.98.
21 Verwiesen sei nochmals auf die Unfähigkeit des russischen Stalinpreisträger, die Magenkrebsoperation durchzuführen und seine anschließende Bewunderung für die medizinische Fähigkeit Dr. Böhlers.
22 Konsalik, S. 394.
23 Ebd., S. 397-399.
24 Ebd., S. 69.
25 Ebd., S. 459.
26 Ebd., S. 223-224.
27 Ebd., S. 486.
28 Ebd., S. 39.
Häufig gestellte Fragen zu Heinz G. Konsalik: Der Arzt von Stalingrad (1956)
Was ist der historische Hintergrund des Romans?
Der Roman entstand in den 50er Jahren, einer Zeit der Vergangenheitsbewältigung, die oft zu einem historischen Revisionismus führte. Dieser Revisionismus versuchte, die deutsche Wehrmacht von Kriegsverbrechen in der Sowjetunion zu distanzieren und deutsche Soldaten als Opfer darzustellen. Die öffentliche Meinung war, dass die Wehrmacht im Gegensatz zur SS "anständig" geblieben sei. Die Freilassung deutscher Kriegsgefangener aus der Sowjetunion und die Gründung der Bundeswehr trugen ebenfalls zur Popularität des Romans bei.
Worum geht es inhaltlich in dem Roman?
Der Roman handelt von deutschen Ärzten in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Mittelpunkt stehen Dr. Schulheiß, Dr. von Sellnow und Dr. Böhler, wobei Dr. Böhler als Vorbild und Heilsfigur dargestellt wird. Er führt unter schwierigsten Bedingungen spektakuläre Operationen durch. Der Roman thematisiert das Ausharren und die Qualen der deutschen Soldaten in Gefangenschaft und zeichnet ein negatives Bild der Sowjets.
Welche Rolle spielt Stalingrad im Roman?
Obwohl der Titel "Der Arzt von Stalingrad" lautet, spielt die Handlung nicht im Stalingrad von 1942/43, sondern in einem sowjetischen Lager für deutsche Kriegsgefangene außerhalb von Stalingrad. "Stalingrad" dient hier vor allem als Reizwort.
Wie werden die russischen Figuren im Roman dargestellt?
Die russischen Figuren werden oft negativ dargestellt, insbesondere Piotr Markow, ein russischer Offizier im Lager, der als bestialisch und hasserfüllt gegenüber Deutschen beschrieben wird. Auch der Lagerkommandant Major Worotilow wird als grausam dargestellt. Insgesamt wird den Sowjets im Roman die Rolle der Nazis zugeschrieben.
Welche Rolle spielen die Frauen im Roman?
Die russischen Frauen, Janina Salja und Alexandra Kasalinsskaja, werden als triebhaft und dem Dirnen-Klischee entsprechend dargestellt. Deutsche Frauen hingegen werden positiv als pflichtbewusste Krankenschwestern oder Ehefrauen porträtiert.
Welche Kritik am Kommunismus und der DDR wird im Roman geübt?
Der Roman kritisiert den Kommunismus und die DDR, indem er beispielsweise die Planwirtschaft Russlands und die Lebensbedingungen in der sowjetischen Besatzungszone negativ darstellt. Die Unfreiheit des Einzelnen und die Macht der Bürokratie werden ebenfalls thematisiert.
Welche Aspekte des Kriegsromans werden im Text genannt?
Es werden verschiedene Aspekte des Kriegsromans genannt, darunter die "verlorene Generation", die Bedeutung der Heimat, passives Heldentum, das Scheitern der Helden aufgrund äußerer Umstände, Kameradschaft und Desertion, sowie die Perspektive des einfachen Soldaten.
Wie lautet das Fazit zur Gesamtinterpretation des Romans?
Der Roman ist von Hassbildern der Sowjets durchtränkt und verdreht die Tatsachen, indem er deutsche Gefangene als Opfer darstellt und sowjetische Gräueltaten verleumdet. Die Denkstrukturen des Autors sind in kriegerischen Feindbildern verhaftet, was sich in der Sprache und im Inhalt des Romans zeigt.
- Quote paper
- Sonja Walther (Author), 2002, Gedanken über Konsalik: Der Arzt von Stalingrad, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107461