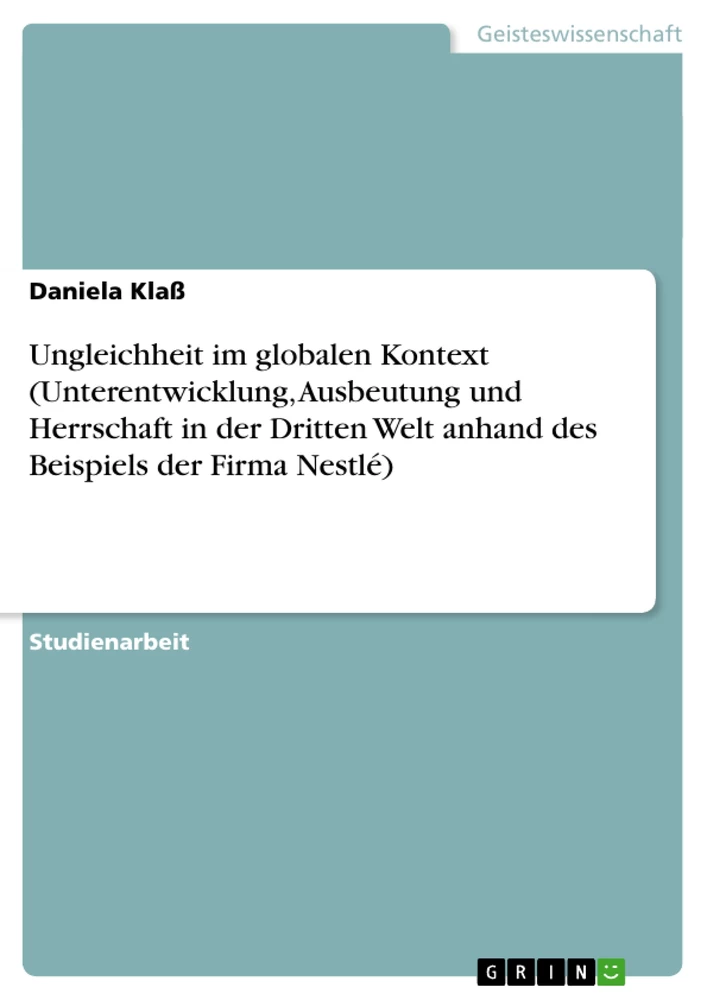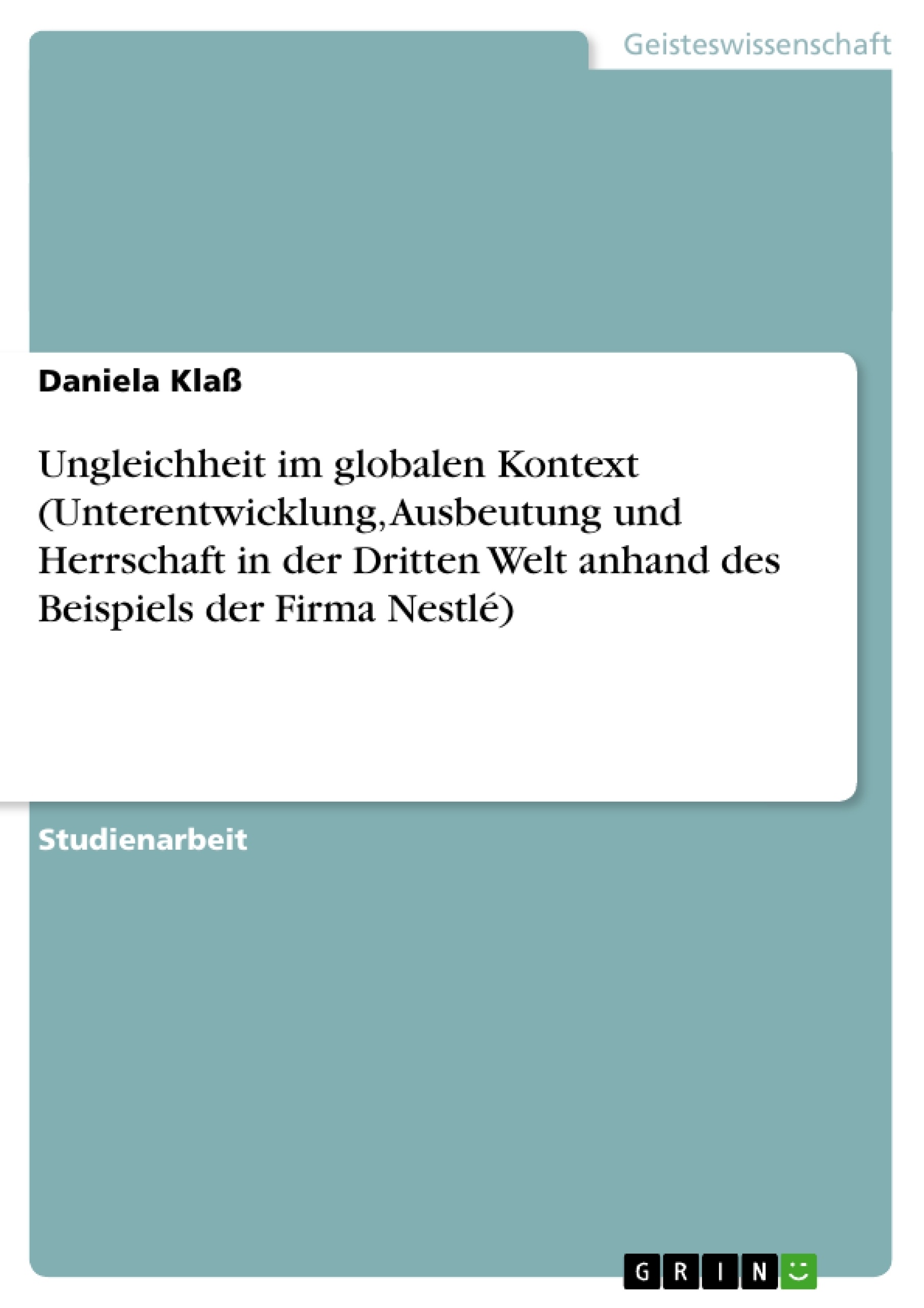Geht man heute mit dem Anspruch, keine Nestlé Produkte zu kaufen, in einen Supermarkt, so hat man es schwer alternaive Produkte zu finden. Fast alle Nahrungsmittel auf dem Markt werden von Nestlé oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt. Nestlé hat seine Märkte weltweit ausgedehnt, so dass man diese Firmenprodukte selbst in ärmeren Ländern kaum umgehen kann. Zum Beispiel in Mexiko ist das Wasser aus der Wasserversorgung nicht genießbar und die Einwohner müssen zum Kochen und Trinken purifiziertes Wasser der Firma Nestlé kaufen, da die einheimischen Firmen nicht über Vertriebssysteme verfügen. Diese weltweite Verbreitung von Nestlé Produkten ist nur durch imperialistische Strukturen möglich.
1. Darstellung der Imperialismustheorien, des Zentrum-Peripherie-Modells
1.1. Entstehung und Grundlagen der Imperialismustheorien
Die Industrieländer versuchen noch heute ihre Herrschaftsstrukturen auszuweiten, obwohl die letzten Kolonien Ende des zweiten Weltkrieges ihre politische Unabhängigkeit erlangt haben, da sie sowohl Rohstoffressourcen, wie Erdöl, Edelmetall und Mineralien, der südlichen Entwicklungsländer benötigen, als auch in den bevölkerungsreichen Zonen neue Absatzmärkte suchen, was zur Expansion ihrer Einflussgebiete führt.
Die Soziologie der letzten zwei Jahrhunderte hat versucht den Imperialismus durch verschiedene Theorien zu erklären.
Die machttheoretische Imperialismustheorie sieht in dem Eroberungsdrang machthungriger Individuen, Unternehmen und Staaten die Ursache des Imperialismus.
Das politpsychologische Erklärungsmodell beschreibt den Imperialismus als Verlagerung der innenpolitischen Unzufriedenheit mit der sozialen Gerechtigkeit im Inland durch Aggressionen und Eroberung ins Ausland.
Die kulturphilosophische Imperialismustheorie versucht eine Rechtfertigung für den Expansionsdrang zu bieten, indem sie ihr ideologisches Weltbild als Allheilmittel auf die unterentwickelten Länder überträgt. Darunter fallen auch die Missionsbestrebungen der großen Religionen.
Das politökonomische Erklärungsmodell begründet seine Aussagen mit der Kapitalanhäufung im Inland und der Verlagerung des Finanzpotentials auf überseeische Märkte.
An dieses Erklärungsmodell knüpft Lenin an. Aus seiner Sicht ist der Kapitalismus die höchste Form des Imperialismus, statt Material wird Kapital exportiert zur Schaffung einer Finanzoligarchie. „Es bilden sich int. Monopolistische Kapitalistenverbände, die die Welt unter sich teilen.“ (1, Imperialismustheorien) Eine weitere Theorie ist die Dependencia-Theorie, die Konstanz und Wandel des Imperialismus neu thematisiert hat. Durch die Unterstützung der Industrieländer bei der Schaffung einer Infrastruktur in den Entwicklungsländern entsteht eine wirtschaftliche Abhängigkeit, die Johann Galtung mit dem Zentrum-Peripherie-Modell zu erklären versucht.
1.2. Zentrum-Peripherie-Modell
Galtungs „Grundannahme ist eine hierarchische Struktur der Weltgesellschaft, die historisch durch den sich entfaltenden kapitalistischen Weltmarkt und die mit ihm sich ausprägende internationale Arbeitsteilung entstanden ist“ (1, Zentrum-Peripherie-Modell). Er analysiert die Interessenlagen des Systems und lässt die Ebene der staatlichen Beziehung außer Acht. Eine Gemeinschaft mit „gemeinsamen Wert- und Kommunikationshorizont“ (2, Seite 48) spaltet sich auf in Zentrum mit den maßgebenden und der Peripherie mit den untergeordneten Mitgliedern.
Das Zentrum konzentriert alle Kräfte, um Macht, Kapital, Einfluss und einen hohen Lebensstandard für sich zu erhalten und weiter auszubauen. Die Peripherie partizipiert zum Teil am Erfolg des Zentrums, aber Einzelne versuchen sich dem Standart des Zentrums anzunähern, wodurch eine Kräftezersplitterung in der Peripherie stattfindet. Durch diese Konstellation wird ein Spannungsfeld geschaffen, das das Zentrum festigt und die Peripherie wegen ihrer „mangelnden Konfliktfähigkeit“ (2, Seite 44) weiter an den Rand drängt.
Dieses Zentrum-Peripherie-Modell wendet Galtung auf diversen Ebenen an, um zu zeigen, dass das Spannungsverhältnis zwischen Zentrum und Peripherie in jeglichen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens eine dynamische Kraft entfaltet. Nach Galtung bestehen auf globaler Ebene die Zentren aus höchstentwickelten, kapitalistischen Nationen und die Peripherien aus den unterentwickelten Ländern. Die Zentren sind darauf bedacht, dass die mit ihnen interagierenden Peripherien keine Verbindungen zu anderen Zentren aufnehmen, damit die Peripherien nicht in eine Interessenssplitterung geraten. Diese Abhängigkeitsbeziehung der Entwicklungsländer von den Industrieländern begreift Galtung „als Ausdruck struktureller Gewalt in den internationalen Beziehungen“ (1, Imperialismustheorien). Daraus schließt er, dass die Weiterentwicklung der Industriestaaten einen Fortschritt der Entwicklungsländer bremst oder gar das niedrige Einkommen verringert. Wenn zum Beispiel der Weltmarkt den Kaffeepreis unter die Erzeugerkosten drückt, bleibt den Pflanzern in den Entwicklungsländern keine Möglichkeit ihren Lebensunterhalt zu sicher, während in den Industrieländern der Kaffee für die Händler einen immer noch großen Gewinn abwirft und die Verbraucher ihre Lebenshaltungskosten senken können.
Unter regionalen Aspekten gesehen kann ein Land die Funktion eines Subzentrums mit gewisser Autonomie übernehmen. So hat Brasilien sich durch seine Demokratisierung, Industrialisierung und Exportorientierung eine zentrumsähnliche Stellung in den peripheren, südamerikanischen Länder erarbeitet und konnte sich mit einer Währungsreform im Jahre 1994 im eigenen Land durchsetzen und die Inflationsrate erfolgreich begrenzen.
Das Zentrum-Peripherie-Modell kann auch innerhalb der Nationen angewandt werden. In den Entwicklungsländern sind die Zentren, meist größere Städte, mit den ausländischen Zentren besser verknüpft, als mit ihrer jeweiligen Peripherie. Das hochmoderne Mexikocity ist an internationalen Banken, Fluglinien, Autobahnen und Technologiesystemen angeschlossen, das periphere Hinterland dagegen ist strukturell gering erschlossen. Dieses Gefälle der Infrastruktur löst eine große Zuwanderung von Menschen, die sich fälschlicher Weise eine bessere Zukunft erhoffen, aus und lässt die Slums täglich wachsen.
1.3. Imperialismustheorie nach Galtung bezogen auf Industrienation und Entwicklungsland
Johann Galtung geht bei seiner Imperialismusdefinition von einer Interaktion zwischen einer Zentralnation und einer Peripherienation mit ihren jeweiligen Zentren und Peripherien aus. Die Zentralnation ist ein hochentwickeltes Industrieland, wie zum Beispiel die USA, mit einer Peripherie, die am Erfolg des Zentrums partizipiert. Die Peripherienation hingegen ist ein Entwicklungsland, das über ein Zentrum verfügt, welches ein „Monopol der internationalen Interaktion in alle Richtungen“ (3, Seite 55) hat. Durch die Rückständigkeit und mangelnden Strukturen der Peripherie zum Zentrum der Peripherienation, bestehen kaum Möglichkeiten an den Vorteilen des Zentrums teilzuhaben. Dies hat eine Disharmonie in der Peripherienation zur Folge, da nur das Zentrum von der Interaktion mit der Zentralnation profitiert. Zwischen dem Zentrum der Peripherienation und dem der Zentralnation herrscht eine Interessensharmonie, wohingegen sich zwischen den beiden Peripherien eine große Disharmonie ausweitet, was zur Folge hat, dass sich die beiden Peripherien vermutlich nie zusammen tun werden, um gemeinsam gegen die Zentren vorzugehen, da die Peripherie der Zentralnation sich als Partner des Zentrums und eigene Vorteile in der gegenwärtigen Situation sieht. Die egalitäre und demokratische Zentralnation übt so eine „effektive Kontrolle“ (3, Seite 79) über die Peripherienation aus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Zentrum auf einer Rangskala oben und die Peripherie unten angesiedelt ist. Grundsätzlich bereichert sich das Zentrum bei Interaktionsbeziehungen mehr als die Peripherie und hat „hinsichtlich der Infrastruktur ... eine zentralere Lage im Interaktionsnetz“ (3, Seite 87).
1.4. Fünf Typen des Imperialismus
Galtung unterscheidet fünf Typen des Imperialismus, die von der Art des „Austausches zwischen Zentral- und Peripherienation abhängen“ (3, Seite 55). Hinsichtlich des ö konomischen Imperialismus bestehen die Interessen der Zentralnation vorwiegend an Rohstoffen und Absatzmärkten, wären der Peripherienation an Produktionsmitteln und Industrie Aufbau gelegen ist.
Die Zentralnation bietet beim politischen Imperialismus Entscheidungen und (Vorbild) Modelle, auf die die Peripherienation mit Gehorsam und Nachahmung antwortet, da die Entwicklungsländer von dem Erfolg des vorgegebenen Modells überzeugt sind. Eine dritte Variante ist der militärische Imperialismus. Die Entwicklungsländer erwarten Schutz und Waffen, währen die selbst der Zentralnation Militär und vorhandene traditionelle Kriegsgerätschaften zur Verfügung stellen. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die imperialistische Kommunikation. Die Zentralnation bietet Kommunikations-, Verkehrsmittel und Nachrichten, worauf die Peripherienation mit Passagieren, Gütertransport und Informationen reagiert, wobei die Machtansprüche der Zentralnation gewahrt bleiben, da sie versucht ihre technische Überlegenheit zu erhalten und die Nachrichten im Inhalt und der Ausführlichkeit zu ihren Gunsten zu nutzen.
Beim kulturellen Imperialismus bietet die Zentralnation ein Vorbild non Autonomie und Kreativität und sucht Bestätigung und die Abhängigkeit der Peripherienation. Sie übernehmen die Funktion des Lehrers für die Peripherienation, die sich in die Situation des Lernenden begeben.
Galtung hat die Reihenfolge der fünf Typen zufällig gewählt. Er hat „keine Theorie, die darauf hinweist, dass einer der Typen grundlegender als die anderen ist oder ihnen vorausgeht. Vielmehr ähnelt das Ganze einem Fünfeck (Pentagon) ...: der Imperialismus kann von jeder Ecke ausgehen“ (3, Seite 55). Dieter Nohlen kommentiert dies damit, dass „in der bloßen Auflistung“ der Imperialismustypen „eine Schwäche seines Ansatzes“ liegt, „da es Galtung nicht gelingt, deren relatives Gewicht jeweils genauer zu bestimmen“ (1, Imperialismustheorien).
2. Nestlé - ein Beispiel für einen Internationalen Konzern in der Dritten Welt
In meinen weiteren Ausführungen möchte ich auf das von Galtung dargestellte Beziehungsgeflecht imperialistischer Strukturen eingehen und es anhand des von Pierre Harrison, geboren 1946, in seinem Buch „Das Imperium Nestlé“ beschriebenen Vorgehens des international agierenden Konzerns Nestlé in Kolumbien verdeutlichen.
2.1. Der transnationale Konzern (TNK) Nestlé
Die Firma Nestlé ist der Marktleader für löslichen Kaffee. Sie stellt jegliche Nahrungsmittel von Kindernahrung bis zu Schokoriegeln und Fertigsuppen her. Nur 5,4% ihrer gesamten Produktion besteht aus Pharmazie, Kosmetik und einigen mit Nestlés Kapital geführten Hotels. Nestlé ist ein Weltkonzern, der als transnational bezeichnet werden kann, da er in diversen Staaten Unternehmen, Tochter- gesellschaften und Majoritäten an Firmenanteilen besitzt. Die Zentralverwaltung sieht ihre Aufgaben in den Finanzen, Information, Entwicklung und Einführung neuer Produkte. Die Tochterunternehmen verfügen über eine relative Autonomie, da sie für die Vermarktung und Werbung im Gastland selbst zuständig sind. Solch ein transnationaler Konzern expandiert horizontal, indem er in mehren Ländern Gleiches fabriziert, und dehnt sich vertikal in einem Land aus, um den Markt des Landes zu erreichen und dessen Rohstoffe für sich zu gewinnen. Der Bevölkerungsreichtum verspricht billige Arbeitskräfte und große Absatzmärkte und weckt somit das Interesse der transnationalen Konzerne. Die nationalen Zentren der Entwicklungsländer sehen ihrerseits Vorteile in Devisen, Steuereinnahmen und Arbeitsplätzen und bieten den transnationalen Konzernen eine Ansiedlung in ihren Städten zu besonders günstigen Konditionen, so dass sich die transnationalen Konzerne ein Monopol aufbauen können.
2.2. Das Land Kolumbien
Die geographische Lage Kolumbiens mit Zugang zu zwei Weltmeeren und einer Fläche von gut einer Million Quadratkilometern, etwa die vierfache Größe Deutschlands, mit 35 Millionen Einwohnern bietet einem transnationalen Konzern wie Nestlé gute Vorraussetzungen für die Gründung eigener Niederlassungen. Kolumbien besteht aus drei Kordillerenzügen, die das Land in Nord-Süd-Richtung durchtrennen und aus fruchtbaren Zonen, die den Anbau von Agrarprodukten wie Blumen, Soja und Kaffee, aber auch der Kokapflanze, die zur Herstellung von Kokain verwandt wird, ermöglichen.
Kolumbien ist eine Präsidentrialrepublik, die sich seit 1990 am Neoliberalismus orientiert. Die dadurch bedingten Privatisierungen und die sogenannte „wirtschaftliche Öffnung“ (4) haben vor allem bei den niedrigen Einkommensschichten katastrophale Auswirkungen gehabt. Seit dem letzten Jahrhundert gab es Dutzende von Bürgerkriegen und seit 1948 eine ununterbrochene Guerillaaktivität, auf die die Armee, Großgrundbesitzer sowie Teile der Regierung und der Industrie mit dem Aufbau von paramilitärischen Terrorgruppen geantwortet haben.
2.3. Die ökonomische Imperialismusstruktur
Die Firma Nestlé importiert erstmals 1938 ihre Produkte in den kolumbianischen Markt. Seither trachtet sie danach, durch Aufkauf und Verdrängung ihrer Konkurrenz die Kontrolle über den kolumbianischen Absatzmarkt und die Produktionsstätten zu erlangen. Dies hatte zur Folge, dass Nestlé seit 1971 52% des Kapitals und der Unternehmen von kolumbianischen Industrie- und Finanzgesellschaften besitzt. Um diese Majorität zu halten und auszuweiten schließt sich Nestlé mit großen Konkurrenzfirmen zusammen, kauft kleinere auf und gründet eigene Niederlassungen. So schloss sich Nestlé 1946 mit der Firma Borden, die ebenfalls an der milchwirtschaftlichen Produktion in Kolumbien beteiligt war, zu CICOLAC (Compañia Colombiana de Alimentos Lacteos) zusammen. Auf diese Art war es ihnen möglich, sich in den kolumbianischen Frischmilchmarkt einzuschalten und die mit weniger Kapital ausgestattete kolumbianische Konkurrenz vom Markt auszuschließen. Von diesem Standpunkt aus kauften sie Fabriken zur Herstellung von pasteurisierter Milch in mehreren Regionen auf, die sie teilweise umstrukturiert, geschlossen oder weiter-verkauft haben, um sowohl eine Kontrolle über die Frischmilchproduktion zu erlangen und für sich wirtschaftlich auszunutzen, als auch einen Produktionswandel von pasteurisierter Milch zu teuren Milchprodukten zu vollziehen. Die aufgekauften Unternehmen wurden systematisch wegen angeblicher Unrentabilität aufgelöst und die Arbeiter entlassen. Nachdem die Niederlassungen Nestlés wie ein Netz im Land verteilt waren, gründete dieser transnationale Konzern die Tochtergesellschaft Industria Nacional de Productos Alimenticios SA (INPA), deren Kapital einer 100% Kontrolle von Nestlé unterlag. Die INPA stellte teure Nestléprodukte, wie zum Beispiel Nescafé, Milo, Celerac, Suppen und Bouillons für den kolumbianischen Markt her.
2.4. Die politische Imperialismusstruktur
Die Grundlage für die Zusammenarbeit des Entwicklungslandes Kolumbien mit dem transnationalen Konzerns Nestlé waren sich überschneidende Interessen. Kolumbien sah diverse Vorteile durch die Ansiedlung von Nestlé, wie zum Beispiel der Aufbau industrieller Strukturen, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Infrastruktur, wachsende Steuereinnahmen und Erlangung von Devisen. Nestlé nutzte diese Erwartungen des Gastlandes, um im Land zu expandieren, sich möglichst ungehindert Rohstoffe beschaffen zu können und sich eine oligopole Stellung für ihre Produktion zu sichern. Nachdem Nestlé ihre Tochtergesellschaft INPA in Kolumbien gegründet hat, erfährt sie einen Protektionismus durch die kolumbianische Regierung, die den Import von Lebensmitteln, die denen im eigenen Land produzierten ähneln, verbietet. Nestlé erhielt sogar eine Importgenehmigung für Trockenmilch aus Panama, um über genügend Rohstoffe zu verfügen und die Produktionskosten von Milchprodukten um 20% zu senken. Die kolumbianische Regierung hat 1976 diese Unterstützungspolitik teilweise aufgegeben. Seither übt Nestlé politischen Druck auf die Regierung aus, um ihre Interessen zu wahren. Nestlés Kontrolle über die nationale Milchwirtschaft und die Art der Einflussnahme auf politische Entscheidungen lässt sich durch das Beispiel ihres erfolgreichen Kampfes gegen die englische Importmarke Millac aufzeigen. Trotz hoher Qualität führte Milla ihre Produkte zu niedrigen Preisen auf dem kolumbianischen Markt ein und startete somit einen ernstzunehmenden Konkurrenzkampf gegen Nestlé. Nestlé reduzierte, nachdem sie ihre Konkurrenz ein Jahr lang geduldet hatte, „mit dem Ziel, die Konsumenten an die Verwendung von Milchpulver zur Herstellung von Flüssigmilch zu gewöhnen“ (5, Seite 220), den Verkauf ihrer Produkte, um die Regierung von der Schädlichkeit der Importe für die kolumbianische Industrie zu überzeugen und erwirkte ein Importverbot. Durch die schwierige wirtschaftliche Lage in Kolumbien erlangte Nestlé eine politische und ökonomische Machtstellung, mit der sie auf die Wirtschaftspolitik der Regierung direkten Einfluss nehmen kann. Die Regierung ist hin- und hergerissen, da eine Knappheit von Frischmilch in Kolumbien herrscht, andererseits bringt die Verarbeitung zu hochdifferenzierten Molkerei- produkten wichtige Einnahmequellen für den Staat. Wenn Kolumbien in das wirtschaftliche Geschehen eingreift, hat es mit Repressionen des transnationalen Konzerns zu rechnen, was die Möglichkeit politisch zu Handeln einschränkt.
2.5. Die militärische Imperialismusstruktur
Durch die Einnahmen aus der Industrie wird der Aufbau des Militärs gefördert. Als Gegenleistung genießt der transnationale Konzern Nestlé den militärischen Schutz von Industrieanlagen und Führungspersonal. Ebenfalls kann er sich der Unterstützung des Militärs bei der Verhinderung effektiver Gewerkschaftsarbeit und der Repression bei Demonstrationen und Arbeiterstreiks sicher sein. Nestlé gelang es, einen schweizerischen Geschäftsführer, der erst vier Monate in Kolumbien arbeitete zum Ehrenhauptmann der kolumbianischen Polizei ernennen zu lassen, um im Falle eines Konfliktes mit der Unterstützung und dem Eingreifen der zivilen und militärischen Behörden rechnen zu können. Ein probates Mittel ist die häufige Ausrufung des Ausnahmezustandes, welches viele Menschenrechte, wie z. B. das Versammlungsrecht und die Pressefreiheit, außer Kraft setzt.
Die Firma Nestlé versucht das Entstehen von Mitarbeitervertretungen in ihren Niederlassungen zu unterbinden. So bietet sie zum Beispiel ihren Mitarbeitern eine Lohnerhöhung, wenn diese zusichern, dass sie auf die von der Gewerkschaft geforderten Tarifvereinbarungen verzichten, um eine Spaltung zwischen Arbeitern und Gewerkschaft zu bewirken. Sollte dennoch ein Streik von der Gewerkschaft iniziiert werden, stellt das Unternehmen Zeitarbeiter ein und setzt somit seine streikenden Angestellten mit dem drohenden Verlust ihres Arbeitsplatzes unter Druck. Ein weiteres Vorgehen von Nestlé in Kolumbien ist die Einstellung neuer Mitarbeiter mit einem Blankoarbeitsvertrag, der der Firma alle Möglichkeiten der Vertragsgestaltung einräumt und den Arbeitern jeglicher Arbeitsrechte beraubt. Außerdem werden führende Gewerkschafter massiv bedroht, verschwinden plötzlich oder werden sogar ermordet.
„All dies muss als Bestandteil der repressiven Politik Kolumbiens gesehen werden, einer „konstitutionellen Diktatur“, wo die Regierung die Interessen der Industrie- und Finanzbourgoisie sowie der Großgrundbesitzer vertritt“ (5, Seite 243).
2.6. Die Kommunikationsimperialismusstruktur
Da Nestlé als TNK bestehende Verkehrsverbindungen, wie Schiffe, Flugzeuge und transkontinentale Straßen, für den Import ihrer Produkte nutzen und den Staat Kolumbien für eine Inlandsproduktion interessieren konnte, war es ihr möglich die Form der Kommunikation für sich günstig zu gestalten. Zum Transport der Rohstoffe, Herstellung der Produkte und des Vertriebes wurde mit Unterstützung des Staates ein Verkehrsnetz geschaffen, das die notwendige Kapazität für den schnellen Transport leichtverderblicher Güter von den Kühlzentralen zu den Pasteurisierungs- anlagen gewährleistet. Durch Nestlés internationalen Informationsaustausch hat sie Einfluss und Kontrolle auf das im Land über sie verbreitete Image. Die Firma stellt sich als Entwicklungshilfeunternehmen dar und bewirbt in den Entwicklungsländern ihre Säuglingsnahrungsmittel als gesund und lebensnotwendig, was dazu führt, dass Frauen ihre Kinder nicht mehr stillen. Diese Werbepraxis widerspricht dem Verhaltenskodex der World Health Organisation (WHO) und dessen Einhaltung wurde erfolgreich eingeklagt. Nestlé reagiert auf diese Gerichtsentscheidungen mit wiederholten Versuchen, diese Urteile zu umgehen. In Kolumbien wurde Nestlé 1977 die Schuld am Tod von 28 früh geborenen Säuglingen nachgewiesen. Durch Nestlés penetrante Werbestrategie in den Krankenhäusern mit Gratisproben war es für die kolumbianischen Frauen selbstverständlich, ihre Kinder mit der Nestogeno-Milch zu ernähren. „Bei der Herstellung des Milchpulvers wurden hinsichtlich Sterilisierung und Lagerung Fehler begangen, was zu einer Vermehrung der Bakterien und der Produktion von Toxinen führte.“ (5, Seite 229) Nestlé reagierte auf diese Vorwürfe mit der Feststellung, dass es sich hier um Einzelfälle handelt und zitiert in El Tiempo am 12. Dezember 1979 das kolumbianische Gesundheitsministerium wie folgt: „Die festgestellten Todesfälle“ sind „nicht dem Produkt zuzuschreiben ... (Nestogeno- Milch), sondern anderen Faktoren technischen Charakters, welche seither verbessert wurden.“ (5, Seite 229)
2.7. Die kulturelle Imperialismusstruktur
Die zunehmende Industrialisierung führt zu einem gesellschaftlichen Wandel in einer Agrarregion. Die Kleinbauern (Campesiños) verlassen, da sie für sich und ihre Familien eine bessere Perspektive in den größeren Städten, wie Medellin, Cali und der Hauptstadt Kolumbiens Bogota, sehen, ihre ländlichen Dörfer. Diese Landflucht hat zur Folge, dass sich um die großen Industriestädte Slums bilden, in denen jegliche Infrastruktur, wie Straßen, feste Häuser, Wasserversorgung, Kanalisation und Schulen, fehlen. Besonders schlechte Bedingungen ergeben sich daraus für die Frauen, deren Männer sie entweder allein mit den Kindern auf dem Land zurücklassen oder sie müssen für einen Billiglohn in den Industrien arbeiten. Dies ist ein gewaltiger Rückschritt, denn auf dem Land waren sie gleichberechtigt und autark, da sie mit ihren Handarbeiten zu einem großen Teil des Einkommens beitrugen. Vor der Industrialisierung konnte sich die Landbevölkerung durch den Anbau aller lebensnotwendigen Nahrungsmittel, wie Mais, Kartoffeln, Gemüse und Früchte, selbst versorgen. Das Fehlen dieser Grundnahrungsmittel hatte den Wechsel von der traditionellen Ernährungsweise zu industriell produzierten Nahrungsmitteln mit Unterernährung, Gesundheitsschäden (Tuberkulose und erhöhte Kindersterblichkeitsrate durch den Verzicht auf das Stillen) und eine Vergrößerung der Armut zur Folge.
Durch Nestlés Milchwirtschaft schien es den Großgrundbesitzern lukrativer ihre Agrarflächen in Weideland umzuwandeln statt sie an die Campesiños zu verpachten und die Rinderzucht von den Berghängen in die Täler zu verlegen, um die Herden zu vergrößern und die Milchgewinnung zu vereinfachen. Dieses Vorgehen zerstört die historisch gewachsenen Strukturen der Dorfgemeinschaften und führt in den Randbezirken der Städte durch den Mangel an Verdienstmöglichkeiten zu Kriminalität, Drogenhandel und Alkoholmissbrauch. Die in den Bergregionen verbliebenen Bauern sahen sich gezwungen den Kokaanbau zu forcieren, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dies führte zur Entstehung einer Kokainmafia, die weite Teile des Landes beherrscht. Die USA wollen den Drogenkonsum in Amerika schon in den Ursprungsländern der Drogen bekämpfen und haben mit der kolumbianischen Regierung Verträge zur Unterstützung des kolumbianischen Militärs zur Zerstörung der Drogenplantagen aus der Luft ausgehandelt. Als Gegenbewegung entstanden eine starke Guerilla und paramilitärische Einheiten, die jeder für sich versuchen gegen das Militär vorzugehen.
12% der kolumbianischen Bevölkerung sind Analphabeten und die unteren Schichten haben keine Chance am Bildungssystem Anteil zu finden, da Schulgeld, Schuluniform und teure Lehrmittel ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigen. Die Firma Nestlé bietet ihren Beschäftigten finanzielle Unterstützung, wie Darlehen, Studienbeihilfe und Schulgeld an, fordert aber im Gegenzug den Verzicht auf gewerkschaftliche Aktivitäten und ist an der Verbesserung der allgemeinen Bildungssituation nur interessiert, für sich besser ausgebildete Mitarbeiter zu gewinnen.
3. Relevanz für die Soziale Arbeit
Die Grundlage für eine soziale Ordnung der Gesellschaft wurde bereits am 4. Juli 1776 in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung durch die Festschreibung der allgemeinen Menschenrechte auf Gleichheit, Freiheit, Streben nach Glück und ein unveräußerliches Recht auf Leben verankert. Um eine Umsetzung dieser Ideale erreichen zu können, muss man erst einmal die noch existierende Ungleichheit vor Augen haben. Man muss sich die Strukturen der politischen Beherrschung, der wirtschaftlichen Ausbeutung und der kulturellen Entfremdung bewusst machen, um die Situation der Ausbeutung und Domination von der Wurzel her verändern zu können, und diese öffentlich anklagen. Da die Form der bisherigen Entwicklungshilfe der Industrieländer bisher davon ausging, den Wohlstand in den Entwicklungsländer n von ihrer Sichtweise aus zu fördern, verstärkten sich die Abhängigkeitsverhältnisse und führten zu hohen Verschuldungen der Entwicklungsländer. Um Visionen einer Veränderung zu haben, ist es erforderlich bei den benachteiligten Bevölkerungs- gruppen die eigenen Bedürfnisse und Wünsche für ein besseres Leben in Erfahrung zu bringen und mit ihnen gemeinsam Handlungskonzepte zu erarbeiten, die ihrer eigenen Kultur und Denkweise entsprechen. Der Aufbau von Basisorganisationen ist die Bedingung für die Verbreitung und die Durchführung dieser Konzepte, um weltweit Bündnispartner zu gewinnen. Der Einfluss solcher Bündnisse hat im Hinblick auf ihre Wirksamkeit Chancen auf Unterstützung von den großen Netzwerken, wie UNESCO, WHO, Gewerkschaften und Kirchen.
Durch die von den Basisgruppen weltweit geleistete Zusammenarbeit (Aufklärung, Boykotts und Streiks) ist es ihnen gelungen, lebensfähige Alternaiven aufzuzeigen und durch ihren kulturellen und ethnischen Reichtum die gewohnten Spaltungen zu ignorieren. Es hat sich erwiesen, dass die Basisgruppen in ihren Aktionen selbstkritisch sind, ihre Unternehmungen sorgfältig analysieren und für ihr zukünftiges Vorgehen eine verbesserte Form suchen. Wichtig ist, dass diese Bewegung nur von der Basis der Betroffenen ausgehen kann. Gabriel Marc, ein Verantwortlicher einer französischen Hilfsorganisation meinet, das man den Menschen vor Ort „die Verantwortung für ihre Entwicklung nach ihrem eigenen Gutdünken wieder zurückgeben“ (5, Seite 351) muss. „Dann zeigt sich das Volk mit seiner eigenen Organisationsfähigkeit, wobei traditionelle und importierte Lebensformen zu einer Einheit zusammenfinden. Für die Armen sind solche Organisationsformen für ihre Existenz und Entwicklung und für die Ausübung ihres göttlichen Rechtes unabdingbar“. Um in den Industrieländern eine Solidarisierung mit den Bestrebungen in den Entwicklungsländern zu erreichen, bedarf es auch einer Änderung unserer Lebensführung. Es ist an der Zeit unser Konsumverhalten zu überdenken, da wir den größten Teil unseres Wohlstandes aus den Ressourcen der Entwicklungsländer schöpfen.
Ich denke eine vordringliche Aufgabe der Sozialen Arbeit hier ist es, die Zusammenhänge zwischen Konsumverhalten und der Armut in den Entwicklungsländern zu verdeutlichen und auf den bewussten Umgang mit Energie, Nahrungsmitteln und Umweltressourcen hinzuwirken. Durch die internationale Vernetzung von Wirtschaft und Politik wird auch eine soziale Globalisierung erforderlich, die die Ungleichheit verringert und das Streben nach Gleichheit und Gerechtigkeit aller Menschen als Ziel hat.
4.1. Quellenverzeichnis
1. Nohlen, D.: Lexikon Dritte Welt
2. Kreckel, R.: Politische Soziologie sozialer Ungleichheit 3. Galtung, J.: Eine strukturelle Theorie des Imperialismus (In: Senghaas, D.[Hg.]: Imperialismus und strukturelle Gewalt)
4. http://www.berlinet.de/htp/projekt/eln/colom-d.htm
5. Harrison, P.: Das Imperium Nestlé
4.2. zusätzliche Literatur
- Mies, M.: Globalisierung von unten
- Giddens, A.: Soziologie
- Nohlen, D. (Hg.): Handbuch der Dritten Welt
- Mommsen, W.: Imperialismustheorien
- http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co /11271/1.html
- http://www.babynahrung.org
- http://www.weltbilder.de/html/hunger.htm
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen der Analyse über Nestlé und Imperialismus?
Die Analyse beschäftigt sich mit den Imperialismustheorien, insbesondere dem Zentrum-Peripherie-Modell, und untersucht, wie diese Theorien sich im Verhalten des transnationalen Konzerns Nestlé in Entwicklungsländern, speziell in Kolumbien, widerspiegeln. Es geht um ökonomische, politische, militärische, kommunikative und kulturelle Imperialismusstrukturen.
Welche Imperialismustheorien werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die machttheoretische, politpsychologische, kulturphilosophische und politökonomische Imperialismustheorie. Zudem wird auf Lenin's Kapitalismustheorie und die Dependencia-Theorie eingegangen.
Was ist das Zentrum-Peripherie-Modell?
Das Zentrum-Peripherie-Modell, nach Johann Galtung, beschreibt eine hierarchische Struktur der Weltgesellschaft, in der das Zentrum (Industrienationen) Macht, Kapital und Einfluss konzentriert, während die Peripherie (Entwicklungsländer) von diesem Zentrum abhängig ist. Es analysiert die Interessenlagen des Systems und lässt die Ebene der staatlichen Beziehungen außer Acht.
Wie wendet Galtung seine Imperialismustheorie auf Industrienationen und Entwicklungsländer an?
Galtung sieht eine Interaktion zwischen einer Zentralnation (Industrieland) und einer Peripherienation (Entwicklungsland). Die Zentralnation profitiert von Rohstoffen und Absatzmärkten, während die Peripherienation von den Entscheidungen und Modellen der Zentralnation abhängig ist. Es entsteht eine Disharmonie, da nur das Zentrum der Peripherienation von der Interaktion mit der Zentralnation profitiert.
Welche fünf Typen des Imperialismus unterscheidet Galtung?
Galtung unterscheidet ökonomischen, politischen, militärischen, kommunikativen und kulturellen Imperialismus. Diese Typen hängen von der Art des Austauschs zwischen Zentral- und Peripherienation ab.
Wie wird Nestlé als Beispiel für einen transnationalen Konzern in der Dritten Welt dargestellt?
Nestlé wird als ein Unternehmen dargestellt, das durch seine Marktdominanz und seine Praktiken in Kolumbien die Strukturen des Imperialismus verdeutlicht. Dies beinhaltet den Aufkauf von Konkurrenten, Einflussnahme auf politische Entscheidungen, Nutzung militärischen Schutzes und gezielte Werbestrategien, die negative Auswirkungen auf die Bevölkerung haben.
Welche ökonomischen Praktiken von Nestlé in Kolumbien werden kritisiert?
Kritisiert wird Nestlé's Vorgehen durch Aufkauf und Verdrängung der Konkurrenz die Kontrolle über den kolumbianischen Absatzmarkt zu erlangen. Weiterhin werden die Entlassungen von Arbeitern und die Umstrukturierung von Produktionsstätten kritisiert.
Wie beeinflusst Nestlé die Politik in Kolumbien?
Nestlé übt politischen Druck auf die kolumbianische Regierung aus, um ihre Interessen zu wahren. Beispielsweise durch den Kampf gegen die Importmarke Millac und die Beeinflussung von Importverboten.
Welche Rolle spielt das Militär im Kontext von Nestlé in Kolumbien?
Nestlé genießt den militärischen Schutz von Industrieanlagen und Führungspersonal. Das Militär unterstützt bei der Verhinderung von Gewerkschaftsarbeit und der Repression von Demonstrationen und Arbeiterstreiks.
Wie beeinflusst Nestlé die Kommunikation und Kultur in Kolumbien?
Nestlé nutzt bestehende Verkehrsverbindungen für den Import ihrer Produkte und die Bewerbung ihrer Säuglingsnahrungsmittel, was zu negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und zur Aufgabe des Stillens führt. Zudem trägt die Industrialisierung durch Nestlé zur Landflucht und zur Bildung von Slums bei.
Welche Relevanz hat die Analyse für die Soziale Arbeit?
Die Analyse verdeutlicht die Notwendigkeit, die Zusammenhänge zwischen Konsumverhalten und Armut in Entwicklungsländern zu verstehen und auf einen bewussten Umgang mit Ressourcen hinzuwirken. Es wird die Bedeutung von Basisorganisationen, internationaler Solidarität und einer sozialen Globalisierung betont.
- Quote paper
- Daniela Klaß (Author), 2002, Ungleichheit im globalen Kontext (Unterentwicklung, Ausbeutung und Herrschaft in der Dritten Welt anhand des Beispiels der Firma Nestlé), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107409