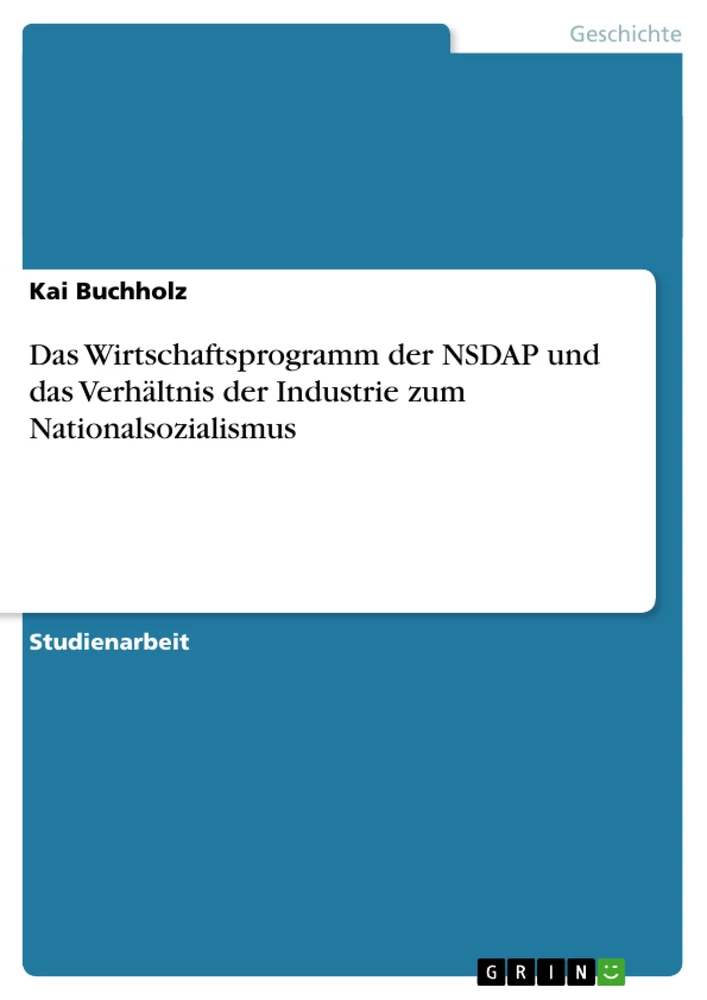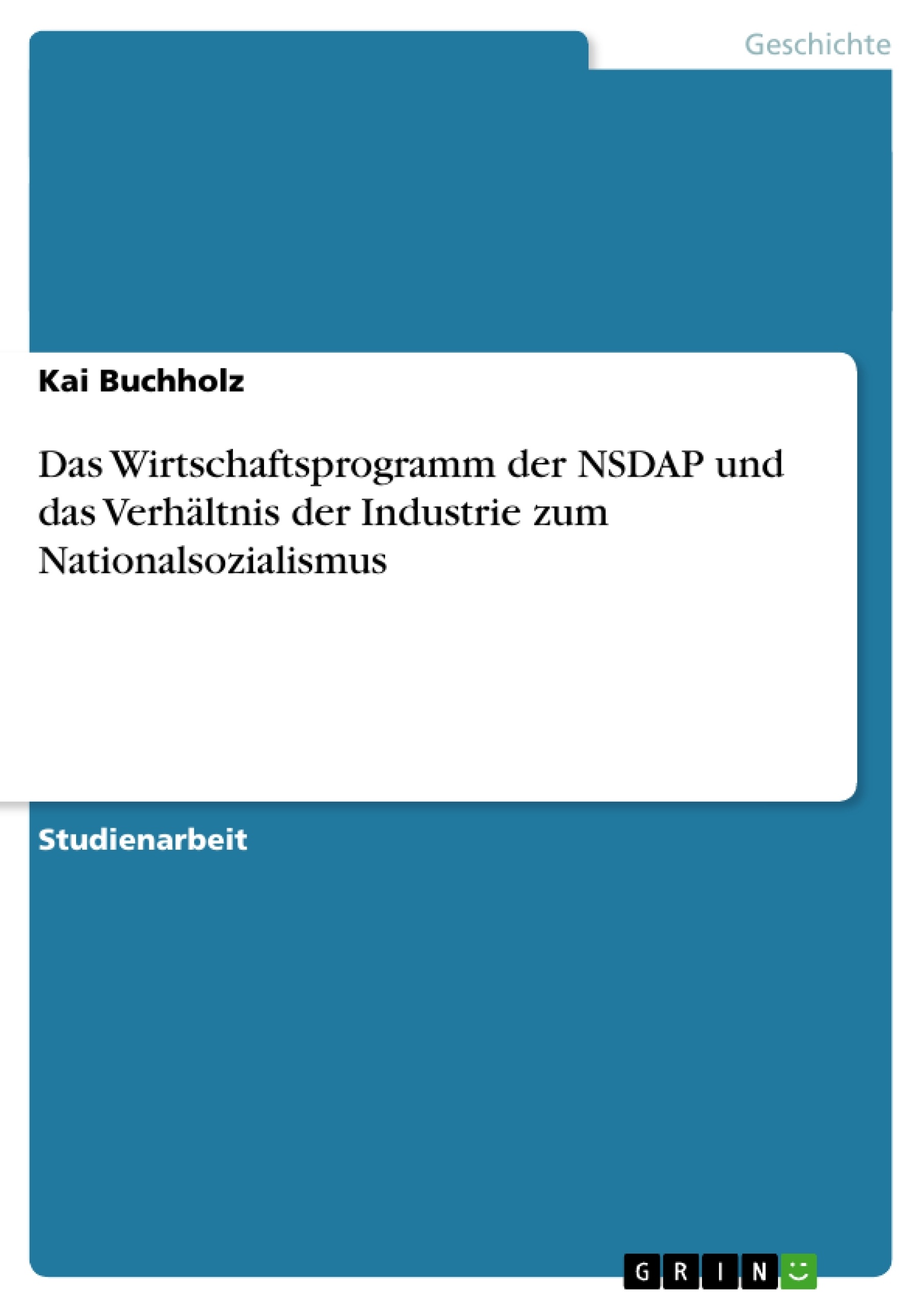Stellen Sie sich vor, eine Nation steht am Scheideweg, während im Schatten der Weltwirtschaftskrise dunkle Mächte nach der Macht greifen. Dieses Buch enthüllt das intrigue Spiel zwischen der NSDAP und den einflussreichsten Industrieverbänden Deutschlands in den kritischen Jahren von 1920 bis 1933. Es analysiert die Entwicklung der wirtschaftspolitischen Vorstellungen der NSDAP, von den vagen Parolen des Parteiprogramms von 1920 bis zu den konkreteren, aber widersprüchlichen Programmentwürfen der Strasser-Brüder. Die zentrale Frage lautet: Wie versuchte die NSDAP, die Unterstützung der Großindustrie zu gewinnen, und welche Rolle spielte dabei die wirtschaftspolitische Programmatik? Die Untersuchung zeigt, dass die NSDAP unter Adolf Hitler bereit war, ihre wirtschaftspolitischen Ziele den Interessen der Großindustrie anzupassen, um den Weg zur Macht zu ebnen. Es wird untersucht, wie der "kapitalistische" Flügel um Hitler den "sozialistischen" Flügel um Gregor Strasser innerhalb der Partei verdrängte und welche Bedeutung dies für die Annäherung an die konservativen Eliten hatte. Im Fokus stehen die Kontakte zwischen NSDAP-Funktionären wie Walther Funk und Wilhelm Keppler und den Industriellen, die Rolle des "Keppler-Kreises" und die Bedeutung von Hitlers Rede vor dem Industrie-Klub Düsseldorf. Das Buch analysiert die Reaktion der Industriellenverbände auf das "Wirtschaftliche Sofortprogramm" der NSDAP und die anschließende Entwicklung des "Wirtschaftlichen Aufbauprogramms". Es wird deutlich, dass die Großindustrie gespalten war: Während einige Teile, insbesondere die Schwerindustrie, eine Regierungsbeteiligung der NSDAP befürworteten, blieben andere, vor allem die exportorientierte verarbeitende Industrie, skeptisch. Das Buch zeichnet ein differenziertes Bild der komplexen Beziehungen zwischen der NSDAP und der Wirtschaftselite und widerlegt die These, dass die gesamte Großindustrie die Machtergreifung Hitlers unterstützte. Es zeigt, dass es vor allem Teile der westlichen Schwerindustrie und andere konservative Kreise waren, die Hitler zum Kanzler machten. Es wird auch gezeigt, dass die Ablehnung des parlamentarischen Systems und die Sehnsucht nach einer autoritären Präsidialregierung eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der NSDAP durch Teile der Wirtschaftselite spielten. Diese Analyse bietet neue Einblicke in die Ursachen des Aufstiegs des Nationalsozialismus und die Rolle der deutschen Wirtschaft dabei und leistet einen wichtigen Beitrag zur Geschichtsforschung über die Weimarer Republik und die NS-Zeit. Es bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Debatte über den "Anteil der deutschen Industrie an der Zerstörung der Weimarer Republik".
Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
2. DAS PARTEIPROGRAMM VON 1920
3. DER PARTEIPROGRAMMENTWURF STRASSERS VON 1926
4. DIE DENKSCHRIFT: „DER WEG ZUM WIEDERAUFSTIEG“ VON 1927
5. DIE ANNÄHERUNG ZWISCHEN NSDAP UND GROßINDUSTRIE
5.1. DIE GROßINDUSTRIELLEN VERBÄNDE IM WECHSEL DER REGIERUNGEN 1930-1933 .
5.2. KONTAKTAUFNAHMEN ZWISCHEN NSDAP UND GROßINDUSTRIE
5.3. EPILOG: DIE INDUSTRIEVERBÄNDE UND DIE „MACHTERGREIFUNG“
6. FAZIT
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS
QUELLEN
LITERATUR
1. Einleitung
„ Sie (die NSDAP) sieht in ihr (der Wirtschaft) nur eine notwendige Dienerin im Leben eines Volksk ö rpers und Volkstums. Sie empfindet eine unabh ä ngige nationale Wirtschaft als eine Notwendigkeit, jedoch sie sieht in ihr nicht das Prim ä re, nicht die Bildnerin eines starken Staates, sondern umgekehrt: Der starke Staat allein kann einer solchen Wirtschaft Schutz und die Freiheit des Bestehens und der Entwicklung geben. “ 1
So äußert sich Adolf Hitler in einer Broschüre von 1927 mit dem Titel „Der Weg zum Wiederaufstieg“. Sie basiert auf einer Denkschrift, die Hitler dem Schwerindustriellen E- mil Kirdorf zugesandt hatte. Dieser hatte eine Rede von Hitler gehört und ihn gebeten, seine Ansichten aufzuschreiben und ihm zu übergeben, damit er diese Denkschrift an seine Geschäftsfreunde und Bekannten verteilen konnte.2 Kirdorf war ein bekannter Wirt- schaftsmann. Er hatte 1893 als Generaldirektor der Gelsenkirchener Bergwerks-AG ent- scheidend an der Bildung des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats mitgewirkt. Er war Mitglied der DNVP gewesen, bevor er zum Anhänger der NSDAP, vor allem Hitlers, wurde und der Partei 1927 beitrat.3
Diese Äußerung zeigt, daß in Hitlers politisch-ideologischen Vorstellungen die Wirt- schaft keine zentrale Rolle spielte. Wie alle anderen gesellschaftlichen Bereiche hatte sich auch die Wirtschaft in den Dienst des „Existenzkampfes des Volkes“ in Konkurrenz zu den anderen „Völkern“, bei dem sich das stärkste „Volk“ durchsetzen und damit den einzig gültigen Existenzanspruch erreichen wird, zu stellen.4 Konsequenterweise bleiben auch offizielle Äußerungen zur Wirtschaftspolitik bei Hitler sowie der NSDAP vor 1930 sehr vage und allgemein. Dies änderte sich erst 1930 mit dem Aufbau der „ Wirtschaftspoliti- schen Abteilung “ (WPA) der Reichsleitung der Partei und der Veröffentlichung eines Ar- beitsbeschaffungsprogramms genannt „ Wirtschaftliches Sofortprogramm der NSDAP “ von 1932 und dem kurz darauf erschienen „ Wirtschaftliche(n) Aufbauprogramm der NSDAP “ .
Da die NSDAP keine klaren und konkreten politischen Ziele besaß, sondern ihre Vor- stellungen eher von diffusen ideologischen Fernzielen, Schlagwörtern und Ressentiments geprägt waren, wie Volkstum, Antisemitismus oder Sozialdarwinismus, konnten sich ei- nerseits sehr unterschiedliche politische Vorstellungen unter ihrem Dach vereinen, und andererseits konnte damit die konkrete politische Programmatik als strategische Manöv- riermasse benutzt werden, um bei unterschiedlichen Umständen unterschiedliche Wähler- gruppen anzusprechen oder sich den politischen Eliten anzudienen. Es gab für die NSDAP bis 1933 nur ein Ziel, das feststand. Diesem Ziel hatte sich alles unterzuordnen hatte: Es war der Gewinn der Macht.
Dieses Charakteristikum der NSDAP kann an der Entwicklung des Wirtschaftspro- gramms gut gezeigt werden und dies ist hier beabsichtigt. Diese Darstellung wird von der These geleitet, daß die Entwicklung der wirtschaftspolitischen Vorstellungen der NSDAP geprägt ist von einem parteiinternen Richtungsstreit zwischen einem „sozialistischen“ La- ger und einem „kapitalistischen“ Lager.5 Das „sozialistische“ Lager - gemeint ist der Strasser-Flügel - verfolgte die Strategie, die Macht dadurch zu erlangen, daß die Arbeiter- schaft für die NSDAP gewonnen werden konnte und versuchte daher die Programmatik der Partei auf diese Zielgruppe auszurichten. Allerdings verblieben diese Programmentwürfe, wie gezeigt wird, eher dem kleinbürgerlichen Milieu verhaftet, als sich den sozialistischen Vorstellungen der organisierten Arbeiterschaft und SPD oder gar dem Kommunismus der KPD anzunähern.
Eine andere Strategie verfolgte der „kapitalistische“ Flügel, der vor allem von Hitler vertreten wurde. Dieser hatte erkannt, daß der Weg zur Macht nur über den Gewinn der Kanzlerschaft zu erreichen war. Dafür bedurfte es, je mehr die Regierungskabinette sich vom Reichstag ablösten, die Unterstützung der herrschenden konservativen Eliten. Eine wichtige Gruppe innerhalb diese Elite stellten die Großindustriellen, bzw. die Verbände in denen diese organisiert waren, dar. Diese hatten einen relativ großen politischen Einfluß, weil sie Organisationen waren, die eine relativ homogene Statusgruppe mit jeweils relativ homogenen Interessen zusammenfaßten und sie waren konfliktfähig, weil sie über politi- sche Einflußchancen verfügten, indem sie kollektiv Leistungsverweigerung androhen und dies auch wahr machen konnten.6 Sollten also die Großindustriellen für die NSDAP ge- wonnen werden, mußten bei der Ausarbeitung eines Wirtschaftsprogramms - als der Be- reich, den die Industrie naturgemäß hauptsächlich interessiert - deren Interessen berück- sichtigt werden.
Da sich der „kapitalistische“ Flügel letztlich innerhalb der Partei durchsetzen konnte, und die Strategie, von den konservativen Eliten an die Macht gehoben zu werden, bekannt- lich erfolgreich war, wird die Annäherung der NSDAP an die Großindustriellen ausführli- cher betrachtet. Zur Einordnung dieser Vorgänge ist es darüber hinaus notwendig, etwas breiter die politischen Interessen der Großindustriellen zu thematisieren. Dies erscheint auch deshalb geboten, weil es eine breite und kontroverse Diskussion in der Geschichts- wissenschaft über den Anteil der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen an der Machtergrei- fung Hitlers gab. Besonders kontrovers wurde über den „Anteil der deutschen Industrie an der Zerstörung der Weimarer Republik“ diskutiert.7 Diese Debatten fanden hauptsächlich zwischen marxistischen und nicht-marxistischen Historikern statt. Diese Kontroverse, die von marxistischer Seite von der Theorie des „Staatsmonopolistischen Kapitalismus“ aus- ging, welche die Annahme einer Verschmelzung der kapitalistischen Monopole mit dem Staat machte,8 und sich über die berühmte Aussage Horkheimers, wer vom Faschismus rede, dürfe vom Kapitalismus nicht schweigen, fortsetzte, kann hier nicht rekonstruiert werden.9
Als Ergebnis dieser Debatten läßt sich zur Rolle der Industrie bei der Auflösung der Weimarer Republik allerdings folgendes festhalten: Die meisten Historiker gehen davon aus, daß bei den einflußreichen Teilen der industriellen Eliten schon längere Zeit vor dem politischen Durchbruch der NSDAP die Bereitschaft bestand, die Weimarer Republik zu- gunsten einer autoritären Lösung fallenzulassen, von der vor allem die Unterdrückung der Arbeiterschaft erwartet wurde. Weiterhin nahm während der Weltwirtschaftskrise selbst bei den industriellen Eliten, die den Nazis anfangs eher skeptisch gegenüber standen, die Bereitschaft zu, eine Regierungsbeteiligung der Nationalsozialisten zu akzeptieren, um einen politischen Rahmen zu erhalten, in dem sich die Wirtschaft erholen könnte.10
Um die Entwicklung des Wirtschaftsprogramms der NSDAP unter den skizzierten Ge- sichtspunkten darzustellen, wird zuerst das Parteiprogramm von 1920 (Kapitel 2) themati- siert. Daran anschließend wird der Programmentwurf von Georg Strasser von 1926 be- trachtet, der einen Höhepunkt der innerparteilichen Richtungsstreitigkeiten markiert (Kapi- tel 3). Als einen ersten Annäherungsversuch Hitlers an die Industrie wird danach die be- reits erwähnte Schrift „Der Weg zum Wiederaufstieg“ diskutiert (Kapitel 4). Dann wird die Annäherung der NSDAP an die Großindustriellen dargestellt und in diesem Kontext wer- den auch das „Sofortprogramm“ und das „Aufbauprogramm“ thematisiert (Kapitel 5). Ab- schließend werden die wichtigsten Ergebnisse in einem Fazit zusammengefaßt (Kapitel 6).
Diese Arbeit stützt sich, was die wirtschaftspolitischen Vorstellungen des Nationalso- zialismus angeht, in weiten Teilen auf die Untersuchung von Barkai zum Wirtschaftssys- tem des Nationalsozialismus.11 Zu der Frage des Verhältnisses von NSDAP und Industrie wurden hauptsächlich die Monographien von Neebe und Turner herangezogen.12 Weiter- hin wurden einige Quellen, die pointierte Aussagen zu den wirtschaftspolitischen Vorstel- lungen der Nationalsozialisten enthalten, aus dem breiten Fundus zum Thema herangezo- gen.13 Hinzukommen eine Reihe von Aufsätzen, die hier nicht im einzelnen vorgestellt werden müssen.
Parteiprogramm von 1920
2. Das Parteiprogramm von 1920
Das Parteiprogramm, das sich die NSDAP in ihrer Frühphase 1920 gegeben hat, wurde nie mehr geändert. Es stellte eine Ansammlung von allgemeinen Parolen dar, die wenig geeig- net waren daraus konkrete politische Entscheidungsprogramme zu einer Politikgestaltung abzuleiten. Gleicher Art waren die in dem Programm enthaltenen wirtschaftspolitischen Forderungen. Sie waren teilweise von einer „sozialistischen“ Tendenz angehaucht, die aber in den Forderungen, die den Mittelstand ansprechen sollten, ihre Grenzen fanden.14
Die wirtschaftlichen Forderungen des Programms sind von Gottfried Feder formuliert, der in den Anfangsjahren der Partei als der maßgebliche Programmatiker der Partei galt und die Wirtschaftsauffassungen der Partei maßgeblich beeinflußt hat.15 Feder war 1918 erstmals öffentlich aufgetreten. Sein „Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft“ hatte er im November 1918 der Münchner Revolutionsregierung Kurt Eiseners unterbreitet. Im September 1919 war er der NSDAP beigetreten. Hitler war von dem Konzept Feders, nachdem er zum ersten mal eine Rede von Feder gehört hatte, wegen der propagandisti- schen Brauchbarkeit begeistert.
Feder unterschied zwischen „schaffendem Industriekapital“ und „raffendem Finanzkapital“ - die Nähe zum Stereotyp des „raffenden Juden“ und damit der antisemitische Gehalt dieser Unterscheidung ist augenfällig. Mit dieser Unterscheidung konnte sich die NSDAP zugleich „antikapitalistisch“ geben und gegen den Börsenhandel polemisieren, ohne die vermeintlich „schaffende nationale“ Industrie zu sehr zu verschrecken. Mit dem Ziel, die Arbeiterschaft zu gewinnen, wurde nicht dem „Kapital“ insgesamt der Kampf angesagt, sondern nur eben dem „internationalen Finanzkapital“.16
In Punkt 11 des Programms taucht dann auch die „Brechung der Zinsknechtschaft“ als Forderung auf. Es wird eine „Abschaffung des arbeits- und mühelosen Einkommens“ ge- fordert. Weiterhin wird in Punkt 3 „Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung unseres Volkes und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses“ gefordert. Im Hintergrund dieser Forderung steht der Autarkiegedanke, nach dem Deutschland unabhängig von der Weltwirtschaft werden und seine Selbstversorgung über Expansion in den Osten sichern sollte. Neben Antisemitismus, Sozialdarwinismus und Antiliberalismus bildet das Autar-kiekonzept eine Konstante auch in Hitlers politischer Auffassung.17 Aus diesem Konzept ergab sich auch in Hitlers Vorstellungen eine Bevorzugung der Landwirtschaft, um die Versorgung des „deutschen Volkes“ unabhängig von Importen sicher zu stellen.
Einige Forderungen sind eindeutig auf die damaligen Nachkriegszustände bezogen, wie die Forderung nach Einziehung der Kriegsgewinne in Punkt 12 und die Forderung der Todesstrafe für „Wucherer und Schieber“ in Punkt 18.18 „Sozialistische“ Tendenzen finden sich in den Forderungen nach der „Schaffung eines Gesetzes zur unentgeltlichen Enteig- nung von Boden für gemeinnützige Zwecke“ in Punkt 17 sowie der Forderung nach Ge- winnbeteiligung an Großbetrieben in Punkt 14. Insgesamt wurde die liberal-kapitalistische Wirtschaftsordnung kritisiert und ihre Ersetzung durch eine kollektivistische, arbeitsbeton- te Ordnung propagiert, die sich am Interesse der „Volksmassen“ orientiert. Dies wird in der Parole „Gemeinnutz vor Eigennutz“ in der Zusammenfassung am Ende des Programms auf den Punkt gebracht.19
Die Forderung nach der Verstaatlichung der bereits vergesellschafteten Betriebe in Punkt 13 war wohl eher eine Konzession an den revolutionären Zeitgeist als Ausdruck der politischen Zielsetzung, eine staatssozialistische Ordnung zu schaffen. Dies hätte auch den Überzeugungen des Hauptklientel der NSDAP, zu dieser Zeit der kleine Mittelstand, wi- dersprochen. Die Bindung an diese Gruppe wird in der Forderung nach „Schaffung eines gesunden Mittelstandes“ und „sofortiger Kommunalisierung der Groß-Warenhäuser und ihrer Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende“ in Punkt 16 deutlich.20
Das Konzept der „Brechung der Zinsknechtschaft“ hielt sich hartnäckig in der Partei- propaganda, wurde aber immer mehr abgeschwächt und nur als politisches Fernziel darge- stellt, genau wie Feder im weiteren Verlauf der Entwicklung der Partei immer mehr am Rand stand.21 Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der NSDAP waren sehr allgemein und diffus. Die einzelnen Forderungen müssen als Versuch gesehen werden, den beiden Zielgruppen, Arbeiterschaft und bürgerlicher Mittelstand, die die Partei als Wähler anspre- chen wollte, gerecht zu werden. Diese Ambivalenz setzte sich in der weiteren Entwicklung der Partei fort. Allerdings wird schon hier eine Konstante der politischen Überzeugungen der Partei deutlich: Der radikale Antiliberalismus. Eine pluralistische Gesellschaft, in der der Wirtschaft freiem Lauf gelassen wird, wurde von der NSDAP entschieden abgelehnt. Alle gesellschaftlichen Bereiche, auch die Wirtschaft, sollten sich dem Interesse der Allgemeinheit unterordnen. Was die Interessen der Allgemeinheit sind, das wollte die NSDAP an der Spitze des Staates, also nach der Machtergreifung, festlegen.22
3. Der Parteiprogrammentwurf Strassers von 1926
Während die NSDAP sich nach der Aufhebung ihres Verbots 1925 neu konstituierte, verlagerte sich ihr Schwergewicht, in bezug auf ihre Mitgliederanzahl, von München weg in den Norden und Westen. Ein großer Teil der völkischen Bewegung im Reich hatte sich der NSDAP angeschlossen, während der alte Münchner Parteikern stagnierte.23 Hitler hatte schon im süddeutschen Raum Probleme sich durchzusetzen, so daß Gregor Strasser der Aufbau der norddeutschen Parteiorganisation am 11. März 1925 übertragen wurde. Schon vorher hatte er hier für den Nationalsozialismus geworben und versucht, zu einem Zusammenschluß aller Rechtsverbände zu kommen.24
Die neuen Parteigaue beanspruchten von Anfang an eine gewisse Selbständigkeit ge- genüber der Zentrale in München. Außerdem sahen sie die Notwendigkeit, einen strafferen Parteiapparat zu schaffen, da sie sich in ihren Regionen den geschlossenen Organisationen der SPD und KPD gegenübersahen. Hier war mit reinen Parolen keine weitere Mobilisie- rung zu erreichen, sondern die regionalen Parteiführer waren der Ansicht, daß nur mit in- haltlich fundierter Politik, die auch zur Lösung der sozialen Frage Stellung nahm, Zustim- mung zu gewinnen war. Vor allem da man hoffte bei den Arbeitern mehr Zustimmung zu erreichen.25 Daher wurde am 10. September 1925 die „Arbeitsgemeinschaft der nord- und westdeutschen Gaue“ gebildet, bei der es um die Vereinheitlichung der Organisation, der Propaganda sowie im Bedarfsfall der Stellungnahmen zu tagespolitischen Themen ging.26
Gregor Strasser, sein Bruder Otto, Goebbels und andere in der „Arbeitsgemeinschaft“ waren der Meinung, daß die Parteileitung in München sich immer mehr vom „antikapita- listischen“ Kurs des Parteiprogramms wegbewege, es aber für einen Zustimmungsgewinn in der Arbeiterschaft nötig sei, den politischen Kurs der Partei so zu ändern, daß die Stoß- richtung primär gegen die etwas gemäßigteren rechten Kräfte der DNVP, des Reichsland- bund und Stahlhelms ginge und die Partei sich klar vom kapitalistischen System distanziere.27 Dies sollte mit einer Konkretisierung der 25 Punkte des Parteiprogramms geschehen, die die Partei auf diese Linie festlegen sollte.28
Gregor Strasser stellte auf einer Tagung der „Arbeitsgemeinschaft“ seinen Programm- entwurf vor. Durch eine Indiskretion erfuhr die Parteileitung in München davon und zeigte sich nicht begeistert über so viel Eigenmächtigkeit. Auf die nächste Tagung der „Arbeits- gemeinschaft“ wurde Gottfried Feder entsandt, dem aber weder Stimm- noch Rederecht eingeräumt wurde. Bei dieser Tagung wurde das Programm von Strasser diskutiert und als Grundlage für ein Aktionsprogramm anerkannt.29 Für die Entwicklung der NS- Wirtschaftsauffassung ist dieser Entwurf interessant, weil er zeigt, was die „linken“ Natio- nalsozialisten unter „Sozialismus“ verstanden. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß die Agitation des „linken“ Flügels, mit ihren Hauptvertreter Otto Strasser, radikalere antikapitalistische Töne anschlug, als letztlich der Entwurf Strassers. Er war sich wohl bewußt, daß er sich nicht zu weit vom Boden des für unabänderlich erklärten Parteipro- gramms entfernen konnte.30 Im folgenden soll nun der Entwurf Strassers, der in der Form von Stichpunkten zu seiner Rede vor der „Arbeitsgemeinschaft“ überliefert ist, vorgestellt werden.31
Am Anfang des Programms wird der „nationale Sozialismus“ als eine Synthese aus „staatenbildendem Nationalismus“ und „Ernährung und Gedeihen des einzelnen gewähr- leistendem Sozialismus“ definiert (I. b). Mit dieser Formulierung sollte zum Ausdruck gebracht werden, daß der Nationalismus nur ein näheres Kennzeichen der Hauptsache, des Sozialismus, war. Der darauf folgende außenpolitische Teil zeigt sich weitaus gemäßigter als die weitgehenden Hegemonialpläne Hitlers (II.).32 Mit der Forderung nach einer Aus- weitung der Befugnisse des Reichspräsidenten (III. A. 1a) und der Skizzierung eines be- rufsständischen Staatsaufbaus, bei dem eine „Reichsständekammer“ das Parlament und die politischen Parteien ersetzen sollte (III. A. 1d), befand man sich im Einklang mit den kon- servativen Kreisen im Reich. Besonders die Forderung nach einer „Reichsständekammer“berührte sich mit der Ständelehre Otto Spanns, die auch beim gewerblichen Mittelstand eine gewisse Popularität besaß.33
Erstaunlich detailliert, angesichts der Tatsache, daß die nationalsozialistische Propa- ganda zu dieser Zeit außer Kritik an den Reparationen in Wirtschaftsfragen nichts zu bie- ten hatte, wird das Bild einer neuen Wirtschaftsordnung für Deutschland gezeichnet. Hier wird die Intention der „Arbeitsgemeinschaft“ sehr deutlich, ein Programm zur Wirtschafts- und Sozialpolitik zu liefern, mit dem bei der Arbeiterschaft agitiert werden kann.
Im Agrarbereich sollten über 1000 Morgen große Güter in kleine Bauerngüter zu 50 bis 200 Morgen aufgeteilt werden. Diese neugeschaffenen Bauerngüter sollten nur als Erblehen vom Reich verpachtet werden. Von einer Entschädigung der Besitzer ist nicht die Rede. Die Landarbeiter deutscher Nationalität dieser Güter sollten mit 2 Morgen belehnt werden(IV.A 2 und 3). Diese Reform wäre eindeutig zu Lasten der Großgrundbesitzer gegangen. Insofern kann man hier ein sozialistisches Element sehen. Nun sollten aber nicht die Landarbeiter besser gestellt werden, sondern mittlere Bauerngüter sollten verstärkt geschaffen werden. Hier wird also eher auf die Vorteile der kleinbürgerlichen Schichten geachtet.34 Um die ständige Verschuldung der Kleinbauern zu bekämpfen, sollte die Beleihung der vom Reich verpachteten Erbhöfe verboten werden.
Auch in der Industriepolitik folgte das Programm einem halbherzigen Sozialismus. Sämtliche Betriebe mit über 20 Angestellten sollten in Aktiengesellschaften umgewandelt werden (IV. B 1.). Sie sollten durch Umverteilung des Aktienbesitzes „in den Besitz der Allgemeinheit“ gebracht werden (IV. B 3.). Auch hier blieb der kleine Mittelstand und damit die kleinbürgerliche Schicht verschont. Die Überführung in den „Besitz der Allge- meinheit“ sollte so geschehen, daß die Betriebe in zwei Gruppen aufgeteilt würden, einmal in die „Schlüsselindustrien“ (Rüstungsindustrien, Banken, chemische und elektrische In- dustrie) und die „nicht lebenswichtigen Industrien“ (Weiterverarbeitungsindustrien, Ex- portindustrie und alle anderen) (IV B 2.). 51% der Aktien der Betriebe der „lebenswichti- gen Industrien“ sollten derart verteilt werden, daß 30% das Reich, 10% die Belegschaft sowie zusammen 11% Landschaft und Gemeinde erhalten würden. Von den Aktien der Betriebe der anderen Kategorie sollten 49% nach dem gleichen Schlüssel verteilt werden, wobei Landschaft und Gemeinde zusammen dann nur 9 % bekämen. Die Leitung der Be- triebe sollte in privatwirtschaftlicher Hand bleiben. Mit dieser Konstruktion wäre nur eine sehr beschränkte Kontrolle des Staates zu erreichen gewesen. Die durch die Aktienvertei- lung sich ergebende Stimmenmehrheit im Aufsichtsrat wäre selbst bei den „lebenswichti- gen Industrien“ nur bei Einigkeit aller Gruppen, also auch der Arbeiter, möglich gewesen. Man kann also nicht von staatssozialistischen Plänen reden, geschweige denn von „Ver- gemeinschaftung“, denn den Arbeitern wurden ja nur 10% der Aktien zugestanden.
In der Handels- und Gewerbepolitik gab es einen Punkt, der wiederum Forderungen aus dem Kleinbürgertum gerecht wurde. Die Betriebe mit unter 20 Beschäftigten sollten in Zwangsinnungen zusammengefaßt werden (IV C 1.), was eine Rückkehr zu alten Kon- troll- aber auch Bestandsschutzverhältnissen bedeutet hätte. Daran anschließend wird noch einmal der anvisierte ständische Aufbau der Wirtschaft genauer dargestellt. Bei dem Punkt der Güterverteilung ist noch bemerkenswert, daß das Reichswirtschaftsministerium gleich- artige Werke zu Kartellen zusammenschließen und die Produktion der Werke überwachen sollte, damit es eventuell unrentable Betrieben schließen könnte (IV F 2.).
Betrachtet man Strassers Programmentwurf insgesamt, hat er mit klassischen Zielen des „Sozialismus“ wie sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit wenig gemeinsam. Genau so wenig ist die Zielvorstellung der Besserstellung der Arbeiterschaft zu finden. Was hier projektiert wurde, ist, die liberale Wirtschaftsordnung einzugrenzen und vor allem die kleinbürgerlichen Schichten vor der Konkurrenz der großen Industriebetriebe zu schützen. Dies entsprach vor allem den Forderungen des gewerblichen Mittelstandes, die durch ihre Interessenverbände konstant in der Weimarer Republik Schutz vor den sozialen Folgen der Wettbewerbswirtschaft forderte und die politischen Kräfte unterstütze, die ihnen dies ver- sprach.35 Auch die neokonservativen Ideen zu einem berufständischen Staats- und Wirt- schaftsaufbau waren wenig mit den modernen industriellen Produktionsverhältnissen vereinbar.36
Hitler konnte und wollte das eigenmächtige Handeln Strassers und der nordwestdeut- schen Gruppe nicht dulden. Er wollte seinen unbeschränkten Führungsanspruch verteidi- gen und das Bild einer geschlossenen Bewegung aufrecht erhalten. Da paßten programma- tische Streitigkeiten innerhalb der Partei nicht ins Bild. Deswegen berief er eine Führertagung in Bamberg am 14. Februar 1926 ein.37 Wie üblich rief er hier zu Einigkeit auf, unter- ließ persönliche Angriffe, sprach seinen Gegnern sein Vertrauen aus und appelierte an die unbedingte Loyalität gegenüber ihm selbst. So brach er die Spitze der innerparteilichen Opposition gegen ihn, und diese mußte eine Niederlage einstecken.38 Gregor Strasser - von seinen Parteigängern allein gelassen - mußte dafür sorgen, daß die Entwürfe, die er verschickt hatte, ihm zurückgesendet wurden.39 Goebbels wechselte nach der Bamberger Tagung bald zu Hitler über. Der „linke Flügel“ in der NSDAP war aber damit noch kei- neswegs geschlagen. Der parteiinterne Kampf zwischen „linkem“ Strasser-Flügel und „kapitalistischem“ Hitler Flügel dauerte weiterhin an. Er fand erst mit dem Austritt der Gruppe um Otto Strasser im Sommer 193040 und dem Rücktritt Gregor Strassers von sei- nen Parteiämtern 1932 ein Ende.41
Insgesamt wird an diesen Vorgängen deutlich, daß über die politischen Zielsetzungen innerhalb der NSDAP keineswegs Einigkeit herrschte und daß Hitler nicht bereit war, sich auf eine konkrete Linie festzulegen und voll und ganz auf eine „antikapitalistische“ Linie einzuschwenken. Zwar sollten Teile der Arbeiterschaft gewonnen werden, um eine Massenbasis zu erreichen, aber ohne die Unterstützung der bürgerlichen Konservativen zu verlieren. Ein Versuch, die NSDAP in diesen Kreisen, insbesondere der Industrie, hoffähig zu machen, soll im nächsten Abschnitt betrachtet werden.
4. Die Denkschrift: „Der Weg zum Wiederaufstieg“ von 1927
Die Initiative zu einem Annäherungsversuch ging von einem Vertreter der Großindustrie aus. Wie in der Einleitung bereits erwähnt, hatte Emil Kirdorf Hitler um eine schriftliche Niederlegung seiner politischen Vorstellungen gebeten. Die Denkschrift ist in gedruckter Form erschienen, kam aber nie in den öffentlichen Handel, da sie exklusiv für Deutsch- lands führende Industrielle bestimmt war.42 Diese Broschüre war also dazu da, die Großun- ternehmer über die politischen Zielsetzungen der NSDAP, wie Hitler sie sah, zu informie- ren. Entgegen seiner Gewohnheit nahm Hitler in dieser Schrift auch zu Wirtschaftsfragen Stellung, was wohl daran lag, daß er den Adressaten auch auf diesem Gebiet Sachkenntnis zu beweisen suchte.43 Daher ist es lohnenswert, die Schrift näher zu betrachten.44
Im Jahr 1927 war die wirtschaftliche Situation in Deutschland einigermaßen positiv. Nach einem konjunkturellen Rückschlag 1925/26 mit hoher Arbeitslosigkeit befand sich Deutschland in einer zweiten Aufschwungphase, deren Höhepunkt 1928 erreicht wurde. Dieser Aufschwung wurde stark durch hohe Auslandkredite finanziert, die für ein hohes Vertrauen der internationalen Geldgeber in Deutschlands wirtschaftliche Zukunft spre- chen.45 Mit einer „Analyse“ dieser im allgemeinen positiv bewerteten Situation beginnt Hitler seine Ausführungen. Hitler führt aus, daß die Situation nur scheinbar positiv sei und von einer „echten“ Erholung Deutschlands überhaupt nicht die Rede sein könne. Auch auf dem Gebiet der Wirtschaft könne man nicht von einer Erholung sprechen. Anschließend zählt er die Zeichen für die anhaltende Krise der Wirtschaft auf: Die Handelsbilanz sei ständig passiv, die steigende Produktion sei durch Auslandsschulden finanziert und würde die Verschuldung erhöhen. Außerdem würde die steigende Produktion nur in die Hände des „unpersönlichen Finanzkapitals“ fallen, wobei kleine und mittlere Betriebe „zugrunde gehen“.46 Die Arbeitslosigkeit sei ein anhaltendes Problem, und die Verschuldung der Landwirtschaft würde zunehmen. Hitler sieht daher eher Anzeichen für einen Verfall der Wirtschaft. Einmal würde die „nationale Wirtschaft“ ihre Unabhängigkeit an „internationale Finanzkräfte“ verlieren und zweitens sei die „allgemeine Arbeitslosigkeit“ ein ungelöstes Problem.
Schon an diesen Ausführungen wird deutlich, daß Hitler versucht, seinen Adressaten gerecht zu werden, indem er angebliche wirtschaftliche Probleme direkt anspricht. Richtig lag Hitler mit seiner Diagnose, daß das Problem der Arbeitslosigkeit nicht gelöst war, trotz der Stabilisierung der Wirtschaft blieb sie auf deutlich höherem Niveau als vor dem 1. Weltkrieg.47 Auch, daß die Stabilisierung der deutschen Wirtschaft stark durch die Auf- nahme von Krediten finanziert wurde, war zutreffend. Vor allem die öffentlichen Haushal- te konnten nur durch die Aufnahme kurzfristiger Kredite im Ausland finanziert werden.48 Allerdings waren diese Punkte zur damaligen Zeit auch keine Geheimnisse.
Wichtig ist, worin Hitler bei diesen Punkten das Problem sieht. Bei den Arbeitslosen äußert er die Befürchtung, daß diese von der Arbeit „entwöhnt“ werden und Unterstützung auf Kosten der „Allgemeinheit“ beanspruchen und damit Deutschland insgesamt schwä- chen. Da für Hitler das deutsche „Volk“ aber nun einmal stark sein muß, um sich im „Kampf“ gegen andere „Völker“ durchzusetzen, ist dies eine Schwächung, die nicht er- wünscht ist. Bei der Kreditfinanzierung sieht Hitler den kritischen Punkt darin, daß es aus- ländische Kredite sind und die deutsche Wirtschaft damit ihre Unabhängigkeit verliere. Das Konzept der Autarkie steht hier im Hintergrund. Hinter dem Begriff des „unpersönli- chen Finanzkapitals“ steht die Unterscheidung vom „raffenden Finanzkapital“ und der Werte schaffenden nationalen Industrie. Bei der „Analyse“ der wirtschaftlichen Probleme Deutschlands bleiben also doch die ideologischen Visionen Hitlers der Fluchtpunkt der Argumentation. Ziel ist es, Deutschland stark zu machen, damit es den Kampf mit den an- deren Nationen der Welt aufnehmen kann. Konkrete wirtschaftspolitische Lösungsvor- schläge für die Probleme präsentiert Hitler nicht.
Daran anschließend widmet sich Hitler der „allgemeinen politischen Entwicklung un- seres Volkes“.49 Bemerkenswert an diesen Ausführungen ist, daß Hitler seine Bewegung als einzig geeignet darstellt, den „Marxismus“ zu bekämpfen. Damit meint Hitler nicht nur die KPD, sondern auch die organisierte Arbeiterschaft und das parlamentarische System. Deutschland sei geteilt in zwei Lager, den marxistischen und den nicht-marxistischen Block.50 Diese Teilung verhindere einen „Wiederaufstieg“ Deutschlands. Die NSDAP als Bewegung könne diese beiden Lager unter dem Dach des Nationalismus wieder vereinen. Dafür müßten aber an die berechtigten Ansprüche der Arbeiterschaft Konzessionen gemacht werden.51 Mit der in der Einleitung zitierten Äußerung gesteht er zwar der Wirtschaft ihre Selbständigkeit zu, aber betont, daß sie sich dem Primat der Nation unterzuordnen habe. Weiterhin ergeht sich Hitler in Ausführungen über den „rassischen Wert“ des deutschen „Volkes“, die hier nicht weiter von Belang sind.52
Es ist schwierig abzuschätzen, wie diese Schrift bei den Großindustriellen aufgenom- men worden ist. Hitlers Formulierung „unabhängige nationale Wirtschaft“ konnte als Zu- sage verstanden werden, daß die Nationalsozialisten den privaten Besitz an den Produkti- onsmitteln nicht in Frage stellen würden.53 Diese Frage war ein Hauptpunkt, der auch bei den mit Hitler sympathisierenden Industriellen für Mißtrauen sorgte. Sie waren nicht si- cher, ob die NSDAP wirklich das Privateigentum in der Wirtschaft unangetastet lassen würden, vor allem wegen der Agitation des „linken Flügels“ der NSDAP.54 Auf Zustim- mung dürfte die Ablehnung des parlamentarischen Systems gestoßen sein, da doch einige Großindustrielle dieses System ablehnten.55 Zwar hatte z. B. Carl Duisberg als Vorsitzen- der des Reichsbunds der Deutschen Industrie (RDI) 1925 in einer Rede vor der Mitglie- derversammlung des RDI die Verfassung der Weimarer Republik anerkannt, aber er vertrat damit nicht die Meinung aller Mitglieder des RDI.56 Hitlers Aussage, daß man Konzessio- nen an die Arbeiterschaft machen müsse, dürfte nicht auf ungeteilte Zustimmung gestoßen sein. Obwohl das Ziel solcher Konzessionen, nämlich die Arbeiter von den Gewerkschaf- ten zu lösen, bei vielen Industriellen Anklang gefunden haben dürfte.
Insgesamt standen die meisten Großindustriellen 1927 der NSDAP und Hitler noch skeptisch gegenüber, wobei das unklare Verhältnis der NSDAP zum „Sozialismus“ das Hauptproblem blieb. Was die wirtschaftsprogrammatische Entwicklung der NSDAP an- geht, sieht man, daß Hitler keine wirtschaftspolitischen Instrumente anbietet, sondern in seinen ideologisch-politischen Zielsetzungen verhaftet bleibt. Im folgenden werden nun die weiteren Annäherungsversuche der NSDAP an die wirtschaftlichen Interessenverbände, vor allem der Großindustrie, beleuchtet und die wirtschaftspolitischen Äußerungen der Partei damit in Zusammenhang gebracht.
5. Die Annäherung zwischen NSDAP und Großindustrie
Für die weitere Darstellung der wirtschaftsprogrammatischen Entwicklung der NSDAP, in der für die Geschichte des Zerfalls der Weimarer Republik und der „Machtergreifung“ Hitlers entscheidenden Zeit von 1930-33, ist es nötig, folgende Bereiche zu behandeln: Die Arbeit der WPA und die Versuche der Kontaktaufnahme zwischen NSDAP und Wirt- schaftsvertretern, sowie das politische Agieren der großindustriellen Verbände unter den wechselnden Kanzlern. Dieser zweite Bereich wird zuerst behandelt, da er den Hinter- grund für die Annäherung von Großindustrie und NSDAP bzw. Hitler bildet.
Bei diesen Ausführungen bleiben die Landwirtschaft und der Mittelstand und deren In- teressenverbände als weitere Gruppen, deren Unterstützung die NSDAP gewinnen mußte, unberücksichtigt. Einmal, weil dies den Rahmen hier sprengen würde und zum anderen, weil im Agrarbereich die NSDAP mit ihrem Konzept der Autarkie vergleichsweise schnell auf wachsende Zustimmung bei der ländlichen Bevölkerung und den agrarischen Füh- rungseliten stieß,57 und der kleine gewerbliche Mittelstand von Anfang an ein breites Wäh- lerreservoir für die NSDAP bildete.58 Hier zeigten also die Propagierung von Autarkie für die Landwirtschschaft und die antiliberale Rhetorik beim Mittelstand - die seit Beginn der „Bewegung“ zum propagandistischen Inventar der NSDAP gehört hatte - ihre Wirkung und wurden auch in der folgenden Zeit beibehalten. Ein bedeutender Einbruch in die Wäh- lerschaft der KPD und SPD und damit in die Arbeiterschaft gelang der NSDAP nie.59
5.1. Die gro ß industriellen Verb ä nde im Wechsel der Regierungen 1930-1933
Nachdem 1930 die „Große Koalition“ unter Kanzler Hermann Müller (SPD) gescheitert war, und das Kabinett Brüning seine Regierungsgeschäfte aufnahm, begannen die Großin- dustriellen eine Offensivstrategie. Der Einfluß der Unternehmer auf die Politik sollte er- höht werden. Max Schlenker, der Hauptgeschäftsführer des „Verein zur Wahrung der ge- meinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen“ (Langnam-Verein), brachte den politischen Führungsanspruch wie folgt auf den Punkt: „ ...,k ö nnen Wirtschaft und Staat nur dann wieder in geordneten Bahnen wirken und arbeiten, wenn der deutsche Unternehmer ... nunmehr auch politisch in die Bresche springt und sich den ihm geb ü h renden Platz am Steuer des Staates sichert.“60
Die Unternehmer waren von Anfang der Weimarer Republik an dem parlamentari- schen System gegenüber skeptisch eingestellt. Sie bekämpften die aktive Wirtschafts- und Sozialpolitik des Staates sowie die Anerkennung der Gewerkschaften.61 Der RDI präferier- te zur Erreichung dieses Ziels einen moderaten Kurs. Einer seiner profiliertesten Vertreter, Paul Silverberg, wollte nach dem Vorbild des 1. Weltkriegs die „Zentralen Arbeitsgemein- schaften“ (ZAG) unter Einbeziehung der SPD und der Gewerkschaften - freilich unter Führung der Unternehmer - neu gründen. Diese sollten sich um die Fragen der Sozialpoli- tik kümmern, sie damit aus der Kompetenz des Staates herausziehen und die Macht der Gewerkschaften durch Einbindung in die ZAG begrenzen. Weiterhin sollten durch Kartelle und Syndikate Fragen der Verteilung von der Wirtschaft autonom geregelt werden. Schwerindustrielle Unternehmer zeigten sich hier radikaler. Sie glaubten, nur durch eine grundlegende Beschränkung der parlamentarischen Souveränität ihr Ziel des Abbaus der Sozialleistungen und der Zurückdrängung der Gewerkschaften zu erreichen.62 Der Kampf gegen die Sozialpolitik wurde so zu einem Kampf gegen das parlamentarische System.
Ein weiterer Dorn im Auge der Schwerindustrie war das staatliche Schlichtungswesen. Wenn sich die Tarifparteien während der Tarifverhandlungen nicht einigen konnten, konn- te der Staat einen Schlichter berufen, dessen Schiedsspruch für beide Seiten verbindlich war. Dies wurde als illegitimer staatlicher Eingriff in die Autonomie der Wirtschaft gese- hen und aufs Schärfste bekämpft, wie der „Aussperrungskampf“ von 1928/1929 zeigt. Nachdem Tarifverhandlungen in der westdeutschen Eisenindustrie gescheitert waren, er- klärte der damalige Reichsarbeitsminister Rudolf Wissel einen staatlichen Schiedsspruch für verbindlich. Die Arbeitgeber erkannten diesen Schlichtungsakt nicht an und sperrten rund 200 000 Arbeiter aus. In der öffentlichen Meinung wurde dieses Verhalten der Indus- triellen kritisiert, und eine Unterstützung der ausgesperrten Arbeiter, die durch die Aus- sperrung in finanzielle Not gerieten, wurde nicht nur von der SPD sondern auch von bür- gerlichen Parteien etwa der DVP befürwortet. Dies mag die Überzeugung der westlichen Schwerindustriellen noch gefestigt haben, daß ihre Forderungen nach Abbau der Sozialleistungen auf parlamentarischen Weg nicht durchsetzbar war.63
Mit dem Kabinett Brüning war ein Ziel vieler Industrieller erreicht, nämlich der Aus- schluß der SPD von der Regierungsbeteiligung. Dadurch, daß das Kabinett Brüning sich auf das Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten, Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung, stützte, war es von der parlamentarischen Legitimation abgehoben und dafür vom persönlichen Vertrauen des Reichspräsidenten abhängig.64 Damit war die Abkehr vom parlamentarischen System eingeleitet, und das Präsidialsystem als Regierungsform wurde installiert. Dies entsprach den Vorstellungen breiter konservativer Kreise, die eine autoritäre Staatsform erreichen wollten.65 So ein System mußte sich letztlich auf die Unterstützung durch die Reichswehr, namentlich in der Person Kurt von Schleicher, und die Wirtschaft stützen. Daher wurden auch die persönlichen und öffentlichen Stellungnahmen von Unternehmern, Agrariern und der industriellen wie landwirtschaftlichen Verbände für die Regierung immer wichtiger. Die Regierung mußte versuchen, diese Gruppen dazu zu bringen, ihre Entscheidungen zu akzeptieren. Andernfalls hätte sie nur noch mit der Durchsetzung durch die Reichswehr drohen können, was weder die Reichswehr noch Hindenburg gebilligt hätten.
Die Großindustriellen waren sich aber zu diesem Zeitpunkt keineswegs über die zu- künftige Art der Regierung einig. Der RDI war durch die Bildung eines „Engeren Präsidi- ums“ organisatorisch gestrafft worden, was die Zusammenarbeit zwischen der Geschäfts- führung und dem Präsidium verbessern sollte. Dieses Präsidium fällte fortan die wichtigs- ten Entscheidungen und hatte weitgehende Richtlinienkompetenz, so daß es die politische Linie des RDI vorgab.66 Im Gegensatz zum Langnam-Verein, der für eine autoritäre Re- gierung Deutschlands war,67 wählte dieses Präsidium eine verfassungspolitisch gemäßigte Richtung. In dem Präsidium waren Vertreter der verarbeitenden Industrie jedoch kein Ver- treter der Schwerindustrie vertreten. Die Industriellen in diesem Gremium waren der Mei- nung, daß das Kabinett Brüning eine parlamentarische Abstützung bräuchte. Die konserva- tiv-autoritäre Kurswende sollte dauerhaft politisch abgesichert werden. Dafür verfolgte man anfangs die Strategie, die bürgerlichen Parteien zu einer „Arbeitsgemeinschaft der Mitte“ zusammenzuschließen und zu einer Unterstützung der Regierung Brünings zu brin- gen. Dies scheiterte aber an Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien.68 In dieser Situation wurde der Zentralarbeitsgemeinschaftsgedanke reaktiviert und Verhandlungen mit den Gewerkschaften geführt, um eine Grundsatzerklärung zu den Prinzipien der Fi- nanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik zu formulieren. Dieses Vorhaben stieß bei einigen Mitgliedern des RDI, wie z.B. bei Fritz Thyssen, der schon länger mit der NSDAP sympa- thisierte, auf Widerstand. Auch der Vorsitzende des „Vereins der Sächsischen Industriel- len“, der eher mittelständische Industrielle vertrat, Wilhelm Wittke, sprach sich gegen Verhandlungen mit den Gewerkschaften aus. Wittke hatte schon 1929 offen für eine Dikta- tur plädiert. Die Verabschiedung der gemeinsamen Resolution scheiterte zwar, aber die Gespräche zwischen den Sozialpartnern rissen nicht ab.69
Vorbereitet durch die Verhandlungen von Industrie und Gewerkschaften favorisierte das Präsidium des RDI jetzt sogar wieder eine „Große Koalition“ unter Beteiligung der SPD an der Regierung. Man hoffte, so die Zustimmung der SPD zu einem Ermächtigungs- gesetz für das Kabinett Brüning zu erreichen. Die SPD sollte die nach Meinung der Indus- triellen unvermeidlichen Einschnitte in der Wirtschafts- und Sozialpolitik - Kürzung der Ausgaben und Erhöhung der Steuern - angesichts des Haushaltsdefizits, das durch die Weltwirtschaftskrise und die damit einhergehende Arbeitslosigkeit immer schwerer zu decken war, mit verantworten und so diese Politik legitimieren.70 Brüning hatte sich aber Hindenburg gegenüber verpflichtet, ohne die SPD zu regieren und konnte daher keine „Große Koalition“ eingehen. Da Brüning für sein Haushaltsgesetz keine Mehrheit im Reichstag finden konnte, brachte er es als präsidiale Notverordnung nach Artikel 48 auf den Weg. Artikel 48 gesteht dem Reichspräsidenten das Recht zu, zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung eigenmächtig Gesetze zu erlassen, wenn das Parlament hand- lungsunfähig ist. Das Parlament war aber nicht handlungsunfähig, sondern hatte nur eine Gesetzesvorlage des Kanzlers abgelehnt. Nachdem der Reichstag mit einer klaren Mehr- heit für die Aufhebung der Notverordnung votiert hatte,71 löste Brüning den Reichstag am 18. Juli 1930 auf, und der Reichspräsident setzte die Notverordnung in Kraft.72 Damit hatte Brüning endgültig den Weg zum Präsidialregime eingeschlagen, was auch eindeutig in seiner politischen Absicht lag.
Die schwerindustriellen Unternehmer begrüßten den Schritt Brünings, der ihren Vorstellungen einer autoritären Regierung ohne parlamentarische Bindung entgegen kam. Während des nun folgenden Wahlkampfs wurde von der Industrie wieder versucht, die bürgerlichen Parteien zu einem Parteienbündnis zusammen zu führen. Dies scheiterte a- bermals. Das „Engere Präsidium“ plädierte während des Wahlkampfs dafür, daß im Reichstag eine arbeitsfähige Mehrheit zustande kommen müsse und zeigte damit, daß man den Willen zum Verfassungsumbau bei Brüning und Hindenburg sowie anderen konservativen Kräften immer noch nicht erkannt hatte.73
Die Weltwirtschaftskrise und ihre Folgen machten sich nun vollends in Deutschland bemerkbar. Das soziale Elend weiter Bevölkerungsteile verschärfte sich, und eine politi- sche Polarisierung griff weiter um sich. Bei den Reichstagswahlen verlor die bürgerliche Mitte weiter an Stimmen, und die NSDAP konnte einen massiven Stimmenzuwachs von 2,6% auf 18,3% verbuchen. Sie war nun zweitstärkste Kraft hinter der SPD im Reichstag. Eine Regierungsbeteiligung kam aber selbst für industrielle Kreise, die eine rechts- konservative Regierungsbildung befürworteten, nicht in Frage. So hielt Jakob Reichert vom Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller (VDEStl) das Programm der NSDAP für „halb sozialistisch“ und „halb nebelhaft“. Weiterhin stünden die Nationalsozialisten in ihrem Radikalismus den Kommunisten in nichts nach. Daher blieb nur der Ausweg einer „Großen Koalition“.74 Auch der RDI betonte die Notwendigkeit einer parlamentarischen Abstützung der Regierung im Reichstag.
Die Vertreter dieser Positionen erkannten nicht, daß Brüning gewillt war, auf Dauer ohne das Parlament zu regieren und damit einen Verfassungswandel zu einem autoritären Regierungssystem langsam herbeizuführen. Auch konnte er, wie schon erwähnt, in keinem Falle die SPD an der Regierung beteiligen, wollte er nicht Hindenburg brüskieren. Für die Reform der Verfassung mußte aber erst die Souveränität Deutschlands wiederhergestellt und ein Ende der Reparationen erreicht werden, da die Siegernationen des 1. Weltkriegs bei einem offenen Verfassungsumbau in autoritäre Richtung wohl keine Kompromißbe- reitschaft mehr bei den Reparationen gezeigt und einer weitergehenden Souveränität Deutschlands nicht zugestimmt hätten.75 Daher mußte Brüning für seine Notverordnungen die Tolerierung bei den Parteien des Reichstags suchen. Da sich NSDAP, DNVP und KPD nicht zu einer Tolerierung bereit fanden, mußte Brüning doch auf die Zustimmung der SPD setzen und erlangte diese.76
Nicht zuletzt die Tolerierung des Kabinetts Brüning durch die SPD bewirkte, daß Teile der Industriellen die Linie des RDI, die Unterstützung Brünings, kritisierten. Fritz Thyssen
z. B. forderte Brüning auf, die NSDAP an der Regierung zu beteiligen.77 Der „Bergbauli- che Verein“ drohte Ende 1930 gar mit dem Austritt aus dem RDI. Er forderte eine soforti- ge Aufkündigung der Reparationen seitens Deutschlands und mittels der Regierungsbetei- ligung der NSDAP einen schnelleren Verfassungsumbau. Dies wurde nicht zuletzt von der „Ruhrlade“ verhindert. Diese Vereinigung von zwölf führenden Industriellen des rhei- nisch-westfälischen Industriegebiets war gegründet worden, um eine Koordinierung der beiden voneinander abhängigen Wirtschaftszweige Kohle- und Stahlindustrie zu errei- chen, aber auch um die politischen Interessen abzugleichen und gemeinsam vorzugehen.78 Fritz Thyssen war auch Mitglied in der „Ruhrlade“ und wurde in der Sitzung überstimmt, in der beschlossen wurde, eine einheitliche Industrievertretung mittels eines Verbandes zu erhalten.79 Trotzdem wurde eine Polarisierung innerhalb des Lagers der Industriellen im- mer deutlicher. Auf der einen Seite stand die durch „Bergbau Verein“ und VDEStl vertre- tene Kohle- und Eisenindustrie, die eine Regierungsbeteiligung der „nationalen Oppositi- on“ (NSDAP und DNVP) sowie einen schnelleren Verfassungsumbau und ein Ende der Reparationen forderte. Auf der anderen Seite stand die verarbeitende exportorientierte In- dustrie, die die Spitze des RDI dominierte und Brüning stütze sowie für eine parlamentari- sche Abstützung von dessen Regierung, zur Not auch mit der SPD, warb.80
Diese Polarisierung der Industriellen setzte sich weiter fort. Der Langnam-Verein schlug nun einen stärkeren Rechtskurs ein und forderte die „Errichtung einer nationalen Volksgemeinschaft“ und die „Beseitigung der Nebenregierung der Gewerkschaften und der Parteiauswüchse“.81 Durch das „Hoover-Moratorium“, das die einjährige Aussetzung der Reparationen bedeutete, wurde Brünings Position allerdings gestärkt. Seine Politik des schrittweisen Abbaus der Reparationen schien aufzugehen, so daß auch die radikaleren Kräfte innerhalb der Industrie erst einmal eine neutrale Position zu Brüning einnahmen.82
Dieser Burgfrieden hielt allerdings nicht lange. Die rechten Industriellen wollten end- lich eine Regierung der „nationalen Opposition“ sehen. So stellten die rheinisch- westfälischen Schwerindustriellen des „Bergbau-Vereins“ der DVP ein Ultimatum. Bei den am 13. Oktober beginnenden Reichstagsverhandlungen sollten sie in Opposition zur Regierung gehen und sich an einem Mißtrauensvotum gegen die Regierung beteiligen. Im anderen Fall würde ihre Gruppe sofort aus der Partei austreten.83 Auf der Harzburger Ver- sammlung, auf der ein Bündnis der „nationalen Opposition“ vor allem aus DNVP und NSDAP geschmiedet werden sollte, um die Regierung zu übernehmen, waren die Spit- zenmänner der Deutschen Industrie nicht vertreten. Nur der Langnam-Verein und der Ar- beitgeberverband Nord-West entsendete Vertreter. Offenbar waren die meisten Industriel- len zu einer derart offenen Opposition zur Regierung nicht bereit.84 Die Tage der Regie- rung Brüning waren allerdings etwas später im April 1932 gezählt. Da sich ein Erfolg Brü- nings bei der Revision der Reparationen zeigte, hatte er seine Schuldigkeit getan. Er hatte es nicht geschafft, wie Hindenburg versprochen, sein Kabinett nach rechts auszubauen und mußte sich immer noch auf die Tolerierung der SPD stützen.85 Es schien die Zeit für eine neue Regierung gekommen, die unbelastet von der Notwendigkeit wegen der Reparationen Kompromisse machen zu müssen, die autoritäre Umbildung der Reichsverfassung vorantreiben konnte. Als äußerer Anlaß genügte der Vorwurf des „Agrarbolschewismus“ durch den Reichslandbund an Brüning, als Reaktion auf dessen Pläne nicht mehr entschuldungsfähige Höfe, als Siedlungsland für Arbeitslose zu nutzen.
Das neue Kabinett unter Franz von Papen zeigte sofort seine anti-parlamentarische Ausrichtung, indem es den Reichstag auflöste und seine Regierungserklärung am 4. Juni 1932 in der Presse veröffentlichte.86 Der RDI forderte in einer Eingabe an Papen die Auf- hebung des Tarifsystems, weitere Einsparungen bei den Sozialleistungen, Steuersenkungen für die Wirtschaft und Kürzungen der Arbeitslosenunterstützung.87 Diesen Forderungen trug Papen mit seiner ersten Notverordnung vom 14. Juni 1932 Rechnung. In ihr wurde der Konfrontationskurs gegenüber den Gewerkschaften und die Ausrichtung auf die Interessen der Großindustrie unmißverständlich deutlich. Die Arbeitslosenunterstützung und die So- zialleistungen wurden abermals deutlich gesenkt. Außerdem wurde eine Hilfsbedürftigkeitsprüfung für Arbeitslose eingeführt.88 In einer späteren Verordnung vom 5. September 1932 wurde das Tarifsystem angegriffen, indem den Arbeitgebern das Recht zugestanden wurde, die Tariflöhne in ihrem Betrieb für die 31. bis 40. Wochenarbeitsstunde bis zu 50% zu unterschreiten, wenn sie die Beschäftigtenanzahl um bis zu 25% anheben. Weiterhin durfte ein Arbeitgeber die Tariflöhne um 20% unterschreiten, wenn dies eine Weiterführung des Betriebs ermöglicht. Dies ging allerdings nur in Absprache mit dem zuständigen Schlichter.89
Papen versuchte auch vorsichtige Schritte in Richtung von Arbeitsbeschaffungsmaß- nahmen zu gehen. Die Konsolidierungspolitik der öffentlichen Haushalte von Brüning und der Wegfall der Reparationen nach der Konferenz von Lausanne hatten einen schmalen finanziellen Spielraum gebracht.90 An eine direkte Arbeitsbeschaffungspolitik war auf- grund der vorherrschenden Überzeugung von den Selbstheilungskräften der Wirtschaft allerdings nicht zu denken. Direkte Eingriffe des Staates zur Arbeitsbeschaffung wurden als Staatssozialismus gebrandmarkt.91 Ein indirekter Weg war die Einführung der Steuer- gutscheine am 4. September 1932. Für die Zahlung rückständiger Steuern konnten Steuer- gutscheine in der Höhe von 40% des Steueraufkommens der Zahlenden ausgegeben wer- den. Sie konnten ab dem 1. April 1934 zu einem fünftel des Nennwertes für Steuerzahlun- gen verwendet werden. Darüber hinaus konnten auf der Grundlage dieser Scheine Kredite aufgenommen werden. Die Liquidität der Unternehmen sollte damit erhöht werden. Zu- sätzlich wurden Steuergutscheine im Wert von 400 Reichsmark (RM) für die Einstellung von Arbeitslosen ausgegeben.92 Diese Maßnahmen zeigten aber nicht kurzfristige Wirkun- gen, so daß sie nicht zur Stabilisierung der politischen Lage beitragen konnten.93
Diese äußerst industriefreundliche Politik stieß natürlich bei den industriellen Verbän- den auf Zustimmung. Stimmen in der Schwerindustrie, die wegen der fehlenden „Massen- basis“ der Papen-Regierung für eine Hereinnahme der NSDAP in der Person Hitlers in die Regierung plädierten, blieben in der Minderheit.94 Viele der Industriellen, die noch unter Brüning für die Regierungsbeteiligung der NSDAP plädiert hatten, votierten jetzt für Pa- pen, angesichts dessen Pläne die Verfassung der Weimarer Republik im Sinne einer Präsi- dialdiktatur zu ändern und dessen Absicht keine Partei an der Regierung zu beteiligen, auch nicht die NSDAP trotz ihres Wahlsiegs bei den Reichstagswahlen vom 31. Juli 1932, wo sie 37,4% der Stimmen erhielt95 Die NSDAP erschien zu diesem Zeitpunkt immer noch als politisch zu unzuverlässig.96 Ein Punkt wo die Großíndustrie noch Mißtrauen gegen- über Papen hegte, war der Bereich der Agrarpolitik. Sie befürchtete, daß Papen eine vom Reichslandbund geforderte Schließung des Binnenmarkts für landwirtschaftliche Importe vollziehen würde. So eine protektionistische Politik hätte Auswirkungen auf den gesamten Exporthandel gehabt und die Exportchancen für deutsche Waren auf dem Weltmarkt nach- haltig verschlechtert. Dies konnte vor allem nicht im Interesse der verarbeitenden Industrie liegen, die auf den Export angewiesen war. Papen sah, daß eine weitgehende Autarkie für Deutschland wirtschaftlich nicht möglich war und die Industrie gegen ihn aufgebracht hät- te.97 Papen stand hier in einem Zielkonflikt zwischen den Interessen der Agrarier und der Industrie. Der Reichslandbund radikalisierte sich und trat Angesicht seiner nicht erfüllten Forderungen für die NSDAP ein.98
Das Kabinett Papen scheiterte an seiner fehlenden Massenbasis. Auch nach der Wahl vom 6. November 1932 war es nicht möglich Unterstützung für das Kabinett Papen im Reichstag zu gewinnen. Papen wollte trotzdem auf Basis des Artikel 48 weiter regieren, was nur mit einem angeblichen Staatsnotrecht zu begründen war. Er wollte den Reichstag auflösen und die Wahlen um 6 Monate verschieben und die geplante Reichsreform durch- setzen. Es war General von Schleicher, der diese Absichten hintertrieb. Er wies darauf hin, daß die Reichswehr nicht bereit war, ein „Kampfkabinett“ Papens zu stützen, da dieses zu Unruhen führen würde, bei der die Reichswehr gegen große Teile des Volkes stehen wür- de. Damit überzeugte er die Kabinettsmitglieder, die darauf hin nicht bereit waren, für eine Wiederwahl Papens zu stimmen. Die politischen Ziele Schleichers, der nun selbst das Kanzleramt übernahm, waren ganz der Reichswehr verpflichtet, die darin bestanden, die Wiederaufrüstung Deutschlands und damit als Fernziel die deutsche Hegemonie in Mittel- europa zu erreichen. Daher war es für die Reichswehr nicht wünschenswert, in einen inne- ren Konflikt herein gezogen zu werden.99
Zur Erreichung des Ziels, Deutschland militärisch wieder in einer Vormachtstellung in Mitteleuropa zu bringen, war eine leistungsfähige Wirtschaft unabdingbar. Dafür waren für Schleicher auch Eingriffe des Staates in die Wirtschaft ein angemessenes Mittel. Er teilte nicht die wirtschafts-liberalen Vorstellungen vieler seiner Zeitgenossen und sprach sich für neue Wege in der Wirtschaftspolitik aus.100 Er bezeichnete sich weder als „Anhänger des Kapitalismus noch des Sozialismus“.101 Für die Umsetzung solch einer Politik, aber auch grundsätzlich, war es unumgänglich, eine „Massenbasis“ zur Unterstützung seiner Regierung zu finden.102 Dafür schwebte Schleicher das so genannte Konzept der „Quer- front“ vor. Er wollte Gewerkschaften, Teile der SPD und den Strasser-Flügel der NSDAP zu einer Zusammenarbeit bringen. Nicht zuletzt um Sympathien bei den Gewerkschaften zu gewinnen, nahm er die Notverordnungen Papens zum Tarifwesen und der Arbeits- und Sozialpolitik zurück und brachte direkte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf den Weg.103 Auf dem Gebiet der Agrarpolitik wollte er erreichen, daß sanierungsfähige Betriebe schnell mit Staatshilfe saniert werden und nicht sanierungsfähige sollten zur Ansiedlung von Arbeitslosen frei gestellt werden. Damit brachte er den RLB gegen sich auf, der nun noch lauter nach einer Kanzlerschaft Hitlers rief und bei Hindenburg dahingehend Druck machte.104
Bei den Industriellen kam die Zurücknahme der Verordnungen Papens natürlich nicht besonders gut an. Schwerer wog aber für einige Industrielle die sich anbahnende „Repar- lamentarisierung“ durch die Annäherung Schleichers an Gewerkschaften und Parteien. Außerdem zeigte Schleicher keine Neigung, die von Papen projektierte Reichsreform wei- ter zu verfolgen. Wegen dieser Politik vollzog sich unter der Kanzlerschaft Schleichers eine Umorientierung in der Großindustrie. Man stand einer Kanzlerschaft Hitlers jetzt nicht mehr komplett ablehnend gegenüber.105 Allerdings wurde diese Umorientierung nicht einheitlich von der Großindustrie vollzogen. Sie ist weiter unten differenziert darzustellen, und vor allem sind die Annäherungsversuche seitens der NSDAP an die Wirtschaft zu be- rücksichtigen, wie auch das „Sofortprogramm“ und das „Aufbauprogramm“, an denen nicht nur die besagte Annäherung abgelesen werden kann, sondern auch die letzten inner- parteilichen Auseinandersetzungen zwischen Gregor Strasser und Hitler.
Es bleibt an dieser Stelle festzuhalten, daß in der Spätphase der Weimarer Republik das Ziel des Abbaus des Sozialstaats und die Zurückdrängung der Gewerkschaften kon- stante politische Ziele der Industriellen blieben. Diese Ziele schienen unter der Bedingung eines parlamentarischen Systems nicht erreichbar. Daher stand man dem System der Re- gierung mit Präsidialgewalt grundsätzlich positiv gegenüber. Allerdings sah man im „En- geren Präsidium“ des RDI ein, daß eine vollständig von der Bevölkerung losgelöste Regie- rung auf Dauer nicht haltbar war, da dies zu politischen Unruhen geführt hätte. Daher war man bereit, selbst eine Einbindung der SPD in die Regierung zu akzeptieren und verfolgte die gesamte Zeit einen pragmatischen kompromißbereiten Kurs. Die schwerindustriellen Verbände - Langnam, VDESt und Bergbau-Verein - zeigten sich hier unter Brüning radi- kaler und traten für eine mehr oder weniger verdeckte Diktatur ein. Da aber auch sie eine „Massenbasis“ - freilich nicht eine parlamentarische - für eine solche Diktatur für nötig erachteten, traten sie für eine „nationale Opposition“ unter Zusammenschluß von DNVP und NSDAP ein. Auch votierten sie für ein sofortiges Ende der Reparationen und die Wie- derherstellung der Souveränität Deutschlands. Diese Polarisierung innerhalb der Wirtschaft wurde unter Papen, durch dessen autoritäre industriefreundliche Politik, wieder verdeckt. Mit der gewerkschaftsfreundlichen Politik und der unterstellten Tendenz zur „Reparlamentarisierung“ Schleichers brach diese Polarisierung wieder auf, da die politischen Gewinne der Wirtschaft wieder verloren gingen, und Teile der Industriellen begannen Alternativen in Richtung einer Kanzlerschaft Hitlers zu favorisieren.
5.2. Kontaktaufnahmen zwischen NSDAP und Gro ß industrie
Ein erster wichtiger Punkt im Kontext der Annäherung von NSDAP und Großindustrie ist die Erklärung Hitlers zu Punkt 17 des „unabänderlichen“ Parteiprogramms. Wie oben an- geführt, ging es in diesem Punkt um die Enteignung von Boden zu gemeinnützigen Zwe- cken. In dieser Erklärung beteuert Hitler „gegenüber den verlogenen Auslegungen von Seiten unserer Gegner“, daß „die NSDAP auf dem Boden des Privateigentums steht“.106 Nach Wahlerfolgen der NSDAP auf dem Land, wollte man mehr Stimmen bei dieser Wäh- lergruppe erreichen, bei der die Enteignungsforderung des Punkt 17 wahrscheinlich nicht besonders gut ankam. Daher erläutert Hitler in seiner Erklärung, die Enteignungsforde- rung beziehe sich nur auf „jüdische Spekulationsgewinne“.107 Trotzdem blieben die Groß- industriellen skeptisch gegenüber den vermeintlichen sozialistischen Tendenzen der NSDAP.
Eine stärkere Beobachtung des NSDAP-Programms durch die Großindustriellen setzte in der Weltwirtschaftskrise und nach den Reichstagswahlen vom 14. September 1930 ein, da die NSDAP nun offensichtlich eine politische Kraft geworden war mit der man rechnen mußte. Ein Mann aus der Großindustrie, der Kontakte zur NSDAP knüpfte, war August Heinrichsbauer. Er war Herausgeber des „Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsdienstes“, eine Publikation, die von vielen Unternehmern gelesen wurde. Der Schwerindustrie, ge- nauer dem Bergbau, war er eng verbunden, stellte aber nicht ihr Sprachrohr dar. Hein- richsbauer verbreite durch die auf Initiative des Bergbau-Vereins eingerichtete „Wirt- schaftspropagandistische Abteilung“, in der es Arbeitsgebiete wie „Wirtschaftsprogramm der politischen Parteien, insbesondere der nationalsozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands“ gab, mehrere Exposés, in denen er für eine ständisch-faschistische Staatsordnung warb.108
Wie oben schon erwähnt, hatten Ende 1930, Anfang 1931 die schwerindustriellen Gruppen den Plan, daß ein Bündnis der bürgerlichen Rechten mit der NSDAP als „nationa- le Opposition“ den autoritären Verfassungsumbau bewerkstelligen sollte. Da überrascht es nicht, daß Heinrichsbauer „Besprechungen mit Führern der nationalen Opposition“ durch- führte und darüber einen internen Bericht vorlegte. In diesem Bericht stellte er die Auffas- sungen von Goebbels und Gregor Strasser dar. Goebbels erschien als relativ kompromiß- los. Sein Standpunkt war: Wenn die Unternehmer die NSDAP unterstützen, nimmt die NSDAP Rücksicht auf ihre Forderungen. Wenn nicht, dann werde man sie entschieden bekämpfen. Gregor Strasser wurde gemäßigter eingeschätzt als Goebbels. Er betont, daß er das Recht auf Privateigentum unangetastet lassen will, außer es seien Spekulationsgewin- ne. Das Konzept der „Brechung der Zinsknechtschaft“ scheint hier durch. Allerdings sei er gegen die Exportorientierung der Industrie. Ganz im Sinne der Autarkiekonzepts müsse Deutschland von Welthandel unabhängig werden. Insgesamt stellte Heinrichsbauer Stras- ser als kompromißbereiter dar. Zusammenfassend stellte Heinrichsbauer fest, daß mehr Einfluß auf die wirtschaftspolitischen Ziele der NSDAP genommen werden müsse, da sie noch kein brauchbares „politisches und wirtschaftliches Sanierungsprogramm“ habe und sie mehr unterstützt werden müsse, da sie eine Alternative zu den sonstigen bürgerlichen Rechten sei, denen es nicht gelungen sei, das „Weimarer System“ abzuschaffen.109
Von der Seite der NSDAP aus war neben Wilhelm Keppler, von dem weiter unten noch die Rede sein wird, Walther Funk der wichtigste Kontaktmann zu den wichtigen Un- ternehmern der Wirtschaft.110 Funk war ab 1930 wirtschaftspolitischer Berater Hitlers und gehörte dem „Wirtschaftsrat der Parteileitung“ in der Reichsleitung der NSDAP an, der allerdings mehr auf dem Papier existierte, als programmatisch arbeitete.111 Funk verfügte über gute Beziehungen zu führenden Unternehmern und war Mitglied der „Gesellschaft für deutsche Wirtschafts- und Sozialpolitik“, dem viele Prominente aus Politik und Wirtschaft angehörten. Es gelang ihm, einige Unternehmer für die NSDAP zu gewinnen und sie davon zu überzeugen, daß die NSDAP keine antikapitalistische Partei sei.112 Funk verteidigte innerhalb der Partei eher eine wirtschaftsliberale Linie.113
Ein weiterer Schritt in der Annäherung der NSDAP an die Großindustriellen war Hit- lers Rede vor dem Düsseldorfer Industrie-Klub am 26. Januar 1932.114 Hitler sprach hier hauptsächlich vor westdeutschen Schwerindustriellen. In dieser Rede sprach Hitler weni- ger von wirtschaftlichen Problemen, sondern für ihn war die angebliche Aufspaltung der deutschen Bevölkerung in einen „bolschewistischen“ und einen „nationalen“ Block das Hauptproblem. Erst wenn man alle wieder unter dem Dach der Nation versammelt, könne man die Probleme angehen.115 Nicht außenpolitische oder wirtschaftliche Ziele würden das vorrangige Ziel der NSDAP sein, sondern die „Wiederherstellung eines gesunden nationa- len schlagkräftigen Volkskörpers“.116 Diese Rede hatte nicht den Effekt, daß die Industriel- len nun voll hinter der NSDAP standen, aber durch sie wurde die gesellschaftliche Tren- nung zwischen den NSDAP-Funktionären und den Industriellen ein Stück überwunden.117
Ausdruck der Erkenntnis innerhalb der NSDAP, daß man nur die Unterstützung aus Unternehmerkreisen gewinnen konnte, wenn das Parteiprogramm mehr zu bieten hatte als Polemik gegen die Reparationen, war die Gründung der WPA bei der „Organisationsabtei- lung II“ der Münchner Reichsleitung. Die „Organisationsabteilung II“ war auf betreiben Gregor Strassers gegründet worden, um für den Fall der Machtübernahme der Partei orga- nisatorisch gerüstet zu sein.118 Dementsprechend wurde im Januar 1931 die WPA gegrün- det, mit dem Auftrag die wirtschaftspolitischen Ziele der Partei neu zu definieren und praktische Pläne zu deren Verwirklichung auszuarbeiten. Zu ihrem Leiter wurde Otto Wa- gener ernannt, der Mitbesitzer einer Nähmaschinenfabrik war und wirtschaftliche Vorle- sungen gehalten hatte.119 Wagener gehörte innerhalb der Partei zum Strasser-Flügel und vertrat ein Wirtschaftskonzept, das den Konzepten ähnelte, die auch in dem Parteipro- grammentwurf Strassers deutlich wurden.
Im Gegensatz zum „Wirtschaftsrat der Reichsleitung“ war die WPA relativ aktiv. Es fanden wirtschaftliche Besprechungen statt, und es wurde Kontakt mit Hitler und Strasser gehalten. Außerdem stand ein Mitarbeiterstab von zehn Referenten zur Verfügung.120 Al- lerdings verfügte Hitler, daß über alle Besprechungen der WPA an denen Hitler teilnahm, um die projektierte Wirtschaftsordnung zu diskutieren, Stillschweigen bewahrt wurde, um potenzielle Förderer aus der Wirtschaft nicht zu verschrecken. Unter der nationalsozialisti- schen Herrschaft müsse erst eine „junge Generation“ heranwachsen. Die neue Ordnung muß erst „vom ganzen Volk gewollt werden“ und dann sei die Zeit gekommen, das „noch graniten erscheinende Gebäude der kapitalistisch-liberalistischen Fronherrschaft über den Haufen zu werfen“.121 Ganz im Sinne dieses Schweigegebots verhindert Hitler auch die Veröffentlichung eines „Wirtschaftsmanifests“ mit dem Titel: „Wirtschaftspolitische Grundanschauungen und Ziele der NSDAP“. Dieses Papier, von dem ein Entwurf - datiert auf den 5. März 1931 - erhalten geblieben ist, enthielt zwar ein positives Bekenntnis zum kapitalistischen Privateigentum und zum Profitanreiz durch „gesunden Wettbewerb“, aber gleichwohl wurde eine Beschränkung des freien Unternehmertums durch gesetzliche Schranken angekündigt, die Art des Erwerbs und Gebrauchs des Eigentums regeln sollten. Angedeutet wird auch eine Kontrolle der Investitionen, der Preise und der Löhne.122 Am Schweigeverbot und an der Verhinderung der Veröffentlichung des „Wirtschaftsmanifests“ wird sehr deutlich, daß Hitler programmatische Aussagen nur zuließ, wenn damit die Aus- sicht bestand, Unterstützung bei den gesellschaftlichen Gruppen zu gewinnen. Die Aussa- gen des „Wirtschaftsmanifests“ hätten aber bestimmt für einige Irritation bei den Unter- nehmern gesorgt.
Daß zumindest die Ruhrindustrie im Frühjahr 1932 auf eine Regierungsbeteiligung der NSDAP setzte, unter anderem, weil man Brüning nicht mehr vertraute, da man ihm die Tolerierung durch die SPD übel nahm, wird in der Kontaktaufnahme von Paul Reusch mit Hitler durch ein Treffen am 19. März 1932 deutlich. Paul Reusch war einer der führenden Vertreter der Ruhrindustrie und Mitglied der „Ruhrlade“. Für eine Regierungsbeteiligung der NSDAP sei es allerdings nötig, daß Hitler „nicht nur eine erste Kraft für die Wirt- schaftspolitik“ beiseite gestellt bekomme, sondern in einem Kabinett unter Hitler auch Leute für die Finanz-, Außen- und Innenpolitik sitzen müßten, die nicht unbedingt Mit-glieder der NSDAP aber fachlich qualifiziert sein sollten. Ganz im Sinne dieser neuen Strategie äußerte sich auch die Führung des Langnam-Vereins. Bei der Schaffung einer „Rechtsregierung“ müsse die NSDAP beteiligt werden. Dadurch, daß die Industriellen der NSDAP helfen, an die Regierung zu kommen, könne man dann auch durch den gewonne- nen Einfluß auf die NSDAP versuchen, „die allzu radikalen Strömmungen innerhalb der NSDAP in etwa abzubiegen“.123 Offensichtlich favorisierte man zu dieser Zeit innerhalb der Ruhrindustrie zwar eine Regierungsbeteiligung Hitlers, aber man traute den wirt- schaftspolitischen Vorstellungen der Partei nicht und wollte sie nach den eigenen Interes- sen beeinflussen.
Genau dies war auch die Intention mit der die „Arbeitsstelle Schacht“ gegründet wer- den sollte. Die Anregung dazu kam von Hjalmar Schacht selber. Schacht war ehemaliger Reichsbankpräsident und handelte hier aus eigenen politischen und persönlichen Interes- sen.124 Er stand der NSDAP schon länger positiv gegenüber und wollte wieder zu politi- scher Macht gelangen. Die Arbeitsstelle sollte die Wirtschaftsprogrammatik der NSDAP im Sinne der Industrie beeinflussen und dafür Kontakt mit den Parteistellen der NSDAP halten, die sich mit Wirtschaftspolitik beschäftigten. Nach ihrer Gründung mit Beteiligung der „Ruhrlade“ im Juni 1932 beschreibt Schacht die Rolle der Arbeitsstelle allerdings an- ders. Nun soll sie mit dem neuen „persönlichen Wirtschaftsberater“ Wilhelm Keppler „Fühlung“ halten, um sicher zu stellen, daß die Auffassungen der Arbeitsstelle mit denen der NSDAP übereinstimmen.125 Schacht hatte sich entschieden, die aktive Rolle in der Arbeitsstelle fallen zu lassen zugunsten einer Mitarbeit im „Keppler-Kreis“. So blieb sie nur Torso.126 Außerdem hatte mittlerweile Papen das Kanzleramt übernommen, und die Industriellen setzten nun voll auf die Unterstützung der Regierung Papens.
Der eben erwähnte „Keppler-Kreis“ stellt die zweite Kontaktstelle zwischen der In- dustrie und der NSDAP dar. Keppler hatte von Hitler den Auftrag erhalten, die Beziehun- gen der Partei zu Industrie- und Wirtschaftskreisen zu pflegen, was in der Gründung des besagten Kreises im Frühjahr 1932 gipfelte.127 Er war also eine Initiative der NSDAP, nicht der Industriellen.128 Allerdings waren die führenden Großindustriellen nicht im Kreis vertreten. Politisch aktiv wurde er nur einmal mit der Eingabe an Hindenburg im Novem- ber 1932. In dieser vertraulichen Eingabe wurde Hindenburg aufgefordert, Hitler zum Kanzler zu machen. Sie wurde zwar von vielen Personen der Wirtschaft unterschrieben - vor allem von Vertretern aus der Großlandwirtschaft und von mittleren Unternehmern -, aber es ist auffallend, daß fast alle Vertreter der Großindustrie fehlten und speziell von der Ruhrindustrie nur Thyssen unterschrieb.129 Zu dieser Zeit wollte die Großindustrie eher eine erneute Kanzlerschaft Papens als Alternative zum ungeliebten Schleicher erreichen. Neben dieser Eingabe spielte der „Keppler-Kreis“ bei dem Treffen von Papen und Hitler am 4. Januar 1933 eine Rolle. Es war das Mitglied des „Keppler-Kreises“ Kurt von Schroeder - ein Bankier aus Köln -, der die Absicht Papens, sich mit Hitler zu treffen, Keppler berichtete, der darüber wiederum Hitler informierte.130 So wurde das Treffen er- möglicht, daß den Weg Hitlers zur Kanzlerschaft endgültig einleitete. Insofern hat der „Keppler-Kreis“ eine relativ wichtige Rolle gespielt, aber die Großindustriellen, als die mächtigsten Wirtschaftsvertreter neben den Großagrariern, die im Kreis vertreten waren, konnten man mit ihm nicht für die NSDAP gewinnen.
Nicht zuletzt das in der Rede von Gregor Strasser im Reichstag am 10. Mai 1932 vor- gestellte „Wirtschaftliche Sofortprogramm der NSDAP“ stieß auf entschiedene Kritik bei den industriellen Verbänden und bestärkte deren Eindruck, daß die NSDAP wirtschaftspo- litisch unzuverlässig ist, und sie doch einen sozialistischen Kurs einschlagen könnte. Die NSDAP hatte die zunehmende Arbeitslosigkeit ständig in das Zentrum ihrer Propaganda gestellt und zur Kritik am „Weimarer System“ ausgeschlachtet.131 Trotzdem herrschte bis zu diesem Zeitpunkt wie bei den anderen Parteien Ratlosigkeit darüber, wie man den die Arbeitslosigkeit wirksam bekämpfen könnte. Innerhalb der NSDAP reifte die Erkenntnis heran, daß man hier ein Programm benötigte, um sich im Wahlkampf auch auf diesem Ge- biet als kompetent präsentieren zu können. Es ist nicht weiter verwunderlich, daß dieses Programm vom Strasser-Flügel der Partei ausgearbeitet wurde, der immer noch hoffte, die Arbeiterschaft für die NSDAP zu gewinnen. Für die Arbeiter war die Arbeitslosigkeit das wichtigste Problem.
Strasser beginnt seine Rede132 gleich mit einem Angriff auf das liberal-kapitalistische System. Der „Verteilungsapparat des weltwirtschaftlichen Systems“ könne nicht gewähr- leisten, daß die erwirtschafteten Erträge zum Wohle aller„richtig“ verteilt werden. Daher habe eine „antikapitalistische Sehnsucht“ das „Volk“ erfaßt, die aber nicht Privateigentum ablehnt, sondern eine „entartete“ Wirtschaft, bei der es nur noch um Geld, Dividende und Materialismus ginge. Es ginge nicht mehr um ein „ehrliches Auskommen für ehrlich ge- leistete Arbeit“.133 Schon diese antikapitalistische Rhetorik mußte bei den Industriellen auf Skepsis stoßen, wurde hier doch die moderne liberale geldorientierte Wirtschaftsordnung abgelehnt. Darüber hinaus macht Strasser in seinen folgenden Ausführungen den Gewerk- schaften ein Kooperationsangebot. Er bezieht sich auf Pläne für ein Arbeitsbeschaffungs- programm, daß durch staatliche Kreditaufnahme finanziert werden sollte und direkte Ar- beitsbeschaffungsmaßnahmen durch staatliche Investitionen in Infrastrukturaufbau vorsah, die innerhalb des Allgemeinen Deutschen Gewerschaftsbunds (ADGB) diskutiert wurde.134 Bei solchen Plänen sei man „jederzeit unter entsprechenden Bedingungen zu Mitarbeit bereit“. Kooperationen mit den Gewerkschaften wurden zwar auch von der Leitung des RDI - wie oben dargestellt - unter bestimmten Umständen gebilligt, aber die Schwerin- dustrie stand solchen Plänen rundheraus ablehnend gegenüber.
Im weiteren Verlauf der Rede kommt Strasser zu dem Kernproblem der Arbeitsbe- schaffung. Zum Anfang betont Strasser, daß jeder ein „Recht auf Arbeit“ habe.135 Daran anschließend führt er ganz im Sinne der nationalsozialistischen Vorstellungen von Autar- kie aus, daß sichergestellt werden müsse, daß durch eine Förderung der Landwirtschaft Deutschland seine Bevölkerung selbständig mit Nahrungsmitteln versorgen kann. Dafür sei eine Ansiedlung von Bauern auf dem Lande nötig. Außerdem müßten Wohnungen außerhalb der Städte gebaut werden, da das Wohnen in den Städten die Menschen von den „natürlichen Formen der Lebensführung“ entfremde. Bauernansiedlung und Wohnungsbau seien nun vom Staat zu leisten und dadurch könnte man viele Menschen wieder in Arbeit bringen. Finanziert werden sollen diese Maßnahmen durch die Mittel, die man dadurch in der Arbeitslosenunterstützung einspart, durch ein höheres Steueraufkommen, das durch die mit Umsetzung der Maßnahmen erwartete Belebung der Wirtschaft eintritt und durch Kreditaufnahme des Staates am Kapitalmarkt.136 Solche weitgehende staatlichen Eingriffe wurden von weiten Kreisen der Unternehmer abgelehnt, da sie den herrschenden Überzeu- gungen von den „Selbstheilungskräften“ der Wirtschaft widersprachen. Weiterhin forderte Strasser staatliche Kontrollen der Preise, Löhne und sogar der Investitionstätigkeit. Bei Investitionen müsse geprüft werden, ob sie den Interessen des „ganzen Volkes“ dienen würden.137 Auch diese Vorstellungen von staatlichen Steuerungsansprüchen dürfte bei vie- len Industriellen nicht auf Gegenliebe gestoßen sein. Die Rede konzentriert sich auch aus- schließlich auf den Binnenmarkt, eine Orientierung auf den Export und damit dem Welt- markt wird grundsätzlich kritisiert.138 Dies wurde in einem Artikel der „Deutschen Führer- briefe“ - einer in Wirtschaftskreisen viel gelesenen Publikation - heftig kritisiert und stand im Gegensatz zu den traditionell exportorientierten Interessen der verarbeitenden Indust- rie.139
Dieses von Strasser skizzierte Programm wurde kurz nach der Rede etwas ausführli- cher veröffentlicht, das in seiner endgültigen Version wahrscheinlich von dem Strasser nahe stehenden stellvertretenden Leiter der WPA Adrian von Renteln abgefaßt wurde.140 Auf die Rede Strassers und das veröffentlichte Programm reagierte auch ein Vertreter des RDI. Dessen Geschäftsführer Jakob Herle übermittelte Adrian von Renteln eine ausführli- che Denkschrift.141 Herle lehnt darin fast alle Vorschläge zur Arbeitsbeschaffung als unge- eignet ab, spürbar die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.142 Er kritisiert, daß allein eine Förde- rung des Binnenmarkts nicht zur Erholung der Wirtschaft beitragt, weil er nicht genug Ab- satzmärkte für die Industrie bietet.143 Außerdem lehnt er alle Ideen der Nationalsozialisten bezüglich einer stärkeren Kontrolle der Wirtschaft ab.144 Insgesamt stellt diese Denkschrift eine vernichtende Kritik an dem „Sofortprogramm“ dar. An Herles Kritik ist vor allem bemerkenswert, daß das „Sofortprogamm“ bei ihm anscheinend den Eindruck erweckt. die wirtschaftpolitischen Vorstellungen der NSDAP würden doch auf „staatssozialistische“ Ideen zulaufen.145
Angesichts der massiven Kritik aus Industriellenkreisen hat sich Hitler wahrscheinlich entschieden, das „Sofortprogramm“ zurückzuziehen, um deren Unterstützung auf dem Weg zur Kanzlerschaft nicht zu verlieren. Freilich erst nachdem es für die Wahlpropagan- da genutzt worden ist.146 Es wurde durch das „Wirtschaftliche Aufbauprogramm der NSDAP“ ersetzt, das von Walter Funk und Gottfried Feder ausgearbeitet worden ist. Gleichzeitig wurde Otto Wagener entlassen. In weiten Teilen des Aufbauprogramms wird der Kritik aus den Industriellenkreisen Rechnung getragen. Die antikapitalistische Rheto- rik taucht überhaupt nicht mehr auf, die Vorrangstellung des Binnenmarkts wird zwar bei- behalten, aber der Export wird für Deutschland als unentbehrlich bezeichnet, es wird eine Steuersenkung versprochen, und von Preis- und Investitionskontrollen ist in dem Pro- gramm keine Rede mehr. Auch das „Recht auf Arbeit“ taucht nicht mehr auf.147 Hier wird sehr deutlich, wie die Programmatik der NSDAP an den Interessen der Gruppen ausgerich- tet wurde, die man zu dem jeweiligen Zeitpunkt umwarb.
Wenn die Annäherungsversuche zwischen Großindustriellen und NSDAP insgesamt betrachtet werden, wird deutlich, daß die Großindustrie nur mit der „Arbeitsstelle Schacht“ aktiv versuchen wollte, die Programmatik der NSDAP zu beeinflussen, und hier war es nur ein Teil der Industriellen, nämlich die Ruhrindustrie. Außerdem ging die Initiative dazu von der Person Schacht aus, und die „Arbeitsstelle“ spielte keine entscheidende Rolle. Auch die Aktivitäten Heinrichsbauers waren nicht Ausfluß einer Strategie aller industriel- ler Kreise. Dem gegenüber war der „Keppler-Kreis“ eine Initiative der NSDAP, nament- lich Hitlers, und die Eingabe bei Hindenburg sowie das Treffen von Hilter und Papen gin- gen nicht auf Initiative der Großindustriellen zurück. Auch die Zurücknahme des „Sofort- programms“ und die Veröffentlichung des „Aufbauprogramm“ zeigen - neben dem Um- stand, daß innerhalb der Partei immer noch keine klare wirtschaftspolitische Linie herrsch- te, wie die Forderungen des „Sofortprogramms“ zeigen und die Rivalität zwischen Strasser und Hitler fortbestand -, daß die Annäherung an die Industriellen eine Strategie Hitlers war, die er mit der Zurücknahme des „Sofortprogramms“ durchsetzte. Diese Annäherungs- strategie war insofern erfolgreich, als daß die NSDAP von den Großindustriellen als ernst zu nehmende politische Kraft war genommen wurde, mit der sich Kontakte und Verhand- lungen lohnten. Die NSDAP wurde somit „hoffähig“. Sie führte aber nicht zu eine vollen Unterstützung der NSDAP durch die Großindustrie, wie im folgenden gezeigt wird.
5.3. Epilog: Die Industrieverb ä nde und die „ Machtergreifung “
Trotz dieser Annäherungsversuche der NSDAP standen einige Teile der Großindustriellen einer Kanzlerschaft Hitlers kurz vor der Ernennung Hitlers zum Kanzler ablehnend gegen- über. Innerhalb der westlichen Schwerindustrie war es nur der Flügel um Thyssen und Kir- dorf, der eine Kanzlerschaft Hitler vorbehaltlos unterstütze.148 Der RDI setzte sich für einen Verbleib Schleichers im Kanzleramt ein, da sich Schleicher gegen die Autarkieforde- rungen der Landwirtschaft wendete und sich für eine exportfreundliche Handelspolitik aussprach, was ein Hauptanliegen der verarbeitenden Industrie war, die am stärksten in der Spitze des RDI vertreten war.149 Die gemäßigten Industriellen der westlichen Schwerin- dustrie, vor allem der Langnam-Verein, waren gegen Schleicher als Kanzler, da sie wegen des Konzepts der „Querfront“ eine Reparlametarisierung fürchteten und weil Schleicher die von Papen projektierte „Reichsreform“ nicht verwirklichen wollte. Sie plädierten für eine neue Kanzlerschaft Papens. Um eine Massenbasis für seine erneute Kanzlerschaft zu erreichen, hatte man die Idee, Strasser an der Regierung zu beteiligen, da man ihn trotz seiner politischen Ziele für kompromißfähiger hielt.150 Nur in einem Punkt waren sich die Großindustriellen einig: Es sollte keine Rückkehr zu einer verfassungsgemäßen, parlamen- tarisch gestützten Regierung geben. Die autoritäre Präsidialregierung sollte unter allen Umständen weitergeführt werden.151
Es ist hier weder nötig noch möglich, das Intrigenspiel darzustellen, daß letztlich zu Hitlers Kanzlerschaft geführt hat. Nur soviel sei gesagt, es waren nicht Großindustrielle, die den Widerstand Hindenburgs gegen eine Kanzlerschaft Hitlers brachen und somit das größte Hindernis beiseite räumten, sondern Vertreter der Großlandwirtschaft, Teile der Reichswehrgeneralität und natürlich Papen.152 Allerdings lief die Industrie nach der Er- nennung Hitlers zum Kanzler auch nicht Sturm gegen die neue Regierung. Einmal darf dies als Erfolg der Annäherungsstrategie Hitlers gewertet werden, und zum anderen erlag man der weit verbreiteten Illusion, Hitler würde durch die übrigen bürgerlichen Kräfte im Kabinett wirksam eingerahmt.
6. Fazit
Abschließend lassen sich folgende Ergebnisse der vorangegangenen Darstellung festhal- ten. Ausgehend von diffusen Vorstellungen einer Protestpartei, deren Forderungen auf wirtschaftlichem Gebiet hauptsächlich der damaligen aktuellen politischen Situation ent- sprangen, haben die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der NSDAP während ihrer Ent- wicklung konkretere Formen angenommen. Diese Konkretisierungen wurden allerdings hauptsächlich vom „linken“ Flügel der Partei beeinflußt. Obwohl dieser Flügel die Unter- stützung der Arbeiterschaft gewinnen wollte, haben die hier entwickelten Vorstellungen mit den Zielen der Gewerkschaften wenig Übereinstimmung. In den Programmentwürfen wird eher ein „kleinbürgerlicher Sozialismus“ deutlich, der auf den Schutz des kleinen Mittelstands bedacht war und mit den Vorstellungen von einer ständischen Wirtschafts- ordnung eine antimoderne Ausrichtung hatte, die den Verhältnissen industrieller Massen- produktion kaum angemessen war.
Der „kapitalistische“ Hitler-Flügel hat solche programmatischen Festlegungen immer abgelehnt, um relevante gesellschaftliche Gruppen nicht abzuschrecken. Gleichwohl hat er die „antikapitalistische“ Agitation nicht gänzlich unterbunden, um ihr Potential für den Gewinn an Stimmen im Wahlkampf zu nutzen, wodurch sich auch erklärt, warum Hitler die Veröffentlichung des „Sofortprogramms“ zugelassen hat. Es wurde erst nach dem Wahlkampf zurück genommen. Diese Ablehnung von programmatischen Festlegungen entsprach auch Hilters politischer und strategischer Konzeption. Vorrangiges Ziel war es, Deutschland unter einer nationalsozialistischen Herrschaft zu „einen“, erst dann könnte man mit einer konkreten Ausgestaltung der Wirtschaftsordnung beginnen, wobei das Pri- mat der Wirtschaftspolitik nicht in der Frage zu liegen hätte, was die Wirtschaft am besten fördert, sondern was dem „Wiederaufstieg“ Deutschlands dient.
Diese Strategie, die Unterstützung aller gesellschaftlich relevanten Gruppen zu gewin- nen, wurde am Beispiel der Annäherung an die Großindustriellen besonders deutlich. Ver- treter der NSDAP haben aktiv versucht, Unterstützung bei dieser Gruppe zu gewinnen und die Darstellung der wirtschaftspolitischen Ziele der Partei auf die Interessen dieser Gruppe eingestellt, was in der Zurücknahme des „Sofortprogramms“ und der ständigen Beteue- rung, die NSDAP werde Privateigentum nicht antasten, besonders deutlich wird. Wie dar- gestellt ist es nur teilweise gelungen, die Zustimmung der Großindustriellen zu gewinnen. Vor allem die verarbeitende Industrie blieb skeptisch, was mit ihrer Orientierung auf den Export zusammen hing. Sie fürchteten, daß die Autarkiekonzepte und die Hegemonialplä- ne der Nationalsozialisten ihre Absatzchancen auf dem Weltmarkt nachhaltig schädigen würden.
So ist hier auch in Übereinstimmung mit dem in der Einleitung erwähnten Forschungs- stand festzustellen, daß keineswegs der gesamten Großindustrie die Machtergreifung Hit- lers zur Last zu legen ist. Es waren Teile der westlichen Schwerindustrie zusammen mit anderen konservativen Kreisen, die Hitler zum Kanzler gemacht haben. Daher kann auch nicht dem kapitalistischen System die Schuld an dem Aufstieg der Nationalsozialisten ge- geben werden. Die Machtübernahme durch Hitler erklärt sich aus der Bereitschaft der kon- servativen politischen Elite der Weimarer Republik, das parlamentarische System abzu- schaffen und zur Erreichung dieses Ziels sogar die Kanzlerschaft eines politischen Hasar- deurs wie Hitler zu akzeptieren.
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literaturverzeichnis
Quellen
DER NATIONALE SOZIALISMUS. Dispositionsentwurf eines umfassenden Programms des nationalen Sozialismus. Abgedruckt bei: Kühnl: Zur Programmatik der nationalsozialistischen Linken, siehe Literatur, S. 324-333.
HITLER, Adolf: Der Weg zum Wiederaufstieg. München 1927. Abgedruckt in: Turner, Henry Ashby: Faschismus und Kapitalismus in Deutschland. Studien zum Verhältnis zwischen Nationalsozialismus und Wirtschaft. Göttingen 1972, S. 41-59. DERS.: Vortrag im Industrie-Klub zu Düsseldorf am 26. Januar 1932. Auszug abgedruckt bei: Michalis, Herbert/ Schraepler, Ernst (Hg.): Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Berlin 1959ff. Bd. 8. Die Weimarer Republik. Das Ende des parlamentari- schen Systems; Brüning, Papen, Schleicher 1930-33. Berlin 1963, S. 380-383. TURNER, Henry Ashby (Hg.): Hitler aus nächster Nähe. Aufzeichnungen eines Vertrauten 1929-1932. Frankfurt a. M./ Berlin/ Wien 1978.
SCHREIBEN des Geschäftsführers des Reichsverbandes der Deutschen Industrie, Jacob Her- le, an Dr. von Renteln. Abgedruckt bei: Stegmann: Verhältnis von Großindustrie und Nationalsozialismus, siehe Literatur, S. 452-465.
REDE von Gregor Strasser im Reichstag am 10. Mai 1932. Abgedruckt in: Verhandlungen des Reichstags. V. Wahlperiode 1930. Stenographische Berichte, Bd. 446, Berlin 1932 (Neudruck: Bad Feilnbach 1986), S. 2510-2521.
Literatur
AMBROSIUS, Gerold: Von Kriegswirtschaft zu Kriegswirtschaft 1914-1945. In: North, Mi- chael: Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Ein Jahrtausend im Überblick. München 2000, S. 282-350.
BARKAI, Avraham: Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus. Ideologie, Theorie, Politik 1933-1945. Erw. Neuauflage, Frankfurt a. M. 1988.
BRACHER, Karl Dietrich: Die Auflösung der Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie. 2. erw. Aufl., Stuttgart/ Düsseldorf 1957. CZICHON, Eberhard: Wer verhalf Hitler zur Macht? Zum Anteil der deutschen Industrie an der Zerstörung der Weimarer Republik. 2. Aufl., Köln 1971.
FELDENKIRCHEN, Wilfried: Die deutsche Wirtschaft im 20. Jahrhundert. (Enzyklopädie Deutscher Geschichte Band 47) München/ Oldenbourg 1998.
GESSNER, Dieter: Die Landwirtschaft und die Machtergreifung. In: Michalka, Wolfgang (Hg.): Die nationalsozialistische Machtergreifung. München/Wien/Zürich 1984, S. 124-136.
HARTWICH, Hans-Herrman: Parteien und Verbände in der Spätphase der Weimarer Repu- blik - Wirtschaftskrise und Polarisierung. In: Rittberger, Volker (Hg.): 1933: Wie die Republik der Diktatur erlag. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1983, S. 76-97. JAEGER, Hans: Geschichte der Wirtschaftsordnung in Deutschland. Frankfurt a. M. 1988. KERSHAW, Ian: Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick.
2. Aufl., Hamburg 2001.
KNOCHE, Heinrich: Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierungen Brüning, Papen, Schleicher und Hitler in den Jahren der Weltwirtschaftskrise von 1928/30-1934. Diss. Marburg 1989.
Krüger, Peter: Zu Hitlers „nationalsozialistischen Wirtschaftserkenntnissen“. GG 3 (1977), S. 263-282.
KÜHNL, Reinhard: Zur Programmatik der nationalsozialistischen Linken: Das Strasser- Programm von 1925/1926. VfZ 14 (1966), S. 317-333.
MOMMSEN, Hans: Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar. 1918-1933. 2. Aufl., München 2001.
NEEBE, Großindustrie, Staat und NSDAP 1930-1933. Paul Silverberg und der Reichsver- band der Deutschen Industrie in der Krise der Weimarer Republik. Göttingen 1981. PETZINA, Dieter: Hauptprobleme der deutschen Wirtschaftspolitik. VfZ 15 (1967), S. 18- 55.
STEGMANN, Dirk: Zum Verhältnis von Großindustrie und Nationalsozialismus 1930-1933. Ein Beitrag zur Geschichte der sog. Machtergreifung. Archiv für Sozialgeschichte 13 (1977), S. 399-482.
TURNER, Henry Ashby: Großunternehmertum und Nationalsozialismus 1930-1933. Kriti- sches und Ergänzendes zu zwei neuen Forschungsbeiträgen. HZ 221 (1975), S. 18-68. TYRELL, Albrecht: Die NSDAP als Partei und Bewegung - Strategie und Taktik der
Machtergreifung. In: Rittberger: 1933, S. 98-122.
VOLKMANN, Hans Erich: Das außenwirtschaftliche Programm der NSDAP 1930-1933. AfZ 17 (1977), S. 251-274.
WINKLER, Heinrich August: Unternehmerverbände zwischen Ständeideologie und Natio- nalsozialismus. VfZ 17 (1969), S. 341-371.
DERS.: Vom Protest zur Panik: Der gewerbliche Mittelstand in der Weimarer Republik. In: Mommsen, Hans/ Petzina, Dieter/ Weisbrod, Bernd: Industrielles System und politi- sche Entwicklung in der Weimarer Republik. Verhandlungen des Internationalen Symposiums in Bochum vom 12.-17. Juni 1973. Düsseldorf 1974, S. 777-791. WIPPERMANN, Wolfgang: Faschismustheorien. Die Entwicklung der Diskussion von den Anfängen bis heute. 7. überarb. Aufl., Darmstadt 1997.
[...]
1 HITLER, Adolf: Der Weg zum Wiederaufstieg. München 1927. Abgedruckt in: TURNER, Henry Ashby: Faschismus und Kapitalismus in Deutschland. Studien zum Verhältnis zwischen Nationalsozialismus und Wirtschaft. Göttingen 1972, S. 41-59, hier S. 56.
2 TURNER: Faschismus und Kapitalismus, S. 33f.
3 Ebd., S. 60ff.
4 BARKAI, Avraham: Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus. Ideologie, Theorie, Politik 1933-1945. Erw. Neuauflage, Frankfurt a. M. 1988, S. 27f.
5 „Sozialistisch“ und „kapitalistisch“ sind eigentlich nicht die genau zutreffenden Charakterisierungen der beiden Positionen. Sie erlauben aber an dieser Stelle erst mal eine grobe Unterscheidung und Einordnung. Im Folgenden werden die Positionen genauer charakterisiert.
6 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP. Paul Silverberg und der Reichsverband der Deutschen Industrie in der Krise der Weimarer Republik. Göttingen 1981, S. 19. Auch Bracher betont, daß die Großindustriellen allein schon durch ihr ökonomisches Gewicht, das durch Kartellbildungen immens angestiegen war, auch politische Macht hatten, an der die Politik nicht vorbei konnte. Vgl.: BRACHER, Karl Dietrich: Die Auflösung der Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie. 2. erw. Aufl., Stutt- gart/ Düsseldorf 1957, S. 214.
7 So der Untertitel der Monographie Czichons zu diesem Thema. CZICHON, Eberhard: Wer verhalf Hitler zur Macht? Zum Anteil der deutschen Industrie an der Zerstörung der Weimarer Republik. 2. Aufl., Köln 1971.
8 So wurde der Faschismus auf dem 13. Plenum des Exekutivkomitees der Komintern im Dezember 1933 als die „offene terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“ definiert. Vgl.: WIPPERMANN, Wolfgang: Faschismustheorien. Die Entwicklung der Diskussion von den Anfängen bis heute. 7. überarb. Aufl., Darmstadt 1997, S. 21.
9 Eine gute Übersicht über diese Debatte findet sich in der Einleitung von Neebes Untersuchung. Vgl.: NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 9ff.
10 Vgl.: KERSHAW, Ian: Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick. 2. Aufl., Hamburg 2001. S. 80f.
11 BARKAI: Wirtschaftssystem.
12 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP; TURNER: Faschismus und Kapitalismus.
13 Die vollständigen bibliographischen Angaben werden an dem Ort gegeben, an dem die Quelle thematisiert wird
14 JAEGER, Hans: Geschichte der Wirtschaftsordnung in Deutschland. Frankfurt a. M. 1988, S. 176f.
15 BARKAI: Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus, S. 30.
16 Ebd., S. 29.
17 Vgl.: KRÜGER, Peter: Zu Hitlers „nationalsozialistischen Wirtschaftserkenntnissen“. GG 3 (1977), S. 263- 282.
18 BARKAI: Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus, S. 30.
19 JAEGER: Geschichte der Wirtschaftsordnung, S. 177.
20 BARKAI: Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus, S. 30.
21 Ebd., S. 32.
22 JAEGER: Geschichte der Wirtschaftsordnung, S. 178.
23 TYRELL, Albrecht: Die NSDAP als Partei und Bewegung - Strategie und Taktik der Machtergreifung. In: Rittberger, Volker (Hg.): 1933: Wie die Republik der Diktatur erlag. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1983, S. 98-122, hier S. 103.
24 KÜHNL, Reinhard: Zur Programmatik der nationalsozialistischen Linken: Das Strasser-Programm von 1925/1926. VfZ 14 (1966), S. 317-333, hier S. 318.
25 MOMMSEN, Hans: Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar. 1918-1933. 2. Aufl., München 2001, S. 392.
26 KÜHNL: Programmatik der nationalsozialistischen Linken, S. 320.
27 Ebd., S. 323; sowie MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S. 394.
28 KÜHNL: Programmatik der nationalsozialistischen Linken, 323
29 Ebd., S. 321.
30 Ebd., S. 323.
31 Der nationale Sozialismus. Dispositionsentwurf eines umfassenden Programms des nationalen Sozialismus. Abgedruckt in: Ebd., S. 327-333.
32 MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S. 400.
33 Vgl. dazu im einzelnen: WINKLER, Heinrich August: Unternehmerverbände zwischen Ständeideologie und Nationalsozialismus. VfZ 17 (1969), S. 341-371.
34 KÜHNL spricht von einem „kleinbürgerlichen Sozialismus“. Vgl. seine Anmerkung 49 im Abdruck des Programms auf S. 327.
35 WINKLER, Heinrich August: Vom Protest zur Panik: Der gewerbliche Mittelstand in der Weimarer Republik. In: Mommsen, Hans/ Petzina, Dieter/ Weisbrod, Bernd: Industrielles System und politische Entwicklung in der Weimarer Republik. Verhandlungen des Internationalen Symposiums in Bochum vom 12.-17. Juni 1973. Düsseldorf 1974, S. 777-791, hier S. 778f.
36 So das zutreffende Urteil von MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S. 401. 13
37 Bei dieser Tagung ging es auch um die Frage, ob die NSDAP sich an einem Bündnis beteiligen sollte, daß bei einem Volksentscheid um die Frage der Fürstenenteignung für dieselbe warb. Siehe dazu: Ebd., S. 298f.
38 Ebd., S. 395.
39 KÜHNL: Programmatik der nationalsozialistischen Linken, S. 323.
40 Vgl. zu diesem Vorgang: MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S. 419f.
41 Ebd., S. 610.
42 TURNER: Faschismus und Kapitalismus, S. 33.
43 Ebd., S. 37.
44 Die Seitenangaben beziehen sich auf die bereits zitierte Ausgabe: HITLER, Adolf: Der Weg zum Wieder- aufstieg. München 1927. Abgedruckt in: Turner, Henry Ashby: Faschismus und Kapitalismus in Deutsch- land, S. 41-59.
45 JAEGER: Geschichte der Wirtschaftsordnung, S. 150f.
46 HITLER, Adolf: Der Weg zum Wiederaufstieg, S. 47.
47 Zwischen 1924 und 1930 lag sie im Schnitt bei 7,6%. Vgl.: AMBROSIUS, Gerold: Von Kriegswirtschaft zu Kriegswirtschaft 1914-1945. In: North, Michael: Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Ein Jahrtausend im Überblick. München 2000, S. 282-350, hier S. 290.
48 Vgl.: Ebd., S. 312f.
49 HITLER, Adolf: Der Weg zum Wiederaufstieg, 49f.
50 Ebd., S. 50.
51 Ebd., S. 57.
52 Ebd., S. 52f.
53 Vgl.: TURNER: Faschismus und Kapitalismus, S. 38.
54 Vgl.: STEGMANN, Dirk: Zum Verhältnis von Großindustrie und Nationalsozialismus 1930-1933. Ein Bei- trag zur Geschichte der sog. Machtergreifung. Archiv für Sozialgeschichte 13 (1977), S. 399-482, hier S. 413.
55 WINKLER, Unternehmerverbände zwischen Ständeideologie und Nationalsozialismus, S. 346f.
56 Vgl. zu den Versuchen des Vorstands des RDI den Verband auf einen verfassungsfreundlichen Kurs zu lenken: NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 35ff.
57 Vgl.: GESSNER, Dieter: Die Landwirtschaft und die Machtergreifung. In: Michalka, Wolfgang (Hg.): Die nationalsozialistische Machtergreifung. München/Wien/Zürich 1984, S. 124-136, hier S. 134. Ab 1927 erkannte die NSDAP, daß sie bei den Wählern auf dem Land an Boden gewinnen konnte und stellte ihre Propaganda darauf ein. Vgl.: MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S,. 403f.
58 Ebd., S. 425.
59 Ebd.; S. 426. Trotzdem behielt die NSDAP ihre antikapitalistische Agitation bei. Was ein Hauptproblem bei der Annäherung an die Großindustrie war. Darauf wird unten noch eingegangen.
60 Zit. nach NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 60.
61 Vgl.: Ebd., S. 24f
62 Dieses Interesse drückte sich z. B. in der Unterstützung des von Exkanzler Wilhelm Cuno gegründeten „Bund zur Erneuerung des Reiches“ , der diese Ideen propagierte, durch einige Schwerindustrielle aus. Vgl.: MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S. 317.
63 Vgl.: Ebd., S. 326f.
64 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 57.
65 Ebd., S. 59.
66 Vgl. zur Reorganisation der RDI: Ebd., S. 64f
67 Ebd., S. 63.
68 Ebd., S. 67.
69 Vgl. für eine detaillierte Darstellung dieser Vorgänge: Ebd., S. 68f.
70 Ebd., S. 71.
71 Nach der Weimarer Verfassung hätte dies die Verordnungen des Reichspräsidenten aufgehoben. Vgl.: HARTWICH, Hans-Herrman: Parteien und Verbände in der Spätphase der Weimarer Republik - Wirtschaftskrise und Polarisierung. In: Rittberger: 1933, S. 76-97, hier S. 78.
72 Vgl. MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S. 362f.
73 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 74ff.
74 Ebd., S. 76.
75 Brünings Strategie zur Erreichung seines Ziels, das Ende der Reparationen, war eine Sanierung der öffent- lichen Finanzen und so weit möglich Zahlung der Reparationen, eine Deflationspolitik zur Senkung der Preise der hergestellten Waren und eine Exportoffensive mit diesen billigen Produkten auf dem Weltmarkt. Die zu erwartende Kritik von den USA, von Frankreich und England an dieser Exportoffensive mit den billi- gen Produkten wollte Brüning dann mit dem Hinweis begegnen, daß Deutschland so viel exportieren müsse, um die Reparationen, aber auch die öffentlichen und privaten Schulden im Ausland, zahlen zu können. Deutschland würde also förmlich zu diesem Handeln gezwungen, wenn die Reparationsforderungen nicht gemildert oder sogar eingestellt würden. Vgl.: AMBROSIUS: Kriegswirtschaft zu kriegswirtschaft, S. 318f sowie Mommsen: Aufstieg und Niedergang, S. 439f. Hier wird also der Standpunkt vertreten, daß die Defla- tionspolitik Brünings sich aus seinen politischen Motiven erklärt. Über die Frage der wirtschaftspolitische Angemessenheit dieser Politik und denkbare Alternativen zu ihr ist die so genannte „Borchardt- Kontroverse“ entstanden. Vgl. für eine knappe Zusammenfassung dieser Kontroverse: FELDENKIRCHEN, Wilfried: Die deutsche Wirtschaft im 20. Jahrhundert. (Enzyklopädie Deutscher Geschichte Band 47) Mün- chen/ Oldenbourg 1998, S. 89f. Diese Debatte mündet im Endeffekt in einen Streit um keynsianische oder liberale Wirtschaftsordnungsmodelle, der für die Erklärung der Zusammenhänge des Aufstiegs des National- sozialisten nur noch von begrenztem Wert sind. Unzweifelhaft hat die Weltwirtschaftskrise zur Verarmung und damit Radikalisierung breiter Bevölkerungsschichten beigetragen und die Wählerschaft der NSDAP damit anwachsen lassen. Wie sehr die Deflationspolitik zu einer Verschärfung der Verarmung beigetragen hat, und welche anderen Maßnahmen zur Krisenlinderung möglich gewesen wären, ist eine zweitrangige Frage, wenn bedacht wird, daß Hitler die Macht von den herrschenden Eliten in die Hände gegeben worden ist, und er sie nicht durch einen Wahlsieg errungen hat, wenngleich die Wahlerfolge der NSDAP ein gewich- tiges Argument bei der Machtübergabe an Hitler abgegeben haben mögen. Mit der Entscheidung, Hitler zum Kanzler zu machen, haben die konservativen Eliten - in der fatalen Fehleinschätzung Hitler in einem bürger- lich-konservativen Kabinett unter Kontrolle halten zu können - Hitler die Chance gegeben, die fast uneinge- schränkte Macht in Deutschland zu erreichen.
76 Vgl. MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S. 432f.
77 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 86.
78 TURNER: Faschismus und Kapitalismus, S. 115ff.
79 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 88.
80 Ebd., S. 88f.
81 Ebd., S. 91.
82 Ebd., S. 97.
83 Ebd., S. 103.
84 Ebd., S. 107.
85 MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S. 523.
86 Ebd., S. 539.
87 KNOCHE, Heinrich: Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierungen Brüning, Papen, Schleicher und Hitler in den Jahren der Weltwirtschaftskrise von 1928/30-1934. Diss. Marburg 1989, S. 146.
88 Ebd., S. 147.
89 Ebd., S. 150f. Vgl. auch: PETZINA, Dieter: Hauptprobleme der deutschen Wirtschaftspolitik. VfZ 15 (1967), S. 18-55, hier S. 24.
90 Ebd., S. 21.
91 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 129.
92 KNOCHE: Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierungen, S. 148f
93 PETZINA: Hauptprobleme, S. 25.
94 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 136.
95 Ebd., S. 131.
96 Darauf wird unten noch einzugehen sein.
97 PETZINA: Hauptprobleme, S. 32.
98 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 130.
99 Vgl. hierzu: MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S. 588ff.100 PETZINA: Hauptprobleme, S. 26.
101 Zit. nach NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 143.
102 KNOCHE: Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierungen, S. 159.103 Ebd., S. 162f.
104 PETZINA: Hauptprobleme, S. 36f.
105 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 141. Vgl. auch Turner: Faschismus und Kapitalismus, S. 27. 29
106 BARKAI: Wirtschaftssystem, S. 32.
107 MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S. 404.
108 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 117.
109 Ebd., S. 118f.
110 VOLKMANN, Hans Erich: Das außenwirtschaftliche Programm der NSDAP 1930-1933. AfZ 17 (1977), S. 251-274, hier S. 267.
111 BARKAI: Wirtschaftssystem, S, 35.
112 VOLKMANN: Außenwirtschaftliche Programm, S. 268.
113 So beschreibt der Leiter der WPA Otto Wagener das agieren Funks in seinen Erinnerungen. Vgl.: TURNER, Henry Ashby (Hg.): Hitler aus nächster Nähe. Aufzeichnungen eines Vertrauten 1929-1932. Frankfurt a. M./ Berlin/ Wien 1978, S. 442.
114 Auszug abgedruckt in: MICHALIS, Herbert/ SCHRAEPLER, Ernst (Hg.): Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Berlin 1959ff. Bd. 8. Die Weimarer Republik. Das Ende des parlamentarischen Systems; Brüning, Papen, Schleicher 1930-33. Berlin 1963. S. 380-383.
115 Ebd., S. 381.
116 Ebd., S. 383.
117 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 119f.118 MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S. 406.119 BARKAI: Wirtschaftssystem, S. 34.
120 Ebd., S. 35f
121 So gibt Wagener Hitler in seinen Erinnerungen wieder. Vgl.: TURNER (Hg.): Hitler aus nächster Nähe, S. 444.
122 Vgl.: BARKAI: Wirtschaftssystem, S. 39f.
123 Vgl. zu diesem Strategiewechsel der Ruhrindustrie: NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 120ff. Zitate: Ebd..
124 TURNER, Henry Ashby: Großunternehmertum und Nationalsozialismus 1930-1933. Kritisches und Er- gänzendes zu zwei neuen Forschungsbeiträgen. HZ 221 (1975), S. 18-68, hier S. 33. 125 Ebd., S. 54.
126 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP, S. 124.127 BARKAI: Wirtschaftssystem, S. 35.
128 TURNER: Großunternehmertum und Nationalsozialismus, S. 56. 34
129 Ebd., S. 58f.
130 MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S. 620.131 BARKAI: Wirtschaftssystem, S. 41.
132 Rede von Gregor STRASSER im Reichstag am 10. Mai 1932. Abgedruckt in: Verhandlungen des Reichstags. V. Wahlperiode 1930. Stenographische Berichte, Bd. 446, Berlin 1932 (Neudruck: Bad Feilnbach 1986), S. 2510-2521.
133 Ebd., S. 2511.
134 Vgl. zu diesen Plänen: BARKAI: Wirtschaftssystem, S. 51.135 Rede von STRASSER, S. 2514
136 Ebd., S. 2515. 137 Ebd., S. 2517ff. 138 Ebd., S. 2520.
139 Vgl.: BARKAI: Wirtschaftssystem, S. 46.140 Ebd., S. 42.
141 Schreiben des Geschäftsführers des Reichsverbandes der Deutschen Industrie, Jacob HERLE, an Dr. von Renteln. Abgedruckt bei: STEGMANN: Verhältnis von Großindustrie und Nationalsozialismus, S. 452-465. 142 Ebd., S. 455.
143 Ebd., S. 457.
144 Vgl. besonders: Ebd., S. 461.145 Vgl.: Ebd., S. 454.
146 BARKAI: Wirtschaftssystem, S. 47.
147 Ebd., S. 48.
148 NEEBE: Großindustrie, Staat und NSDAP; S. 152.
149 Ebd., S. 148ff.
150 Ebd., S. 145f.
151 Vgl.: MOMMSEN: Aufstieg und Niedergang, S. 643.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine Analyse der Entwicklung der Wirtschaftspolitik der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) von 1920 bis 1933, insbesondere im Hinblick auf die Annäherung der Partei an die deutsche Großindustrie. Es untersucht das Parteiprogramm von 1920, den Programmentwurf Strassers von 1926, die Denkschrift „Der Weg zum Wiederaufstieg“ von 1927, und die Kontakte zwischen der NSDAP und der Großindustrie. Die Arbeit konzentriert sich auf den parteiinternen Richtungsstreit zwischen einem „sozialistischen“ und einem „kapitalistischen“ Lager und die Rolle der Großindustrie bei der Machtergreifung Hitlers.
Welche These wird in diesem Dokument vertreten?
Die These ist, dass die Entwicklung der wirtschaftspolitischen Vorstellungen der NSDAP von einem parteiinternen Richtungsstreit zwischen einem „sozialistischen“ Lager (Strasser-Flügel) und einem „kapitalistischen“ Lager (Hitler-Flügel) geprägt war. Der Strasser-Flügel versuchte, die Arbeiterschaft für die NSDAP zu gewinnen, während Hitler erkannte, dass der Weg zur Macht nur über die Unterstützung der konservativen Eliten, insbesondere der Großindustriellen, zu erreichen war.
Was beinhaltet das Parteiprogramm von 1920?
Das Parteiprogramm von 1920 war eine Ansammlung von allgemeinen Parolen, die wenig geeignet waren, konkrete politische Entscheidungsprogramme abzuleiten. Es enthielt wirtschaftspolitische Forderungen, die teilweise von einer „sozialistischen“ Tendenz angehaucht waren, aber in den Forderungen, die den Mittelstand ansprechen sollten, ihre Grenzen fanden. Zu den Forderungen gehörten die "Brechung der Zinsknechtschaft", die Einziehung der Kriegsgewinne, die Todesstrafe für "Wucherer und Schieber", die Schaffung eines Gesetzes zur unentgeltlichen Enteignung von Boden für gemeinnützige Zwecke und die Gewinnbeteiligung an Großbetrieben.
Was war der Programmentwurf Strassers von 1926?
Der Programmentwurf von Gregor Strasser von 1926 war ein Versuch, die Parteiprogrammatik der NSDAP stärker auf die Arbeiterklasse auszurichten. Er enthielt Forderungen nach der Aufteilung großer Güter in kleine Bauerngüter, der Umwandlung von Betrieben mit über 20 Angestellten in Aktiengesellschaften, und der Zusammenfassung von Betrieben mit unter 20 Beschäftigten in Zwangsinnungen. Der Entwurf wurde von Hitler abgelehnt, da er dessen Führungsanspruch gefährdete und zu programmatischen Streitigkeiten innerhalb der Partei führte.
Was ist die Bedeutung der Denkschrift "Der Weg zum Wiederaufstieg" von 1927?
Die Denkschrift "Der Weg zum Wiederaufstieg" von Adolf Hitler war ein erster Annäherungsversuch an die deutsche Industrie. Hitler betonte, dass die Wirtschaft sich dem Primat der Nation unterzuordnen habe und dass die NSDAP die einzige Bewegung sei, die den "Marxismus" bekämpfen könne. Die Denkschrift wurde an führende Industrielle verteilt, um sie über die politischen Zielsetzungen der NSDAP zu informieren.
Wie gestaltete sich die Annäherung zwischen der NSDAP und der Großindustrie?
Die Annäherung zwischen der NSDAP und der Großindustrie gestaltete sich durch die Gründung der "Wirtschaftspolitischen Abteilung" (WPA), die Veröffentlichung des "Wirtschaftlichen Sofortprogramms" und des "Wirtschaftlichen Aufbauprogramms", sowie durch persönliche Kontakte zwischen NSDAP-Funktionären und Wirtschaftsvertretern. Die Großindustrie war jedoch gespalten, wobei einige Teile die NSDAP unterstützten und andere skeptisch blieben.
Was war das "Wirtschaftliche Sofortprogramm der NSDAP"?
Das "Wirtschaftliche Sofortprogramm der NSDAP", vorgestellt von Gregor Strasser, war ein Versuch, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die Arbeiterschaft für die NSDAP zu gewinnen. Es enthielt Forderungen nach staatlichen Investitionen in Infrastrukturprojekte, Förderung der Landwirtschaft und staatlicher Kontrolle der Preise, Löhne und Investitionen. Das Programm stieß jedoch auf Kritik bei den industriellen Verbänden und wurde später durch das "Wirtschaftliche Aufbauprogramm" ersetzt.
Was war das "Wirtschaftliche Aufbauprogramm der NSDAP"?
Das "Wirtschaftliche Aufbauprogramm der NSDAP", ausgearbeitet von Walter Funk und Gottfried Feder, war ein Versuch, die Kritik der Industriellen am "Sofortprogramm" zu berücksichtigen. Die antikapitalistische Rhetorik wurde entfernt, der Export wurde als unentbehrlich bezeichnet, und von Preis- und Investitionskontrollen war keine Rede mehr. Das Programm spiegelte die Interessen der Gruppen wider, die die NSDAP zu diesem Zeitpunkt umwarb.
Welche Rolle spielte die Großindustrie bei der Machtergreifung Hitlers?
Die Großindustrie spielte eine ambivalente Rolle bei der Machtergreifung Hitlers. Einige Teile der westlichen Schwerindustrie unterstützten Hitler, während andere skeptisch blieben. Es waren jedoch Teile der westlichen Schwerindustrie zusammen mit anderen konservativen Kreisen, die Hitler zum Kanzler gemacht haben. Die Machtübernahme durch Hitler erklärt sich aus der Bereitschaft der konservativen politischen Elite der Weimarer Republik, das parlamentarische System abzuschaffen und zur Erreichung dieses Ziels sogar die Kanzlerschaft eines politischen Hasardeurs wie Hitler zu akzeptieren.
- Quote paper
- Kai Buchholz (Author), 2001, Das Wirtschaftsprogramm der NSDAP und das Verhältnis der Industrie zum Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107394