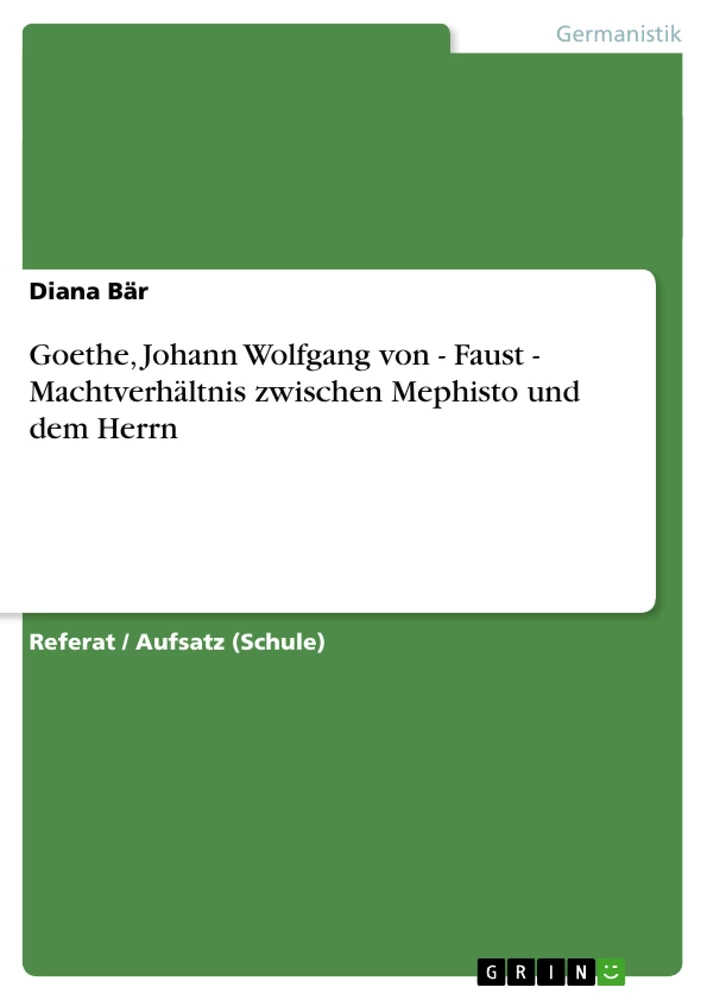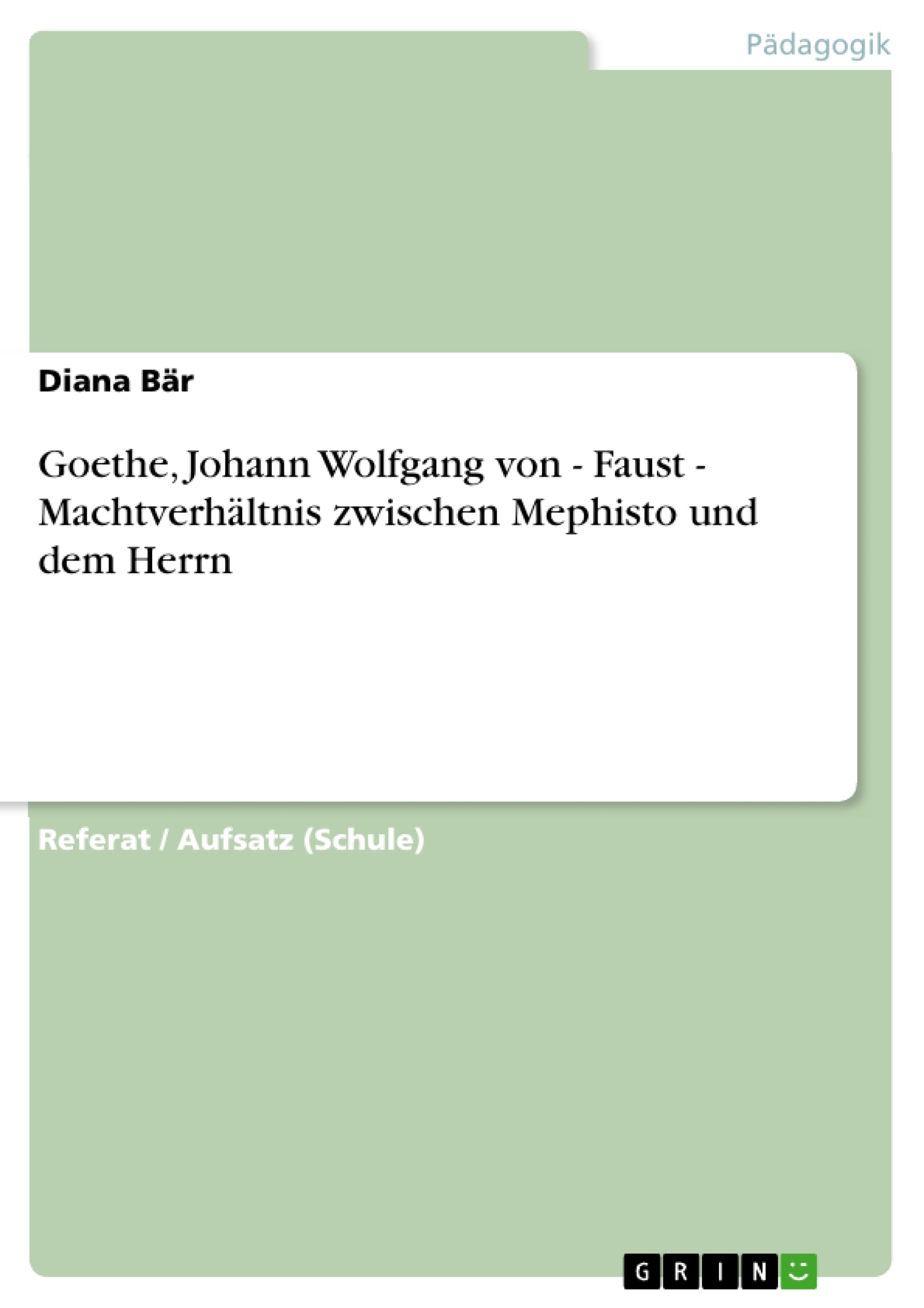Was wäre, wenn das Böse nicht eine dem Göttlichen entgegengesetzte Macht wäre, sondern ein notwendiger Bestandteil des göttlichen Plans? Tauchen Sie ein in eine faszinierende Analyse von Goethes „Faust“, die das traditionelle Weltbild von Gott und Teufel auf den Kopf stellt. Diese tiefgründige Untersuchung des Machtverhältnisses zwischen dem Herrn und Mephistopheles enthüllt eine überraschende Hierarchie und eine unerwartete Abhängigkeit. Entdecken Sie, wie Goethe den Teufel nicht als gleichwertigen Gegenspieler Gottes darstellt, sondern als ein Werkzeug, das dazu dient, den Menschen zu prüfen und seinen Lebensweg herauszufordern. Erfahren Sie, wie Mephisto, obwohl dem Herrn unterworfen, eine entscheidende Rolle im göttlichen Weltbild spielt, indem er den Menschen zur Aktivität anspornt und ihn vor der Ruhe bewahrt. Diese Analyse beleuchtet Mephistos innere Zerrissenheit, seinen Respekt vor dem Herrn und seinen verzweifelten Versuch, durch eine Wette mit Gott eine Art von Gleichwertigkeit zu erlangen. Verfolgen Sie, wie diese Wette den Ausgang des Dramas beeinflusst und die Frage aufwirft, ob der Mensch tatsächlich frei ist, seinen eigenen Weg zu wählen. Lassen Sie sich von Goethes genialer Neudefinition des Verhältnisses zwischen Gut und Böse fesseln und erleben Sie, wie er seinem Meisterwerk „Faust“ eine unerwartete Tiefe und Spannung verleiht. Diese Interpretation bietet neue Einblicke in die Charaktere von Mephisto und dem Herrn und zeigt, dass das Böse oft nur ein missverstandener Diener des Guten ist. Eine Pflichtlektüre für alle, die sich für Literatur, Philosophie und die ewige Frage nach dem Ursprung und der Bedeutung des Bösen interessieren. Entdecken Sie die verborgenen Schichten von Goethes Faust und gewinnen Sie ein neues Verständnis für die komplexen Beziehungen zwischen den göttlichen und dämonischen Kräften, die unser Leben bestimmen. Diese Analyse ist ein Muss für jeden Goethe-Liebhaber und für alle, die sich mit den großen Fragen der Menschheit auseinandersetzen wollen. Tauchen Sie ein in die Welt von Faust und entdecken Sie die Wahrheit hinter dem Mythos von Gott und Teufel. Erleben Sie, wie Goethe die Grenzen des traditionellen Denkens sprengt und uns dazu anregt, unsere eigenen Überzeugungen zu hinterfragen.
Das Machtverhältnis zwischen Mephistopheles und dem Herrn
1. Das allgemeine Weltbild - Zum Verhältnis zwischen Teufel und Gott
Im allgemeinen Weltbild sind Gott und Teufel immer als zwei rivalisierende Urmächte charakterisiert worden. So sind Hölle und Himmel auch durch örtlich unterschiedliche Pole gekennzeichnet. Das allgemeine Weltbild kennt den Kampf zwischen Gott und dem Teufel um die Seelen der Menschen - der Gute, der Rechtschaffene, der von Gott geleitete erhält als Belohnung für seinen Lebensweg und sein Lebenswerk den Platz im „Himmel“. Dabei befindet sich der Mensch auf seinem Lebensweg grundsätzlich in der Position der Versuchung - der Teufel verführt den Menschen, er lockt mit süßen Versprechungen auf ein erfülltes, genussreiches Leben im Hier und Jetzt.
Dabei befinden sich Gott und Teufel als zwei Mächte auch auf einer hierarchischen Ebene, jedoch mit für den Menschen unterschiedlichen Bedeutungen - der Teufel stellt das Böse dar, mächtig, versuchend, jedoch häufig der göttlichen Kraft unterliegend. Gott scheitert nicht in seinen Bemühungen, der Mensch scheitert, die von Gott angebotene Existenz in der Unsterblichkeit wahrzunehmen und sein Leben daran auszurichten.
2. Goethes Weltbild - Zum Verhältnis zwischen Mephistopheles und dem Herrn
Goethe hat jedoch in seinem „Faust“ eine ganz neue Definition des Machtverhältnisses dargelegt.
In der Szene „Prolog im Himmel“, die das erste und einzige Zusammentreffen von Gott und Mephisto darstellt, wird eine klare Aussage über das Machtverhältnis der beiden dargelegt.
Mephisto ist nur ein Teil der Schöpfung Gottes, da er selbst zugibt nur ein Teil des Teils
(Z.1349) zu sein. Auch als Mephisto zum ersten Mal auf Faust trifft und dieser Mephisto fragt, wer er sei, bekommt Faust die Antwort, Mephisto sei ein Teil von jener Kraft, Die stets das Böse will und stets das Gute schafft
(Z.1335).
Mit dieser Selbstcharakterisierung gesteht sich Mephisto ein, in der göttlichen Weltordnung lediglich ein Teil der Schöpfung Gottes zu sein. Jedoch realisiert er auch, dass er eine notwendige, produktive Funktion im Weltplan besitzt:
Seine Funktion ist es, für den Herrn zu arbeiten und zu schaffen, wie es der Herr selbst im Prolog im Himmel sagt: Des Menschen Tätigkeit kann nur allzu leicht erschlaffen, er liebt sich bald die unbedingte Ruh, Drum geb’ ich gern ihm den Gesellen zu, Der reizt und wirkt und muß als Teufel schaffen
(Z.340 - 343).
Damit wird belegt, dass der Herr den Teufel erschuf, um des Menschen Tätigkeit anzuregen. Mephisto wird benötigt, um das Leben des Menschen auf der Erde aufzureizen. Die Bedeutung dieses „Aufreizens“ kann im folgenden nur vermutet werden. So ist anzunehmen, dass der Mensch durchaus von Gott, von Gottes Vasall, Mephistopheles, versucht werden soll. So ist das durchaus eine besondere Deutung des allgemeinen Weltbildes. Im allgemeinen Weltbild stellt die Versuchung des Teufels eine dem göttlichen entgegengestellte Macht dar, die den Menschen von seinem Lebensweg abbringt. Das Faustsche Gottesbild stellt diese Versuchungen als auch von Gott beabsichtigt dar. Der Mensch hat diesen Versuchungen zu widerstehen - er wird geprüft.
Durch diese notwendige Funktion Mephistos besteht eine Gebundenheit zwischen den beiden Charakteren. Der Herr benötigt Mephisto um das Leben der Menschen „aufzureizen“, und Mephisto benötigt den Herrn, um die Erlaubnis für diese Tätigkeiten zu erlangen. Wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, ihn meine Straße sacht zu führen
(Z.313-314).
Daraus ist eine klare Hierarchie zu erkennen: Mephisto ist dem Herrn unterworfen und muss ihn um Erlaubnis bitten, der Herr jedoch entscheidet über die Prüfungen des Menschen.
Mephisto selbst hat großen Respekt vor dem Herrn und hütet sich mit ihm zu brechen
(Z. 351).
Obwohl es zeitweise den Anschein hat, dass Mephisto sich seine Unterwürfigkeit nicht eingestehen will, da er teilweise sehr überheblich und naiv reagiert, erkennt man doch, dass er sich selbst als begrenzt wahrnimmt.
Gegenüber Faust muss er seine Unterlegenheit dem Herrn gegenüber öfter eingestehen.
Zum Beispiel versagen seine Kräfte, als Faust ihn bittet Gretchen Gefühle für ihn empfinden zu lassen. Doch gibt er das nicht zu, sondern versucht Faust hinzuhalten und vertröstet ihn. Ich sag’ Euch: mit dem schönen Kind Geht’s ein für allemal nicht geschwind.
(Z.2655-2656). Auch am Ende des Stücks, als Faust Mephisto befiehlt Gretchen sofort aus dem Kerker zu befreien, gesteht Mephisto seine Schwäche offen ein: Ich führe dich, und was ich tun kann höre! Habe ich alle Macht im Himmel und auf Erden? [...] Ich wache! Die Zauberpferde sind bereit, ich entführe euch. Das vermag ich
(S.136 Z.61-66).
Die Frage Habe ich alle Macht auf Erden
sagt deutlich, dass Mephisto weiß, keine Allmacht zu haben, da es eine rhetorische Frage ist, die keiner Antwort mehr bedarf.
Auch erklärt Mephisto Faust, dass selbst er nicht die vollkommene Erkenntnis erwerben kann, da dieses Ganze nur für einen Gott gemacht wurde
(Z.1780-1781).
Mephisto gibt seine Begrenztheit auch gegenüber dem Herrn zu, da er sagt: Von Sonn’ und Welten weiß ich nichts zu sagen.
(Z.279).
Mephisto kann also nur einen Teil der Welt wahrnehmen, jedoch nicht den gesamten Kosmos überschauen.
Auch scheint diese Schwäche Mephisto zu stören, da er Faust gegenüber negative Aussagen darüber macht.
Er findet sich in ew’gen Glanze, Uns hat er in die Finsternis gebracht
(Z.1782-1783) Mephisto empfindet sich mit den Menschen auf der Erde gleichgestellt und es stört ihn, dass der Herr über allem steht.
Doch trotz dieser unterwürfigen Position fordert Mephisto den Herrn zu einer Wette auf. Er möchte sich Faust annehmen und ihn vom richtigen Weg abbringen: Was wettet ihr, den sollt ich noch verlieren
(Z.312). Denn Mephisto kennt Faust und weiß um seine Schwächen. Aus diesem Wissen heraus fordert Mephisto zur Wette auf. Auch ist er sehr selbstbewusst, denn er behauptet:
Mir ist für meine Wette gar nicht bange.
(Z.331).
Mephisto möchte mit dieser Wette den Herrn als Gegenspieler gewinnen.
Der Herr nutzt diese Chance, um dem Teufel eine Lektion zu erteilen und ihm aufzeigen, wer der Mächtigere ist: Und steh beschämt, wenn du erkennen mußt, Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewußt
(Z.327-329).
Gott selbst hat Faust erschaffen und ist sich deshalb sicher, dass er die Wette gewinnen wird. Deshalb nimmt der Herr die Wette an und lässt Mephisto schaffen.
Durch diese Wette entsteht nun ein exemplarischer Kampf um den Menschen im Allgemeinen. Gott und Mephisto sind sich beide sicher, die Wette zu gewinnen.
3. Auswirkungen auf den Ausgang des Dramas
Diese Wette hat nun Auswirkungen auf den Ausgang des Dramas.
Zunächst wird sich die Wette, die Mephisto Faust anbietet, auf den Ausgang der Tragödie nicht spürbar auswirken. Sie hat lediglich die Funktion Faust zu testen, denn durch die Wette zwischen dem Herrn und Mephisto ist von Anfang an deutlich, dass Mephisto nur im Leben des Faust wirken darf, jedoch nicht nach seinem Tod. Solang’ er auf der Erde lebt, Solange sei dir’s nicht verboten.
(Z.315-316). Der Inhalt der Wette zwischen Faust und Mephisto sagt aus, dass solange Faust am Leben ist Mephisto ihm dienen muss, mit dem Ziel, dass Faust eine vollkommene Zufriedenstellung erlangt. Wenn dies geschehen ist, dann muss Faust Mephisto im Jenseits auf ewig dienen.
Doch durch die Zusage des Herrn an Faust So werd’ ich ihn bald in die Klarheit führen
(Z.309), ist von Anfang an klar, dass Faust nie die Möglichkeit dazu haben wird, da er nach seinem Tod wieder in die Obhut des Herrn fällt. Jedoch hat die Wette Mephistos mit dem Herrn Auswirkungen. Aufgrund dieser Wette schreitet der Herr am Ende der Tragödie nicht ein und hält Faust zurück mit Mephisto mitzugehen. Denn der Inhalt der Wette sagt aus, dass solange Faust lebt Mephisto wirken darf wie er möchte und da Faust am Ende lebendig ist, darf bzw. will der Herr sich nicht einschalten.
4. Zusammenfassende Bemerkungen: Allgemeines Weltbild und Goethes Auslegung
Im allgemeinen ist zu sagen, dass man in dem Stück „Faust“ das Machtverhältnis zwischen Mephisto und dem Herrn ganz klar bestimmen kann. Es besteht eine klare Unterwürfigkeit Mephistos dem Herrn gegenüber. Goethe hat den Teufel nicht als gleichwertige Urmacht dem Herrn gegenübergestellt, jedoch Mephisto eine ganz klare eigenständige Funktion zugesprochen. So erhält man während des Stücks teilweise doch den Anschein einen gleichwertigen Kampf um Faust beizuwohnen. Man erkennt Stärken bei Mephisto, die man nicht vermutet hätte, da dieser am Anfang nur als Teil der Schöpfung Gottes und als unterlegener Diener des Herrn dargestellt wird.
Man erhält während der Szene „Prolog im Himmel“ den Anschein, den Ausgang der Tragödie vorhersehen zu können, was jedoch durch die Stärke die Mephisto im Laufe der Geschichte zeigt, ins Schwanken gerät.
Doch denke ich Goethe hat eine gute und interessante Neudefinition des Machtverhältnisses zwischen Gott und dem Teufel dargestellt und damit seinem Werk „Faust“ einen spannenden, nicht immer eindeutigen Verlauf verliehen.
Quellenverzeichnis
Primärquelle:
- GOETHE, J.W.: Faust - der Tragödie erster Teil. Ernst Klett Verlag: Stuttgart 1981
Sekundärquellen:
- KOMP, A.: Johann Wolfgang Geothe-Faust I-Inhalt-Hintergrund-Interpretation. Mentor: München 1996
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das allgemeine Weltbild bezüglich des Verhältnisses zwischen Teufel und Gott?
Im allgemeinen Weltbild werden Gott und Teufel als rivalisierende Urmächte dargestellt, wobei Himmel und Hölle örtlich getrennte Pole sind. Es gibt einen Kampf um die Seelen der Menschen, wobei der Teufel versucht, den Menschen von Gott abzubringen.
- Wie definiert Goethe das Machtverhältnis zwischen Mephistopheles und dem Herrn im "Faust"?
Goethe stellt Mephisto als einen Teil der Schöpfung Gottes dar, der eine notwendige Funktion im göttlichen Plan hat. Mephisto dient dazu, die Tätigkeit des Menschen anzuregen, indem er ihn versucht.
- Welche Rolle spielt Mephisto im Weltplan nach Goethes Interpretation?
Mephisto ist dafür da, das Leben der Menschen "aufzureizen", sie zu versuchen. Dies wird von Gott beabsichtigt, um den Menschen zu prüfen.
- In welcher Beziehung stehen Mephisto und der Herr zueinander?
Mephisto ist dem Herrn unterworfen und benötigt dessen Erlaubnis für seine Tätigkeiten. Der Herr hat Mephisto erschaffen, um die Tätigkeit des Menschen anzuregen.
- Welchen Respekt hat Mephisto vor dem Herrn?
Mephisto hat großen Respekt vor dem Herrn und hütet sich, mit ihm zu brechen.
- Inwiefern gesteht Mephisto seine Unterlegenheit gegenüber dem Herrn ein?
Mephisto gesteht, dass seine Kräfte begrenzt sind und dass er nicht die vollkommene Erkenntnis erlangen kann. Er kann auch nicht den gesamten Kosmos überschauen.
- Welche Wette schlägt Mephisto dem Herrn vor?
Mephisto wettet mit dem Herrn, dass er Faust vom rechten Weg abbringen kann.
- Welche Auswirkungen hat diese Wette auf den Ausgang des Dramas?
Die Wette dient dazu, Faust zu testen. Mephisto darf im Leben von Faust wirken, jedoch nicht nach dessen Tod. Die Zusage des Herrn, Faust in die Klarheit zu führen, macht von Anfang an deutlich, dass Faust nie Mephistos Diener im Jenseits sein wird.
- Was ist das Fazit des Machtverhältnisses zwischen Mephisto und dem Herrn im "Faust"?
Es besteht eine klare Unterwürfigkeit Mephistos dem Herrn gegenüber. Goethe hat Mephisto jedoch eine eigenständige Funktion zugesprochen, wodurch der Kampf um Faust zeitweise gleichwertig erscheint.
- Welche Quellen werden in der Analyse verwendet?
Als Primärquelle wird "GOETHE, J.W.: Faust - der Tragödie erster Teil" verwendet. Sekundärquellen sind "KOMP, A.: Johann Wolfgang Geothe-Faust I-Inhalt-Hintergrund-Interpretation" und "SUDAU, R.: Johann Wolfgang Goethe-FaustI und FaustII-Oldenbourg Interpretationen".
- Quote paper
- Diana Bär (Author), 2001, Goethe, Johann Wolfgang von - Faust - Machtverhältnis zwischen Mephisto und dem Herrn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107357