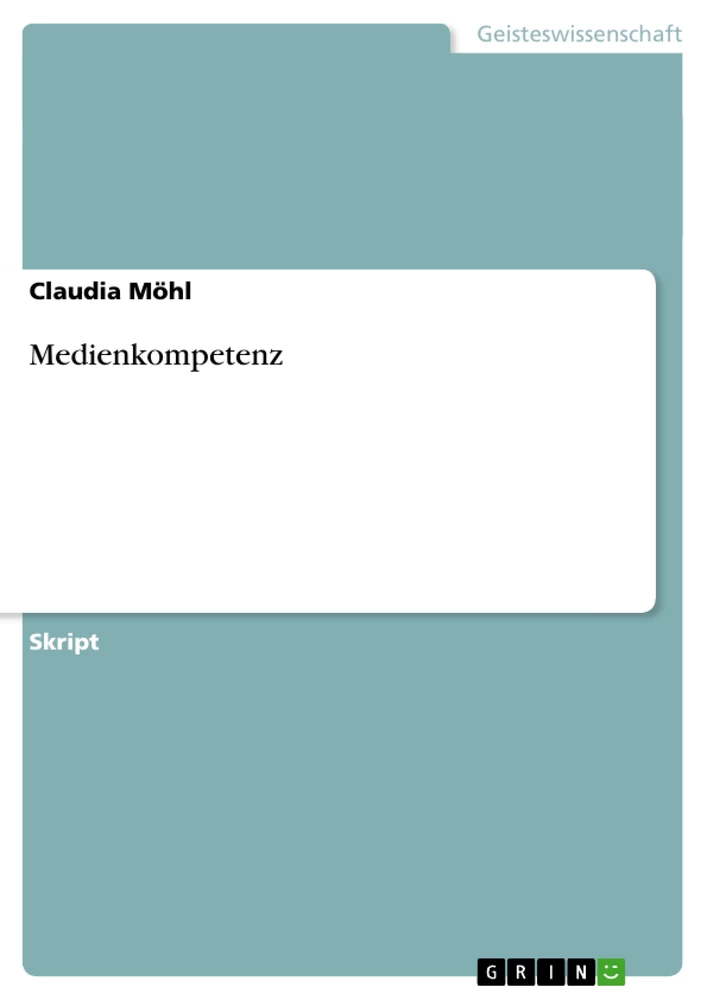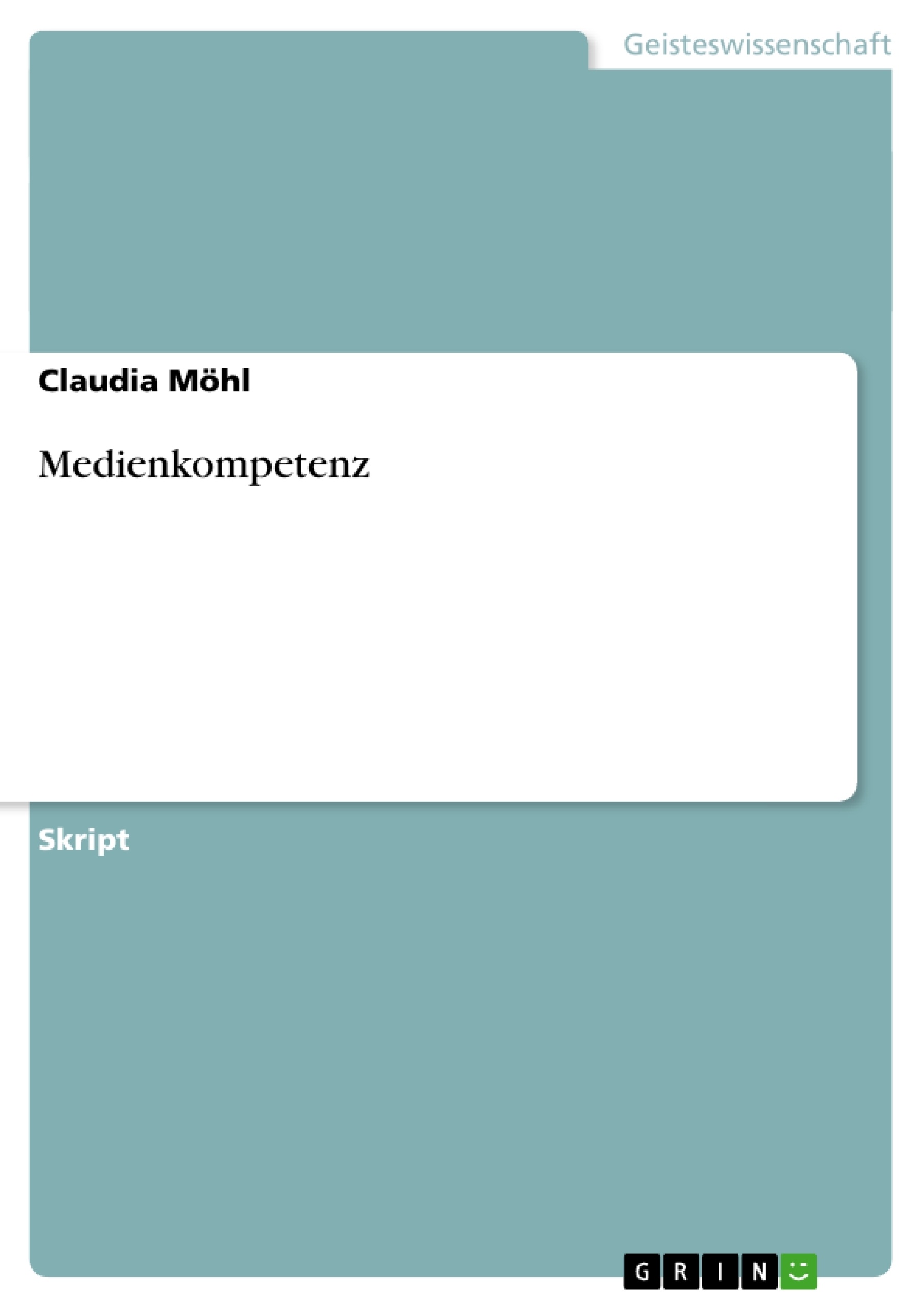In dieser Ausarbeitung soll es um die Frage gehen: „Kann das Internet Medienkompetenz vermitteln?“ Da Medienkompetenz jedoch ein sehr weiter Begriff (genaue Definition folgt noch) ist, geht es hier im speziellen um „politikorientierte Medienkompetenz“. Am Beispiel der FDP-Seite1 aus dem Internet werde ich versuchen das beschriebene zu beweisen oder zu widerlegen.
Im Jahr 1996 war der Begriff ‚Medienkompetenz’ das Wort des Jahres. Doch schon in den 60er und 70er Jahren befasste sich die Sozialwissenschaft mit dem Begriff der Kompetenzbildung. Bis Ende der 60er Jahre hatte er eine vorwiegend kontrollierende Orientierung, ausgerichtet auf den Schutz vor den Gefahren der „Neuen Medien2“. In den 70er Jahren tauchte der Begriff der Medienkompetenz konkret erstmals in der Habilitationsschrift von Dieter Baacke (1973) über „Kommunikation und Kompetenz – Grundlegung einer Didaktik der Kommunikation und der Medien“. Von nun an richtet die Medienpädagogik ihren Blick auch auf die Bedürfnisse und Interessen der Mediennutzer, die nicht bloß als passive Opfer der Medien gesehen werden, sondern auch ihre Mediennutzung aktiv und innerhalb gewisser Grenzen selbstbestimmt steuern. Begriffsgeschichtlich stammt der Kompetenzbegriff aus der Biologie und bezeichnet eine zeitlich begrenzte Bereitschaft embryonaler Zellen, auf einen bestimmten Entwicklungsreiz
zu reagieren. Diese enge biologische Definition wird in der sozialwissenschaftlichen, zunächst linguistischen Rezeption erheblich ausgeweitet.
Inhaltsverzeichnis
1. Geschichtlicher Exkurs
2. Der Versuch einer Definition der Medienkompetenz
3. Der Weg zur Medienkompetenz
4. Die 4 Dimensionen der Medienkompetenz nach Dieter Baacke
5. Sozial kulturelle Handlungskompetenz und Identität
6. Medienkompetenz in der Politikdidaktik und politischen Bildung
7. Bürgerleitbilder
7.1. Der politisch Desinteressierte
7.2. Der informierte und urteilsfähige Zuschauer
7.3. Der interventionsfähige Bürger
7.4. Der Aktivbürger
8. Politikorientierte Medienkompetenz
8.1. Der „Medienbourgeois“
8.2. Der „informierte Bürger“ - normatives Minimum demokratischer Bürgerrollen
8.3. Der „medienmündige“ Bürger
9. Medienkompetenz am Beispiel der FDP
In dieser Ausarbeitung soll es um die Frage gehen: „Kann das Internet Medienkompetenz vermitteln?“ Da Medienkompetenz jedoch ein sehr weiter Begriff (genaue Definition folgt noch) ist, geht es hier im speziellen um „politikorientierte Medienkompetenz“. Am Beispiel der FDP-Seite1 aus dem Internet werde ich versuchen das beschriebene zu beweisen oder zu widerlegen.
Im Jahr 1996 war der Begriff ‚Medienkompetenz’ das Wort des Jahres. Doch schon in den 60er und 70er Jahren befasste sich die Sozialwissenschaft mit dem Begriff der Kompetenzbildung. Bis Ende der 60er Jahre hatte er eine vorwiegend kontrollierende Orientierung, ausgerichtet auf den Schutz vor den Gefahren der „Neuen Medien2 “. In den 70er Jahren tauchte der Begriff der Medienkompetenz konkret erstmals in der Habilitationsschrift von Dieter Baacke (1973) über „Kommunikation und Kompetenz - Grundlegung einer Didaktik der Kommunikation und der Medien“. Von nun an richtet die Medienpädagogik ihren Blick auch auf die Bedürfnisse und Interessen der Mediennutzer, die nicht bloßals passive Opfer der Medien gesehen werden, sondern auch ihre Mediennutzung aktiv und innerhalb gewisser Grenzen selbstbestimmt steuern.
Begriffsgeschichtlich stammt der Kompetenzbegriff aus der Biologie und bezeichnet eine zeitlich begrenzte Bereitschaft embryonaler Zellen, auf einen bestimmten Entwicklungsreiz zu reagieren. Diese enge biologische Definition wird in der sozialwissenschaftlichen, zunächst linguistischen Rezeption erheblich ausgeweitet.
Aufenanger formulierte es wie folgt:
„Während im Industriezeitalter Dinge, also Atome und Moleküle, produziert wurden, geht es heute um Bits und Bytes.“
Womit er meint, dass ‚Wissen’ an sich als Produktionsfaktor immer wichtiger wird.
Gleichzeitig aber auch die Wissensvermittlung durch mediale Kommunikation, die Aneignung von Wissen als lebenslange Aufgabe sowie die Globalisierung von Wissen.
Medienkompetenz ist die Fähigkeit, „die Medien und Techniken, die gesellschaftliche Kommunikation unterstützen, steuern und tragen, erstens zu begreifen, zweitens sinnvoll damit umzugehen und drittens sie selbstbestimmt zu nutzen“. (Theunert 1996:62) Die Medienpädagogik3 beschäftigt sich mit dem Weg, auf dem Medienkompetenz erreicht werden soll. Doch ist man sich noch nicht darüber im Klaren, ob über den Weg der Medienerziehung oder den der Medienbildung. Medienkompetenz geht aber über institutionelles und zielorientiertes begrenztes Denken hinaus, weil ‚Kompetenz’ Erziehung und Bildung ist, womit sie auch nur über einen Weg erreichbar ist, der beide (Erziehung und Bildung) einschließt, aufeinander verweißt und trotzdem klar voneinander unterscheidet. Erziehung sieht die pädagogisch-professionellen Handlungsakte in systematischen Zielkontexten. Während Bildung mehr subjekttheoretisch verwendet wird, das ‚Ich’ durch ‚Handlungsakte’ beeinflusst werden kann, aber letztlich unverfügbar bleibt, so dass dem zu Bildenden zwar Bildungsgelegenheiten geschaffen werden können, er aber nicht zum Objekt sicheren Gelingens bestimmt werden kann. Diese Bildungsgelegenheiten sind auch als Bereitstellung von kulturellen Lebensräumen zusehen, in denen sich das jeweilige Individuum selbstverwirklichen kann.
Nach Dieter Baacke hat Medienkompetenz 4 Dimensionen4: Medienkritik und Medienkunde zur Vermittlung von Wissen, also didaktische Fragen, sowie Mediennutzung und Mediengestaltung als Zielorientierung.
Alle vier zusammen sollen den Nutzer befähigen sich in dieser computerisierten Medienwelt5 (Fortschritt wird nur noch über elektronische Technologien erreicht) zurechtzufinden und die neue Möglichkeiten der Informationsverarbeitung souverän handhaben zu können. Medienkritik ist die Grundlage für alle weiteren Operationen bezüglich Medienkompetenz.
Sie ist die
edukative Dimension der pädagogischen Verantwortung als reflexive Rückbesinnung auf das, was über sozialen Wandel lebensweltlich und medienweltlich geschieht.
Dass heißt, analytisch sollten problematische gesellschaftliche Prozesse angemessen erfasst werden können. Jeder Mensch sollte reflexiv in der Lage sein das analytische Wissen auf sich selbst und sein Handeln anwenden können. Und Drittens sein analytisches Denken und seinen reflexiven Rückbezug sozial (ethisch) verantwortet abstimmt und definiert.
Medienkunde ist das Wissen und der Wissenserwerb über heutige Medien und Mediensysteme. Sie ist
die instrumentell-qualifikatorische (die Geräte benutzen / bedienen zu können) und die informative (klassische Wissensbestände, wie z. B. Rundfunksysteme, Bücher, usw.) Fähigkeit.
Mediennutzung geschieht entweder rezeptiv anwendend, zum Beispiel ProgrammNutzungskompetenz
oder interaktiv anbietend wie Online-Banking, Tele-Shopping. In diesen Bereich geht im Unterschied zur instrumentell-qualifikatorischen Dimensionierung auch die Zielorientierung ein.
Mediengestaltung ist die innovative und kreative Dimension. Durch sie entwickelt sich das Mediensystem innerhalb der angelegten Logik weiter und sie betont den ästhetischen Aspekt.
Durch diese 4 Dimensionen6 wird klar, das Medienkompetenz nur und ausschließlich über Projektarbeit umzusetzen ist. Weiterhin geben sie keine inhaltlichen Vorgaben noch didaktische oder methodische Hilfen, um das, was „Medienkompetenz“ meint, angemessen in die Lern- und Lebenspraxis von Schülern / Schülerinnen und Erwachsenen umzusetzen.
Dieter Baacke meinte zu seiner Definition der Medienkompetenz und deren Schwächen selber:
„Die stärkste, vielleicht auch am leichtesten zu behebende besteht darin, dass er weit und darum auch empirich ‚leer’ bleibt. Wie ‚Medienkompetenz’ im einzelnen aussehen soll, welche Reichweite das Konzept hat, dies alles sagt der Begriff selbst nicht, und auch seine theoretischen Hintergründe malen dies nicht aus.“ (Baacke 1996a, S. 119)
Jedoch kann man sie auch als Entwicklungschance sehen und deuten. Medienkompetenz ist also als Chance das schulische und außerschulische Lernen zu verändern und zu befreien sowie als sozial kulturelle Handlungskompetenz zu sehen.
Ziel ist es, dass die Subjekte ihre Beziehungen untereinander regeln sowie ihr Verhältnis zur Gesellschaft und damit zur Kultur, für die Entwicklung und Ausbildung von Subjektivität und Identität, organisieren. Kommunikative Kompetenz ist demnach die Fähigkeit der Menschen verstehbare sprachliche Äußerungen zu produzieren und ihren Sinn entsprechend aufzunehmen. Sie ist folglich erlernbar und eröffnet die Möglichkeit der Teilnahme am gesellschaftlichen Kommunikationsprozess. Doch muss hierbei beachtet werden, dass nur Menschen handlungskompetent sein können, nicht aber die Medien selber. Abhängig von den alltäglichen Handlungssituationen werden dementsprechend unterschiedliche Medienkompetenzen zur Situationsbewältigung benötigt.
In der heutigen Mediengesellschaft spielen die Medien bei der Identitätsbildung eine wichtige Rolle, da die Identität eines Subjektes durch soziale und mediale Interaktionen entwickelt wird. Auch über die symbolischen Welten der Medientexte während der Medienrezeption und -aneignung werden Selbstbild und Identität ausgebildet. Vorbilder sind daher nicht mehr nur aus de direkten sozialen Umgebung, sondern auch aus den Erzählungen der Medien und Populärkultur. Insbesondere Medienhelden erlangen bei Kindern und Jugendlichen große Bedeutung. Sie orientieren oder grenzen sich von ihnen ab. Identitätsarbeit anhand medialer Texte ist folglich zu einer Notwendigkeit in einer sich immer weiter ausdifferenzierenden Gesellschaft geworden, da allein die Medien nur noch zwischen den verschiedenen Lebensbereichen vermitteln können. Es geht nicht mehr allein um kognitive, reflexive Fähigkeiten, ,eben diese Lebenssituationen und jeweilige Handlungssituationen verstehend zu interpretieren, sondern auch um emotionale und intuitive Fähigkeiten der Situationseinschätzung zur Lebensbewältigung und Beziehungsregulierung, die im Verlauf der Sozialisation und Persönlichkeitsbildung erworben werden.
In welcher Beziehung Medienkompetenz aber nun zu Bürgerleitbildern und zur politischen Bildung steht, habe ich bisher noch nicht einmal in Ansätzen geklärt. Dazu ist die These, dass Medienkompetenz als Grundqualifikation der allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zur eigenständigen Wirklichkeitserschließung und -auseinandersetzung als Spezifikum politischer Bildungsarbeit nicht genügen kann, Ausgangspunkt. (So Sarcinelli 2000:35.)
Auf die Frage, wie junge Menschen auf eine Welt vorzubereiten sind, in denen Medien wie zu keiner Zeit vorher die individuellen Lebensbedingungen, das gesellschaftliche Zusammenleben und auch das politische Handeln verändern, finden sich in der politischen Bildung und in der Politikdidaktik unterschiedliche Antworten.
Die Theoretiker und Praktiker der politischen Bildung sind ähnlich wie die Pädagogen und Intellektuellen überhaupt, meist schriftsprachlich sozialisiert und als „gebildete Menschen“ neigen sie dazu, das „gute Buch“, „die Zeitung“ als wertvolles Medium den Medien Fernsehen oder Computer gegenüberzustellen. Ihrer Meinung nach kann das Interesse für Politik nicht ohne weiters vorausgesetzt werden. Es muss vielmehr erst hervorgerufen werden. Dann muss die Bereitschaft, sich mithilfe der Medien zu informieren, geweckt und die Fertigkeit dazu geübt werden. Es ist klar, dass hierzu auch die Fähigkeit zur kritischen Medienanalyse gehört. In der politischen Bildung ist „Lesen“ die wichtigste Barriere gegen die Manipulierbarkeit des demokratischen Staatsbürger durch das Fernsehen und Internet. Die allgemeinpädagogische Sichtweise von Medienkompetenz in der Politikdidaktik kann das spezifische einer politikorientierten Medienkompetenz nicht deutlich machen und die traditionelle Sichtweise, dass der Politikunterricht Jugendliche zu Zeitungslesern mit kritischem Verstand heranziehen soll, reicht heute nicht mehr aus um Demokratie zu verstehen. Die repräsentative Demokratie hat sich zur Mediendemokratie weiterentwickelt, ohne dass die damit einhergehende Veränderung des Politischen ausreichend erkannt und reflektiert worden ist. Politische Wirklichkeit wird durch Interpretationen hergestellt und die Vermittler dieser Interpretationen sind die Medien.
„Politik ist für sie, was in den Medien als Politik geschieht, erscheint und vermittelt wird, deren mediale Inszenierung steht zum Teil für die Wirklichkeit der politischen Willensbildung. Was in dieser Inszenierung nicht vorkommt, existiert politisch kaum, und was vorkommt, existiert in dieser inszenierten Weise.“ (Greven 1999:212)
So wichtig die Medien (egal ob Zeitung / Bücher oder TV / www) bei der Konstruktion politischer Wirklichkeit auch sein mögen, vernachlässigen doch beide Ansätze vor allem die Bedeutung des Anteils interpersonaler Kommunikation.
Dennoch, für die Bürger findet Politik ganz überwiegend medial vermittelt statt. Was nicht in der Zeitung stand, was nicht im Fernsehen war, ist für sie nicht wahr. Daraus folgt, was in der „modernen Mediengesellschaft“ noch Teilnahme oder Teilhabe an der Politik, am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess heißen kann. Nach Sarcinelli bedeutet das auch Teilnahme und Teilhabe am medialen Geschehen. Hieraus erschließt sich die Frage nach den minimalen Kompetenzen, die der Bürger benötigt, um über die Teilhabe am „medialen Geschehen“ auch an der Politik in der mediendominierten Demokratie teilhaben zu können.
Deswegen hat der Bürger mit bestimmten Bürgerqualifikationen und Bürgertugenden auch wieder in der Politikdidaktik und der politischen Bildung an Bedeutung gewonnen. Die FDP formuliert es in ihrem Wahlkampfprogramm „Strategie 18 %“ wie folgt:
„Die FDP wendet sich an alle Frauen und Männer, die mehr Freiheit wollen, die bereit sind, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, und die staatliche Bevormundung ablehnen.
Die Parteienlandschaft ist im Umbruch. Die Orientierung an Prozentzahlen verdeckt nur, was die absoluten Stimmenzahlen offen legen.
Die Zeit der Volksparteien mit ihrer Bindung der Bürger an Milieus, Berufe oder Konfessionen ist vorbei. Die Bürger sind unabhängiger und selbstbewusster. Die Volksparteien mobilisieren kein Volk mehr.“
Bei der Formulierung der Ansprüche an und von den Bürgern geht man heute von vier Gruppen aus, die sich in folgenden Bürgerrollen beschreiben lassen.
Der politisch Desinteressierte stellt sicherlich kein Bürgerleitbild im Sinne demokratietheoretischer
Vorstellungen dar. Er ist Bürger vom Rechtsstatus her, aber nicht vom Rollenverständnis der Demokratie. Der Politik schenkt er nur begrenzte Aufmerksamkeit und beteiligt sich nur unregelmäßig oder selten an Wahlen und Abstimmungen. Wenn überhaupt ist er über aktuelle Problemlagen der Politik nur oberflächlich informiert und besitzt ein tiefsitzendes Misstrauen gegenüberpolitischen Eliten. Sein politisches Wissen ist nur fragmentarisch und vorurteilsgeprägt sein politisches Denken. Er will heute dies und morgen jenes und seine Urteilsstandards werden heutiger Komplexität und Kompliziertheit der politischen Angelegenheiten kaum gerecht.
Der informierte und urteilsfähige Zuschauer interessiert sich für Politik und hat soviel Wissen und
Einblick in die Zusammenhänge des politischen Lebens, dass er diese Welt nicht als fremde, seiner Einsicht entzogene betrachtet. Jedoch wird er außerhalb von Wahlen und Abstimmungen selten aktiv. Trotzdem lässt er sich nichts vormachen und ist in der Lage, sich in politischen Zusammenhängen zu orientieren sowie eine eigene begründete Position zu entwickeln.
Das Wissen und die Fähigkeiten des interventionsfähigen Bürgers geht über das des informierten
Zuschauers hinaus. Ihn kennzeichnet das Wissen über die tatsächlich vorhanden Einflusschancen und Beteiligungsmöglichkeiten am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, die Fähigkeit zur rationalen politischen Urteilsbildung und prinzipielle Handlungsbereitschaft aufgrund von kommunikativen, aber auch strategischen und taktischen Fertigkeiten. Er hat soziales Vertrauen zu anderen Menschen, Selbstvertrauen und Selbstachtung, um die mit politischer Aktivität verbunden Belastungen auf sich zu nehmen sowie den Glauben an den eigenen Einfluss.
Bei dem Aktivbürger nimmt das Politische eine hohen Stellenwert ein. Er sieht die politische Beteiligung als seine wichtigste Aufgabe und möchte das politische Geschehen aktiv mitbestimmen. Für ihn ist die Mitgliedschaft und Mitarbeit in Parteien, Interessengruppen, Bürgerinitiativen oder ideellen Vereinigungen selbstverständlich. Aus dieser Gruppe stammt zu meist auch das Führungspersonal eines Gemeinwesens, da er sich am Gemeinsinn orientiert und nicht ausschließlich an seinen Eigeninteressen.
Ausgangspunkt bei dem Versuch bei dem Versuche politikorientierte Medienkompetenzen zu konkretisieren und in einen Zusammenhang mit den genannten Bürgerbildern zu bringen, ist die Aussage Sarcinellis:
„Mehr als jemals zuvor in der Geschichte steht politische Kompetenz in einem funktionellen Zusammenhang mit politisch-medialer Kompetenz. Mehr denn je setzt die Fähigkeit und Bereitschaft zur Teilnahme und Teilhabe an Politik Informiertheit, medienrelevante Artikulationsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit voraus.
Bürgerkompetenz erschöpft sich zwar nicht in Medienkompetenz. Doch ohne Medienkompetenz, verstanden als selbstbestimmte Nutzung der Medien zum Zwecke der - aktiven und passiven - Beteiligung an politischen Angelegenheiten, ist Bürgerkompetenz in der Mediengesellschaft nur halbierte Kompetenz.“ (Sarcinelli 1997: 339)
Dass die Vermittlung folgender Fähigkeiten, die die drei normativen Bürgerrollen unterschiedlich stark prägen, auch, aber nicht allein die Aufgabe politischer Bildung sein kann, dürfte klar sein. Eine politikorientierte Medienkompetenz ist eine auf das Relevanzsystem Politik bezogene allgemeine Medienkompetenz. Als solche ist sie Aufgabe von Schule und von Schulfächern insgesamt, aber auch Resultat allgemeiner Sozialisationsprozesse, an denen die Medien selbst teilhaben. Als politikorientierte Medienkompetenz lässt sie sich nicht isoliert erreichen. Sie ist eher mittelbares Ergebnis politischer Bildung, sofern es dieser gelingt, die zentralen politischen Relevanzsysteme zu vermitteln. Insofern ist politikorientierte Medienkompetenz einerseits Ergebnis eines Mindestmaßes an politischem Wissen im Sinne von Politikbewusstsein, von politischer Urteilsfähigkeit und von politischer Handlungsfähigkeit, andererseits eine deren wichtigsten Voraussetzungen.
Legt man die vier Gruppen von Bürgern zugrunde, dann kommt der politisch Desinteressierte dem
„ Medienbourgeois “ am nächsten. Anders als der politisch Desinteressierte, der der Politik kaum Aufmerksamkeit schenkt, zeigt der Medienbourgeois ein ausgeprägtes Mediennutzungsverhalten, was für ihn auch die häufigste und wichtigste Beschäftigung ist. Als Erwachsener orientiert er sich am Leitmedium Fernsehen und zählt zu den Vielsehern. Das Fernsehen ist für ihn zum „Nebenbei-Medium“ geworden. Als Jugendlicher gehört er in der Regel zu den Multimedia-Rezipienten. Sein Mediennutzungsverhalten ist in allen Bereichen durch starke Unterhaltungsorientierung geprägt und er folgt bereitwillig den „Boulevardisierungstendenzen“ der Anbieter. Das Bedürfnis nach Information spielt eine untergeordnete Rolle, vor allen Dingen, was die Politik betrifft. Falls es doch zur Informationsaufnahme kommt, dann nur als kaum reflektiertes Nebenprodukt des alltäglichen Medienutzungsverhaltens. Hieraus resultiert auch das nicht zusammenhängende und nicht durchorganisierte Wissen. Wodurch seine politische Informiertheit ständig abnimmt. Gerade er ist für die negative Deutung der Politik durch die Medien anfällig , da er weitgehend abgekoppelt und kaum in personale Kommunikationsnetze eingebunden ist und dadurch ohne vermittelnden Puffer personaler Kommunikation erreicht wird.
Er stellt für die Vermittlung politikorientierter Medienkompetenz eine ständige Herausforderung dar. Aus ihm wenigstens im Ansatz einen informierten Bürger zu machen, ist eine dauerhafte Aufgabe für politische Bildung.
Weil er hauptsächlich nur fernsieht oder nur in Chatrooms ist, bzw. nur auf Unterhaltung aus ist, wird er, wenn überhaupt, nur durch Zufall auf der Internetseite einer Partei oder eines Interessenverbandes kommen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat politikorientierte Medienkompetenz zu vermitteln.
Womit ich also für den Medienbourgeois die anfänglich gestellte Frage nach Vermittlung von Medienkompetenz im Internet verneinen muss.
Dem informierten und urteilsfähigen Zuschauer entspricht nach dieser Einteilung der „ informierte
Bürger “, der das normative Minimum einer politikorientierten Medienkompetenz, wobei sich Informationsorientierung und Unterhaltungsorientierung nicht gegenseitig ausschließen, darstellt. Er besitzt zunächst einmal Wissen (im Sinne von Verstehen) über diese Demokratie. Dass heißt, die Fähigkeit zur kognitiven Orientierung in Politik und Gesellschaft, Interesse an öffentlichen Aufgaben, Sensibilität für gesellschaftlich- politische Probleme, Einsicht in die Komplexität und in die Zusammenhänge genereller politischer Regelungen. Weiterhin verfügt er über politische Urteilsfähigkeit, so dass er in der Lage ist politische Programme, Amtsinhaber und politische Entscheidungen nach seinen eigenen begründeten wertbezogenen und rationalen Maßstäben sowie an Normen und Gestaltungsmöglichkeiten des demokratischen Gemeinwesens zu messen und zu beurteilen.
„Alle demokratischen Parteien verstehen Rechtsstaat, Marktwirtschaft und Demokratie als Grundlagen ihrer Politik. Das lässt einen Unterschied zwischen ihnen, den es immer schon gab, nur noch klarer zu Tage treten. Auf diesen Unterschied kommt es im Wissens-Zeitalter erst recht an. Union, SPD, PDS und Grüne missverstehen den Staat und die Politik als den Vormund unmündiger Bürgerinnen und Bürger. Nur die FDP begreift Politik und Staat als den Wächter über die Fairness im Zusammenleben mündiger Bürgerinnen und Bürger und deren innere und äußere Sicherheit. Union und SPD ruinieren den Staat, indem er sich in immer mehr einmischt und immer weniger beherrscht. Das haben die Menschen am Ende der Regierung Kohl beklagt. Schröders Versprechen an die neue Mitte, das zu ändern, ist unterm Strich zum Gegenteil geraten. Viele Menschen haben den Eindruck, dass es egal ist, ob und was sie wählen: Es ändert sich ja doch nichts. Das Heer der politisch besonders interessierten und überdurchschnittlich gut informierten - potentiellen - Nichtwähler wächst.“7
„Immer mehr Bürger bleiben am Wahlsonntag zu Hause. Um diese Menschen wirbt die FDP.“8
Aber er ist noch nicht der Bürger, der gelegentlich (Interventionsbürger) oder häufig (Aktivbürger) am politischen Geschehen teilnimmt bzw. politisch handelt.
Demokratietheoretisch hat er, wie der „informierte und urteilsfähige Zuschauer“, nur die passive Rolle des Publikums. Kurz: Er beobachtet nur.
„Diese Stimmung und die Auflösung der alten sozial-strukturellen Bindungen der Stammwähler addieren sich zur Folge: 50 % der Wahlberechtigten - im Osten 60 % - entscheiden von Wahl zu Wahl, ob und wen sie wählen. Mit dem Internet ist nicht nur ein neues Medium hinzugekommen, mit dem ein ständig wachsender Teil von Jüngeren - wie eine auch ständig wachsende Zahl von Älteren - ohne den Umweg über die alten Massenmedien erreicht werden können.“9
Seine Medienkompetenzen beinhalten kognitive sowie analytische und evaluative Aspekte. Der kognitive Gesichtspunkt bezieht sich auf die Wissensdimension von Medien. Dieser unterteilt sich in 3 Bereiche: Erstens das Zugriffswissen, dass heißt die instrumentelle Fähigkeit Medien technisch handhaben zu können. Zweitens die klassischen Wissensbestände über die Medien selber, dass bedeutet die Wahrnehmung medialer Angebotsvielfalt sowie Kenntnisse über deren Struktur, Organisationsformen, Inhalte usw. Und Letztens ein Minimum an Wissen über und nach welchen Prinzipien und Handlungsmustern Medien Wirklichkeit definieren und konstruieren10.
Dieser dritte Bereich bildet eine Brücke zu den anderen Gesichtspunkten. Sie beinhalten das Wissen, dass Medien Wirklichkeiten konstruieren und das diese Realität keine absolute Realität ist. Ebenso muss er die Fähigkeit besitzen diese Medienwirklichkeit zumindest in Ansätzen zu entschlüsseln. Wenn man dies auf Politik bezieht, dann ist es die Fähigkeit zu erkennen, welches die Gesetze und Bedingungen für die Darstellung und Vermittlung von Politik sind. Die Voraussetzung hierfür ist der gelegentliche Versuch mediale Wirklichkeitsangebote und - konstruktionen zu vergleichen (vor allem das Fernsehen mit den Printmedien oder dem Internet).
Einen Teil dieser Medienkompetenzen kann man durchaus im Internet vermittelt bekommen. Der informierte Bürger liest z.B. im Internet mehr Zeitungen als er im Briefkasten vorfindet bzw. kann er im Internet Zeitungen von unterschiedlichen Gruppierungen lesen. Außerdem kann er im Web jede Seite einer Partei oder Interessengruppe aufrufen. So kann er sich schnell und billig über ein Thema verschiedene Ansichten ansehen und sich dann seine eigene Meinung bilden. Weiterhin hat er die Möglichkeit sich in so genannten „Wahlkampfbüchern“, was nichts anderes als Lexika zum Thema Politik sind, über Fachbegriffe zu informieren. Als Beispiel habe ich die Begriffe „Briefe an Sympathisanten“ und „Adressenankauf“ von der FDP gewählt.
Briefe an Sympathisanten
Eine Kontaktpflege in Briefform dient zur Bildung und Aufrechterhaltung einer festen Sympathisantenbindung. Voraussetzung dafür ist eine breite und ständig aktualisierte Adresskartei. Inhalt der Briefe können z.B. themenbezogen sein oder Veranstaltungsankündigungen bzw. Informationen über liberale Initiativen vermitteln. Mustertexte zu bestimmten politischen Themen oder für politische Zielgruppen erhalten Sie von der Bundesgeschäftsstelle, Abt. Strategie und Kampagnen, Tel: 030 / 28495857, Fax: 030 / 28495852 oder per e-mail: beyer@fdp.de.
Adressenankauf:
Wenn Sie eine Direct Mailing Aktion planen und damit eine bestimmte Zielgruppe ansprechen
möchten (Freiberufler, Handwerker, Jungwähler etc.), können Sie Adressen von verschiedenen Anbietern ankaufen. Jungwähleradressen werden häufig auf kommunaler Ebene zur Verfügung gestellt. Weitere Adressen finden Sie im Branchenbuch / Gelbe Seiten oder per Internet-Recherche. Weitere Informationen und Hilfestellungen erhalten Sie beim Kampagnenteam (Leiter Martin Biesel), Tel. 030/484933-0, Fax 030/484933-11; e-mail: info@achtzehnzweitausendzwei.de oder unter www.achtzehnzweitausendzwei.de.
Bei der FDP ist die Erläuterung zweigeteilt: Der Erste ist eine Kurzbeschreibung des Wortes an sich und der Zweite, eine Liste von Adressen, ist schon für die noch folgende Bürgerrolle des Interventions- oder Aktivbürgers gedacht, die sich politisch engagieren und für Hilfe an diese Adressen wenden können.
Der Interventions- oder Aktivbürger benötigt die eben beschriebenen Kompetenzen auch, doch reichen die passiven Medienkompetenzen allein für sie nicht aus. Um diese beiden anspruchsvolleren Bürgerrollen ausfüllen zu können, ist eine höhere Beurteilungskompetenz auf vielfältige Kriterien hin notwendig: z.B. auf Ideologiehaftigkeit, weltanschauliche Neutralität bzw. Pluralität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Wahrheit usw. Der erste Schritt hin zu dieser neuen Beurteilungskompetenz ist der Vergleich unterschiedlicher Medien zur Informationserweiterung und der zweite Schritt ist die Einbettung in ein dichtes interpersonales Kommunikationsnetz (moralische Orientierung mit einbezogen), in der Medienwirkung / -realität betrachtet und beurteilt wird. Dies „bricht“ die Wirkung der Medien reflexiv und führt zu einer eigenständigen Urteilskompetenz. Dazu gehört dann auch, sich über politische Prozesse jenseits medialer Darstellungen zu informieren und mit der Realität jenseits der Medien zu konfrontieren. Zum Schluss brauchen diese beiden Gruppen noch eine konstruktive Medienkompetenz, dass heißt die Fähigkeit mediale Möglichkeiten aktiv zu nutzen und als Mittel zur Artikulation und Durchsetzung seiner Persönlichkeit, Interessen, Anliegen u.v.m. einzusetzen.
Die einzige Chance für den Interventions- oder Aktivbürger mehr Medienkompetenz als der informierte Bürger im Internet zu erlernen, ist die Mitarbeit via Internet an der Partei- oder Verbandszeitung oder die Erstellung der Webseite11. Dafür muss er Mitglied der Partei oder des Verbandes sein. Doch stellt dies nur den kleinsten und vielleicht unbedeutendsten Fall seiner benötigten Medienkompetenz dar. Nach meinen Recherchen im Internet und den daraus resultierenden Erfahrungen können die Medienkompetenzen dieser Bürgerrolle nur im Umgang mit anderen Menschen erlernt und weitergegeben werden.
Abschließend kann ich also nur sagen, dass man einen Teil der Medienkompetenzen (Mediengestaltung und Mediennutzung), die für die Politik benötigt werden, im Internet lernen und anwenden kann. Den anderen Teil (Medienkritik und Medienkunde) aber nur im Umgang mit Medien und Menschen zusammen erlernen kann.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit dem Internet (generell gesehen) kann es bis heute nur Wissen vermitteln, sowie der Kommunikation und Unterhaltung dienen (was auch schon in der Definition von „Neuen Medien“ deutlich wird).
Literaturangabe
- Internet (www.fdp.de, www.wissen.de, www.achtzehn2002.de u. a.)
- Dieter Baacke, Susanne Kornblum, Jürgen Lauffer, Lothar Mikos, Günter A. Thiele (Hg.): 1999: Handbuch Medien: Medienkompetenz - Modelle und Projekte: Bundeszentrale für politische Bildung: Bonn
- Dr. Ralf Vollbrecht: 2001: Einführung in die Medienpädagogik: Beltz Verlag: Weinheim und Basel
- Peter Massing: 2001 Bürgerleitbilder und Medienkompetenz: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.) Politikunterricht im Informationszeitalter: S. 39-50: Bonn
- Microsoft Encarta 2001 Enzyklopädie Plus
[...]
1 Ich habe diese Seite nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen gewählt, sondern weil sie mir als bestes Beispiel für mein Thema am geeignetsten schien.
2 Mit dem Auftreten neuer Technologien im Bereich der Kommunikationsmittel ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, verstärkt seit den siebziger Jahren, der Begriff „neue Medien” in Umlauf gekommen, als eine Sammelbezeichnung für verschiedene Techniken im Bereich der Unterhaltungselektronik, der Datenverarbeitung und der Nachrichtentechnik sowie für Neuentwicklungen bei der Informationsspeicherung und -übertragung, im weiteren Sinne auch die neuen Formen der Massenkommunikation, insbesondere das Internet.
3 Die Medienpädagogik ist die Wissenschaft von Entwicklungs-, Erziehungs- und Bildungsprozessen in der Medienwelt. Sie entwirft theoretische Modelle dieser Prozesse und betreibt darauf bezogene Forschung.
4 Leider habe ich nirgends ein Beispiel gefunden, indem Baacke seine vier Dimensionen selber angewandt bzw. bewiesen hat.
5 Die Medienwelten selber sind in drei Bereiche unterteilt: a) der Handlungsbereich, was der Datenautobahn der Informatik, Wirtschaft, Technik, des Wissens, der Politik (mit den Fähigkeiten der Disziplinorientierung, Pünktlichkeit, Fleiß, …) b) der Kommunikationsbereich mit der Datenautobahn des Unterhaltungsmarktes (Orientierung an Spaß, emotionellen Überwältigungen) und c) der Reflexionsbereich mit der Datenautobahn des edukativen Prinzips ethischer und verantworteter Reflexion
6 Heute wird davon geredet, dass man ,um in der Arbeitswelt bestehen zu können, Medienkompetenz besitzen müsse. Doch meint man damit schlicht und einfach die Fähigkeiten im Umgang mit Computern, wodurch die instrumentell-qualifikatorische Funktion und die Dimension der Mediennutzung überbetont, während reflexive, ethische, ästhetisch-innovative oder medienkritische Aspekte weitgehend unberücksichtigt bleiben.
7 Aus dem Wahlprogramm „Strategie 18 %“ der FDP.
8 Aus dem Wahlprogramm „Strategie 18 %“ der FDP.
9 Aus dem Wahlprogramm „Strategie 18 %“ der FDP.
10 z.B. Welche Wirklichkeitsmodelle bieten die Medien an? Welches Bild von Politik entwerfen sie? u.a.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über Medienkompetenz?
Dieser Text untersucht, inwieweit das Internet Medienkompetenz vermitteln kann, insbesondere im Hinblick auf politikorientierte Medienkompetenz. Er verwendet die FDP-Webseite als Beispiel, um die These zu prüfen.
Was versteht man unter Medienkompetenz?
Medienkompetenz ist die Fähigkeit, Medien und Techniken, die gesellschaftliche Kommunikation unterstützen, zu verstehen, sinnvoll zu nutzen und selbstbestimmt einzusetzen. Es geht um mehr als nur die Bedienung von Geräten; es umfasst auch kritisches Denken, Wissenserwerb, aktive Nutzung und kreative Gestaltung von Medien.
Welche Dimensionen der Medienkompetenz werden unterschieden?
Nach Dieter Baacke umfasst Medienkompetenz vier Dimensionen: Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung.
Was ist Medienkritik?
Medienkritik ist die reflexive Rückbesinnung auf soziale und mediale Veränderungen. Es beinhaltet analytische Fähigkeiten, die Anwendung dieses Wissens auf das eigene Handeln und die Abstimmung des Denkens mit ethischer Verantwortung.
Was beinhaltet Medienkunde?
Medienkunde umfasst Wissen über Medien und Mediensysteme, sowohl instrumentell-qualifikatorisch (Bedienung der Geräte) als auch informativ (Wissensbestände über Rundfunksysteme, Bücher usw.).
Was bedeutet Mediennutzung?
Mediennutzung kann rezeptiv (z.B. ProgrammNutzungskompetenz) oder interaktiv (z.B. Online-Banking, Tele-Shopping) sein. Es geht über die reine Bedienung hinaus und schließt die Zielorientierung mit ein.
Was ist Mediengestaltung?
Mediengestaltung ist die innovative und kreative Dimension, die das Mediensystem weiterentwickelt und den ästhetischen Aspekt betont.
Welche Rolle spielt Medienkompetenz in der politischen Bildung?
Medienkompetenz ist eine Grundqualifikation für die Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zur Wirklichkeitserschließung. Politische Bildung muss jedoch darüber hinausgehen und berücksichtigen, dass politische Realität durch Interpretationen konstruiert wird, die von den Medien vermittelt werden.
Welche Bürgerleitbilder werden unterschieden?
Der Text unterscheidet vier Bürgerrollen: den politisch Desinteressierten, den informierten und urteilsfähigen Zuschauer, den interventionsfähigen Bürger und den Aktivbürger.
Wer ist der „Medienbourgeois“?
Der „Medienbourgeois“ entspricht dem politisch Desinteressierten und zeigt ein ausgeprägtes, aber unterhaltungsorientiertes Mediennutzungsverhalten. Er ist anfällig für negative Deutungen der Politik und schwer für politikorientierte Medienkompetenz zu erreichen.
Was kennzeichnet den „informierten Bürger“?
Der „informierte Bürger“ ist das normative Minimum demokratischer Bürgerrollen. Er verfügt über Wissen über Demokratie, politische Urteilsfähigkeit und die Fähigkeit, politische Entscheidungen zu beurteilen.
Inwieweit kann das Internet Medienkompetenz vermitteln?
Das Internet kann einen Teil der Medienkompetenzen vermitteln, insbesondere Zugriffswissen und Informationen. Es kann jedoch Medienkritik und -kunde im engeren Sinne nicht vollständig ersetzen, da diese den Umgang mit Medien und Menschen erfordern.
Welche Kritik wird an Baackes Definition der Medienkompetenz geübt?
Baacke selbst räumte ein, dass seine Definition weit gefasst und empirisch "leer" bleibt. Sie gibt keine konkreten inhaltlichen oder didaktischen Hilfen zur Umsetzung in die Lern- und Lebenspraxis.
Was sind die Schlussfolgerungen des Textes?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass das Internet nur einen Teil der für die Politik benötigten Medienkompetenzen vermitteln kann. Der andere Teil, insbesondere Medienkritik und Medienkunde, erfordert den Umgang mit Medien und Menschen.
- Quote paper
- Claudia Möhl (Author), 2002, Medienkompetenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107331