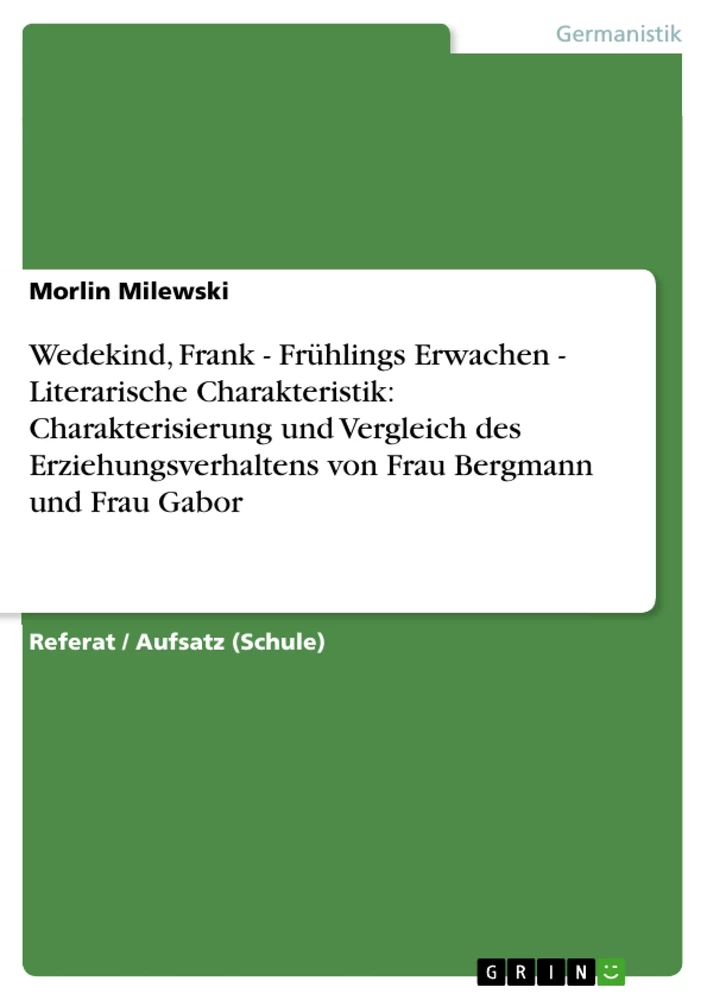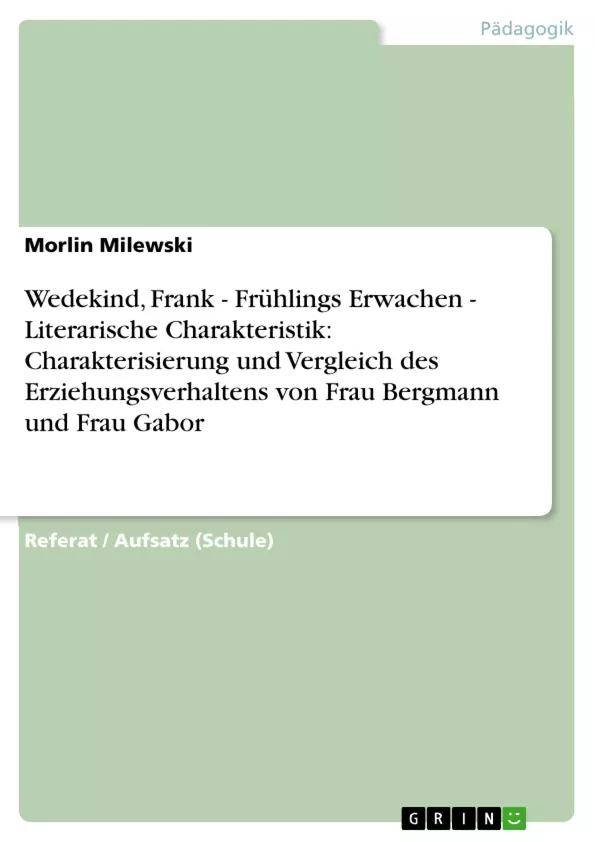Was bedeutet es, jung zu sein, wenn die Welt der Erwachsenen in Schweigen und Lügen gehüllt ist? Frank Wedekinds "Frühlings Erwachen" ist mehr als nur ein Theaterstück – es ist ein erschütterndes Porträt des Erwachsenwerdens, der sexuellen Entdeckung und der verheerenden Folgen von Ignoranz und Unterdrückung. Im Zentrum dieser Tragödie stehen Melchior und Wendla, zwei Jugendliche, deren Schicksale auf tragische Weise miteinander verwoben sind. Doch wer trägt die wahre Verantwortung für ihr Leid? Diese tiefgründige Analyse beleuchtet die Erziehungsstile der Mütter, Frau Gabor und Frau Bergmann, und vergleicht ihre unterschiedlichen Ansätze in Bezug auf Sexualerziehung und sozialgesellschaftliche Werte. Während Frau Gabor eine liberale, fast schon idealistische Haltung vertritt, die jedoch in der Realität scheitert, klammert sich Frau Bergmann an Konventionen und verweigert ihrer Tochter jegliche Aufklärung. Der Vergleich zeigt erschreckende Gemeinsamkeiten auf: die Angst vor dem Verlust der Kinder, die brutale Praxis der Verdrängung und die hilflose Berufung auf Gott angesichts des Scheiterns. Doch es sind die Unterschiede, die das Drama so brisant machen: der Gegensatz zwischen Aufklärung und Ahnungslosigkeit, zwischen liberaler und kleinbürgerlicher Moral. "Frühlings Erwachen" ist ein zeitloses Werk, das uns zwingt, über die Verantwortung der Eltern, die Last der Geheimnisse und die Notwendigkeit offener Kommunikation nachzudenken. Eine fesselnde Lektüre für alle, die sich mit den Herausforderungen der Jugend, den Fallstricken der Erziehung und den dunklen Seiten der bürgerlichen Gesellschaft auseinandersetzen möchten. Diese Interpretation bietet neue Einblicke in Wedekinds Meisterwerk und regt zum Nachdenken über unsere eigene Haltung zu Sexualität, Erziehung und gesellschaftlichen Normen an. Entdecken Sie die verborgenen Motive, die tragischen Verstrickungen und die zeitlose Relevanz von "Frühlings Erwachen". Ein Muss für Literaturinteressierte, Pädagogen und alle, die sich für die Abgründe der menschlichen Seele interessieren. Tauchen Sie ein in die Welt von Melchior und Wendla und stellen Sie sich den unbequemen Fragen, die Wedekind uns stellt. Eine literarische Reise, die Sie nicht vergessen werden. Erziehung, Sexualität, Tragödie, Jugend, Wedekind, "Frühlings Erwachen", Analyse, Interpretation, Gesellschaftskritik, Moral, Verantwortung, Familie, Geheimnisse, Unterdrückung.
Gliederung:
A: Einleitung
B: I. Charakterisierung des Erziehungsverhaltens
1. von Frau Gabor
a) bezüglich der Sexualerziehung
b) hinsichtlich der sozialgesellschaftlichen Erziehung
c) die Beziehung zu ihrem Sohn Melchior
2. von Frau Bergmann
a) hinsichtlich der sozialgesellschaftlichen Erziehung
b) die Beziehung zu ihrer Tochter Wendla
c) bezüglich der Sexualerziehung
II. Vergleich der beiden Erziehungsverhalten
1. Gemeinsamkeiten
a) Fürsorge für ihre Kinder
b) Brutale Praxis als Folge von Verdrängung
c) Berufung auf Gott bei Fehlverhalten gegenüber ihren Kindern
d) Angst ihr Kind zu verlieren
2. Unterschiede
a) Gegensatz von liberaler und kleinbürgerlicher Erziehung
b) Gegensatz von Aufklärung und Ahnungslosigkeit - die Sexualerziehung
c: Schluß
In der Tragödie „Frühlings Erwachen“ von Frank Wedekind spielen die beiden Jugendlichen, Melchior und Wendla, eine wichtige Rolle. Da die Erziehung der beiden für den Ablauf des Dramas von wesentlicher Bedeutung ist, wird nun das Erziehungsverhalten der Mütter, nämlich von Frau Bergmann und Frau Gabor, genauer untersucht und anschließend vergleichend gegenübergestellt.
Zu Beginn dieser Betrachtung soll nun näher auf Frau Gabor, die Mutter von Melchior, eingegangen werden. Hier wäre zuerst die Sexualerziehung zu erwähnen. So läßt Frau Gabor es zu, daßihr Sohn Melchior sich „teils aus Büchern, teils aus Illustrationen“ und „teils aus Beobachtungen in der Natur“ (S.11, Z.14ff.) über Sexualität informiert. Sie gestattet ihm zum Beispiel Goethes „Faust“(S.25, Z. 40) zu lesen, obwohl sie über die sexuelle Beziehung zwischen Faust und Gretchen in diesem Stück, Bescheid weiß. Sie meint nur, daßer „alt genug“ wäre „um wissen zu können“, was ihm „zuträglich“ und was ihm „schädlich“ ist (S.26, Z. 14ff.). Desweiteren findet Frau Gabor es nicht schlimm, daßMelchior für seinen unaufgeklärten Freund Moritz einen Aufklärungsaufsatz geschrieben hat, sie sieht ihn sogar als den „eklatanteste(n) Beweis für seine Harmlosigkeit“ (S.53, Z.36ff.). Melchior genügen nun aber diese theoretischen Kentnisse nicht mehr, er lehnt es ab, „Befriedigung“ nur zu „denke(n)“ (S.27, Z.31ff.). Frau Gabor hingegen ist durch ihre praxisferne Erziehungsideologie von Melchior enttäuscht als sie erfährt, daßMelchior mit Wendla geschlafen hat. Dies hält sie erst für „unmöglich“ (S.55, Z.3) und möchte es nicht wahrhaben, aber als sie es dann endlich einsieht, stimmt sie dem Vorschlag ihres Mannes zu, ihn „in die Korrektionsanstalt“(S.55, Z.21) zu schicken (3. Akt, 3. Szene).
Als nächstes soll die sozialgesellschaftliche Erziehung dargestellt werden. Im allgemeinen hat sie eine recht liberale Einstellung und ist dadurch anderen gegenüber nicht voreingenommen (S.35, Z.37- S.36, Z.3). Diese Eigenschaft gibt Melchior in Kombination mit ihrem Verständnis, ihrer Gastfreundlichkeit und ihrer Toleranz ein gutes Vorbild. Sie erzieht ihn nach ihren eigenen Idealen, die sie in seinem „rechtlichen Charakter“ und seiner „edle(n) Denkungsweise“ (S.52, Z.17-20) verwirklicht sieht: „...o dieser Morgenhimmel, wie ich ihn licht und rein in seiner Seele gehegt als mein höchstes Gut...“ (S.54, Z.20-22). Dies läßt annehmen, daßsie an eine gute Erziehung nach ihren Idealen, und daher an eine positive Entwicklung ihres Sohnes, glaubt. Ihre Ideale sind wahrscheinlich geprägt von der Erziehung, die sie wohl selber gerne erhalten hätte. Alles in allem ist die Erziehung, die sie Melchior zuteil werden läßt, eher theoriebezogen, da sie in der Praxis einen Rückzieher in ihrer liberalen Erziehung macht. So hilft sie Moritz nach seiner Bitte ihm Geld für eine Überfahrt nach Amerika zu geben, da er beabsichtigte aufgrund schlechter schulischer Leistungen von zu Hause wegzulaufen, nicht, sondern schreibt ihm nur einen beschwichtigenden Brief. Obwohl die Vermutung nahelag, daßer sich umbringen könnte (S35, Z.19-21), gibt sie ihm keinerlei praktische Hilfe, mit der sie ihn vom Freitod hätte abhalten können. Ihre praxisferne Erziehung kommt auch in ihrer Beziehung zu Melchior zum Ausdruck, welche nun erläutert werden soll.
So soll er tun was er vor sich „verantworten“ ( S.26, Z.15f.) kann, d.h. er soll selbst die Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Als er aber seine Bereitschaft zeigt für seinen Fehler, mit Wendla den Beischlaf zu vollziehen, „ein(zu)stehen“ (S.54, Z.35- S.55, Z.2), ist Frau Gabor von ihrem Sohn Melchior enttäuscht, da er damit beginnt, erwachsen zu werden und sich ihrer Fürsorge zu entziehen. Daran wird wieder deutlich, daßihre Erziehung recht praxisfern ist, weil sie die ihm schon zugesprochene Verantwortung (S.26, Z14ff.) wieder aberkennt. Sie will ihren Sohn nicht verlieren, sondern ihn als unschuldiges und somit verantwortungsloses Kind behalten. Solange sie für ein solches Kind hält, stellt sie sich im Gespräch mit ihrem Mann schützend vor ihren Sohn, wobei sie sich auch gegen dessen bornierten Machtanspruch auflehnt, um Melchior vor der Korrektionsanstalt zu bewahren: „Ich vertrete dir den Weg, solange ein Tropfen warmen Blutes in mir wallt!“ (S.52, Z.11ff). Auch versucht sie das Schreiben des Aufklärungsaufsatzes vor dem Vater zu verharmlosen, indem sie den Aufsatz als „Beweis für seine (Melchiors) Harmlosigkeit, für seine Dummheit“ und „für seine kindliche Unberührtheit“ (S.53, Z.36-38) bezeichnet. Als sie als Folge ihrer liberalen Erziehung Melchior in die Korrektionsanstalt schicken muß, in der er „eherne Disziplin, Grundsätze und einen moralischen Zwang“ (S.55, Z.24-27) findet, beruft sie sich, weil sie ihre Erziehung gescheitert sieht, auf Gott: „Barmherziger Himmel!“ (S.55, Z.38).
Außerdem sind in der Beziehung zu ihrem Sohn ihre mütterlichen Instinkte und die Liebe zu ihrem Sohn zu erkennen: „Ich lasse mein Kind nicht vor meinen Augen hinmorden. Dafür bin ich seine Mutter.“ (S.53, Z.33f.) und „Wenn du (Herr Gabor) Melchior in die Korrektionsanstalt bringst, dann sind wir geschieden!“ (S.54, Z.2f.). Im letzteren Zitat wird sogar klar, daßsie die Liebe zu ihrem Sohn vor ihre Ehe stellt.
Nun soll das Erziehungsverhalten von Frau Bergmann dargestellt werden. Dazu wird zunächst genauer auf den sozialgesellschaftlichen Aspekt eingegangen. DaßFrau Bergmann keinen allzugroßen Wert auf die allgemeine Bildung ihrer Tochter legt, zeigt sich in Wendlas Unvermögen, sich sprachlich zu artikulieren. So durchbricht sie zum Beispiel auf dem Heimweg nach ihrem sexuellen Erlebnis mit Melchior, mit dem Schlußsatz ihres Monologes, „Ach Gott, wenn jemand käme, dem ich um den Hals fallen und erzählen können“ (S.36; Z.30ff.), dessen Ausdrucksfunktion, da ihre Artikulationsmöglichkeit nur auf die dialogische Kommunikation beschränkt ist. Dafür mißt sie den gesellschaftlichen Konventionen dieser Zeit jedoch umso mehr Bedeutung zu. So sorgt sie sich um das Erscheinungsbild ihrer Tochter, indem sie nicht möchte, daßWendlas Kleid zu kurz ist, und möchte deshalb „gelegentlich eine Handbreit Volants unten ansetzen“ (S.6, Z.3f.). Sie meint, daßWendla „als ausgewachsenes Mädchen nicht in Prinzeßkleidchen einhergehen“ (S.5, Z.11ff.) darf. Darin kann man erkennen, daßsie auf die Meinung der Gesellschaft Wert legt, und Angst vor der gesellschaftlichen Ächtung hat, aufgrund falscher Erziehung Wendlas. Ebenso fürchtet sie sich davor, Wendla aufzuklären, was aber erst an späterer Stelle erläutert werden soll. Hierzu wäre noch zu erwähnen, daßsie sich, als sie nicht mehr weiter weiß, mehrmals an Gott wendet mit Ausrufen wie: „Großer, gewaltiger Gott“ (S.60, Z.13), „...der liebe Gott...“ (S.60, Z.30) und „... Barmherziger Himmel...“ (S.60, Z.1). Ihre sozialgesellschaftliche Erziehung ist stark von Konventionen geprägt, was vermuten läßt, daßsie in der selben Art und Weise bereits von ihrer Mutter erzogen wurde: „Ich habe an dir nichts anderes getan, als meine liebe gute Mutter an mir getan hat.“ (S.60, Z.25f.).
Desweiteren wird die Beziehung zwischen Frau Bergmann und ihrer Tocher Wendla genauer betrachtet. Einerseits ist Frau Bergmann nicht offen zu Wendla und sagt ihr oft die Unwahrheit. So zum Beispiel in Akt 2, Szene 2, in der sie, anstatt Wendla aufzuklären, ihr die Geschichte vom „Storch“ (S.28, Z.16) erzählt, und auch nach Fragen Wendlas immer noch Unwahrheiten erzählt: „Er war eben wieder fortgeflogen“ (S.28, Z.31). Auch als sie später bereit ist, ihr zu erzählen, was man tun muß, „um ein Kind zu bekommen“ (S.31, Z.4) teilt sie ihr mit, daßman „verheiratet“ (S.31, Z.7) sein, und einen Mann „von ganzem Herzen lieben“ (S.31, Z.9) muß. Außerdem heuchelt sie ihr in Wendlas Schwangerschaft eine Krankheit vor, anstatt sie über ihren Zustand aufzuklären. Obwohl sie ihre Tochter dermaßen anlügt, liebt sie sie andererseits sehr und zeigt sich auch besorgt um sie. So pflegt sie Wendla, als diese schwanger ist und belegt sie öfters mit Koseworten, wie „mein einziges Herzblatt“ (S.5, Z.30) und „liebes Herz“ (S.29, Z.6). Auch fürchtet sie sich vor dem Reifwerden ihrer Tochter, und daher möchte sie Wendla so behalten, wie sie ist, nämlich als Kind. Aus diesem Grund läßt sie Wendla noch das alte „Prinzeßkleidchen“ (S.5, Z.12), ein typisches Kinderkleid, tragen, und schiebt es noch den Sommer hinaus, ihr das „Bußgewand“ (S.6,Z.1) aufzudrängen. Aus diesem Beispiel wird auch deutlich, daßsich Frau Bergmann ihrer Tochter gegenüber nachgiebig zeigt und hier verständnisvoll reagiert.
Der wohl wichtigste Punkt ist wohl die nähere Betrachtung der Sexualerziehung von Frau Bergmann. Daßsie sich davor scheut ihre eigene Tochter aufzuklären, wird dadurch erkenntlich, daßsie Wendla Lügen erzählt und auf deren Fragen zu diesem Thema ausweicht. So erzählt Frau Bergmann Wendla nach der Geburt ihres dritten Enkels, daß„der Storch bei ihr (Wendlas Schwester)“ (S.28, Z.17ff.). Auch als Wendla neugierig fragt, ob sie dabei war, „als er (der Storch) ihn (den Enkel) brachte“ (S.28, Z.30), antwortet sie mit der bewußten Lüge: „Er war eben wieder fortgeflogen.“ (S.28, Z.31). Sie versucht Wendla auch von diesem Thema abzubringen, indem sie ihr erzählt, daßder Storch ihr „auch etwas mitgebracht“ (S.28, Z.34f.) hätte, nämlich eine Brosche. Aber auf weiteres stetes Nachfragen Wendlas weicht sie immer noch aus, bis ihre Tochter sie soweit bringt, daßsie es zumindest versucht, es ihr zu erklären. Sie scheut sich aber dann doch davor, Wendla die Wahrheit zu erzählen, und lügt sie erneut an, indem sie ihr sagt, daßman verheiratet sein, und einen Mann nur von ganzem Herzen lieben müsse, womit sich Wendla dann schließlich zufrieden gibt. Dieses Vehalten von Frau Bergmann läßt sich dadurch erklären, daßsie von ihrer eigenen Mutter sehr konservativ im Bezug auf die Sexualität erzogen worden ist, daßSexualität zur damaligen Zeit ein Tabu-Thema war, und sie daher Angst hat, über Sexualität und ihre Folgen zu sprechen. Sie erzählt also auch Wendla nichts von der Schwangerschaft ihrer Schwester, sondern sie gibt eine „Influenza“ (S.28, Z.21) als Grund für die auftretenden Schwangerschaftsbeschwerden der Schwester vor. Auch als Wendla selber schwanger ist, erzählt Frau Bergmann ihr nur aus Verzweiflung ,daßWendla denkt, sie sei totkrank, davon, daßsie in Wahrheit schwanger ist: „Du mußt nicht sterben - Kind! Du hast nicht die Wassersucht. Du hast ein Kind, Mädchen!“ (S.60, Z.4ff.). Aber selbst nach dieser Offenbarung und nach der Anklage Wendlas, daßsie ihr „nicht alles gesagt“ (S.60, Z.20) hätte, klärt sie sie immer noch nicht auf, sondern läßt sie bis in ihren Tod unwissend. Sie möchte noch nicht einmal, daßAußenstehende von der Schwangerschaft ihrer Tochter erfahren, und verhindert dies mit einer falschen Todesangabe auf dem Grabstein: „gestorben an der Bleichsucht“ (S.64, Z.10). Es ist noch wichtig zu erwähnen, daßFrau Bergmann zwar Angst hat über Sexualität zu sprechen, jedoch keine Skrupel hat, die brutale Abtreibung vornehmen zu lassen, bei der ihre Tochter Wendla dann schließlich umkommt.
Nach dieser Charakterisierung des Erziehungverhaltens der beiden Mütter soll dieses nun auf vergleichender Basis gegenübergestellt werden. Hier erfolgt nun zuerst eine Betrachtung der Gemeinsamkeiten.
Am Anfang wäre der aufzuführen, daßsowohl Frau Bergmann als auch Frau Gabor sehr fürsorglich sind. So ist es ihnen beiden ein Anliegen, daßes ihren Kindern gut geht. Beide lieben ihre Kinder sehr, was bei Frau Gabor durch ihren großen mütterlichen Instinkt, und bei Frau Bergmann durch die Sorge um ihre Tochter zum Ausdruck kommt. Frau Gabor sagt, sie könne ihr „einziges Kind nicht gewaltsam in den Tod jagen lassen“ (S.52, Z.26f.) und Frau Bergmann meint in der Diskussion mit ihrer Tochter: „Wenn du nur nicht zu kalt hast!“ (S.6, Z.7).
Als eine weitere Gemeinsamkeit kann man die Reaktion der beiden Mütter auf das Fehlverhalten ihrer Kinder nennen. Sie reagieren beide mit einer sehr brutalen Praxis, die wohl eine Folge von Verdrängung darstellt. So verdrängt Frau Gabor den Fehlschlag ihrer Erziehung durch Melchiors sittlichen Verstoßes, indem sie, als Enttäuschte über das Verhalten ihres Sohnes, ihrem Mann zustimmt, Melchior „in die Korrekionsanstalt“ (S.55, Z.21) zu schicken. Auch Frau Bergmann reagiert aufgrund ihrer Feststellung, daßihre Tochter unehelich schwanger ist und damit gegen ihre sittlichen Moralvorstellungen verstoßen hat, mit einer Verdrängungsreaktion, und läßt anschließend die brutale und folgenreiche Abtreibung vornehmen: „... laßuns auf Barmherzigkeit hoffen, und das Unsrige tun! Sieh, noch ist ja nichts geschehen, Kind.“ (S.60, Z.27ff.).
Ebenso berufen sich beide Mütter, im Moment des Fehlverhaltens gegenüber ihren Kindern, auf Gott. So wünscht Frau Bergmann ihrer Tochter, nachdem sie Wendla angelogen hat, daß„der liebe Gott“ sie „behüte“ und „segne“(S.31, Z.26f.). Auch kurz bevor sie die Abtreibung an Wendla vornehmen läßt, beruft sie sich mehrmals auf Gott: „...Barmherziger Himmel...“(S.60, Z.1), „Großer, gewaltiger Gott...“(S.60, Z.13) und „O laßuns auf den lieben Gott vertrauen;laßuns auf Barmherzigkeit hoffen...“(S.60, Z.26ff.). In gleicher Weise äußert sich auch Frau Gabor, nachdem sie zugelassen hat, daßihr Sohn Melchior in die Korrektionsanstalt geschickt wird. Sie wendet sich mit den Worten: „Barmherziger Himmel!“(S.55, Z.38) an Gott, wobei sie vielleicht hofft, daßGott ihr und ihrem Sohn in dieser Zeit beistehe.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse von „Frühlings Erwachen“?
Die Analyse konzentriert sich auf das Erziehungsverhalten der Mütter von Melchior (Frau Gabor) und Wendla (Frau Bergmann) in Frank Wedekinds Tragödie „Frühlings Erwachen“. Sie vergleicht und charakterisiert deren unterschiedliche Ansätze, insbesondere in Bezug auf Sexualerziehung und sozialgesellschaftliche Erziehung.
Wie wird das Erziehungsverhalten von Frau Gabor charakterisiert?
Frau Gabor wird als liberal in Bezug auf Sexualerziehung dargestellt. Sie erlaubt Melchior, sich aus Büchern und Beobachtungen über Sexualität zu informieren und vertraut darauf, dass er selbst entscheiden kann, was für ihn zuträglich ist. In sozialgesellschaftlichen Fragen ist sie tolerant und vorurteilsfrei. Allerdings zeigt sie in der Praxis, besonders als Melchior mit Wendla schläft, eine gewisse Enttäuschung und stimmt letztendlich seiner Einweisung in eine Korrektionsanstalt zu, was ihre theoriebezogene Erziehung in Frage stellt.
Welche Merkmale kennzeichnen das Erziehungsverhalten von Frau Bergmann?
Frau Bergmann wird als konservativ und den gesellschaftlichen Konventionen verpflichtet dargestellt. Sie legt wenig Wert auf die allgemeine Bildung Wendlas, misst aber dem Erscheinungsbild ihrer Tochter große Bedeutung bei. Sie scheut sich, Wendla über Sexualität aufzuklären und erzählt ihr stattdessen Lügen und Märchen. Ihre Erziehung ist stark von Tabus und Angst vor gesellschaftlicher Ächtung geprägt.
Welche Gemeinsamkeiten werden im Erziehungsverhalten von Frau Gabor und Frau Bergmann festgestellt?
Beide Mütter sind fürsorglich und um das Wohl ihrer Kinder bemüht. Sie reagieren jedoch beide mit brutalen Praktiken (Korrektionsanstalt für Melchior, Abtreibung für Wendla) auf das Fehlverhalten ihrer Kinder, was auf eine Verdrängung eigener Fehler hindeutet. Beide berufen sich in schwierigen Situationen auf Gott und haben Angst, ihre Kinder zu verlieren und deren Unschuld zu bewahren.
Worin bestehen die Unterschiede im Erziehungsverhalten von Frau Gabor und Frau Bergmann?
Der Hauptunterschied liegt im Gegensatz von liberaler und kleinbürgerlicher Erziehung. Frau Gabor praktiziert eine eher aufklärerische und theoretische Sexualerziehung, während Frau Bergmann Ahnungslosigkeit und Tabuisierung bevorzugt. Frau Gabor räumt Melchior mehr Freiheit und Eigenverantwortung ein, während Frau Bergmann Wendla in Unwissenheit hält und stark kontrolliert.
Welche Rolle spielt Sexualerziehung im Drama?
Sexualerziehung ist ein zentrales Thema, da die mangelnde oder falsche Aufklärung der Jugendlichen zu tragischen Konsequenzen führt. Melchior, der sich selbst informiert, erlebt die praktische Umsetzung seiner Kenntnisse. Wendla hingegen, die in Unwissenheit gehalten wird, wird schwanger und stirbt schließlich an den Folgen einer Abtreibung.
Wie äußert sich die Angst der Mütter, ihre Kinder zu verlieren?
Frau Gabor versucht, Melchior vor den Konsequenzen seines Handelns zu schützen, indem sie seine Tat als Beweis für seine Unschuld darstellt. Frau Bergmann hingegen klammert sich an Wendlas Kindheit und versucht, sie vor den Realitäten des Erwachsenwerdens zu bewahren, indem sie sie in Unwissenheit hält und die Abtreibung vornimmt.
Was ist die Bedeutung der Berufung auf Gott im Verhalten der Mütter?
Die Berufung auf Gott dient den Müttern als Rechtfertigung für ihre Handlungen und als Trost in der Not. Sie spiegelt die moralischen und religiösen Vorstellungen der damaligen Zeit wider und zeigt die Hilflosigkeit der Mütter angesichts der Herausforderungen der Erziehung.
- Citar trabajo
- Morlin Milewski (Autor), 1996, Wedekind, Frank - Frühlings Erwachen - Literarische Charakteristik: Charakterisierung und Vergleich des Erziehungsverhaltens von Frau Bergmann und Frau Gabor, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107323