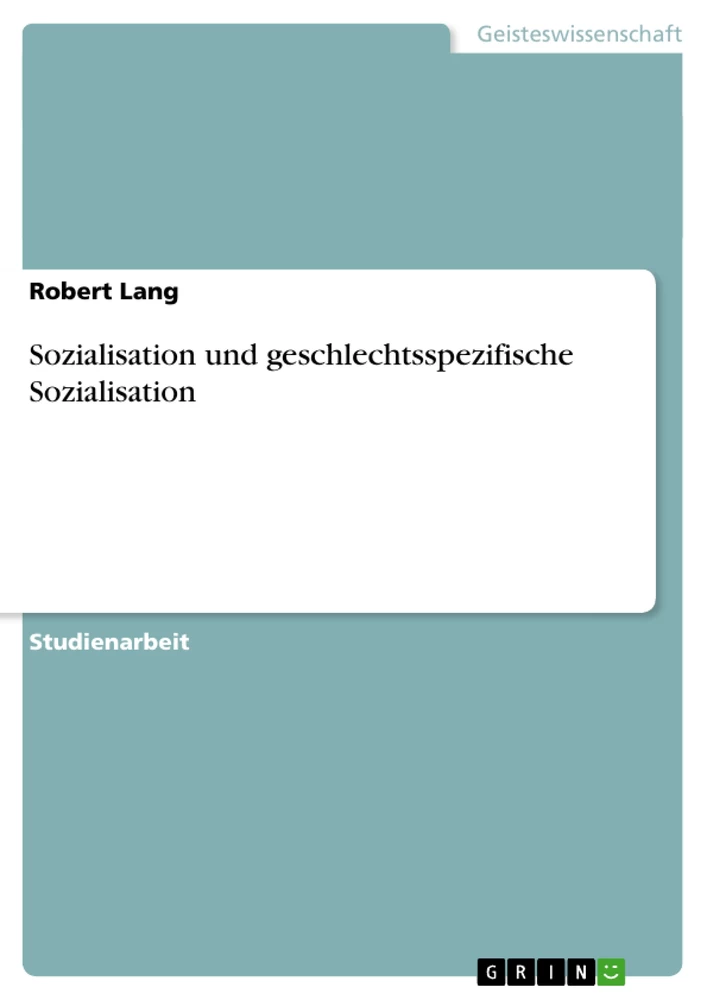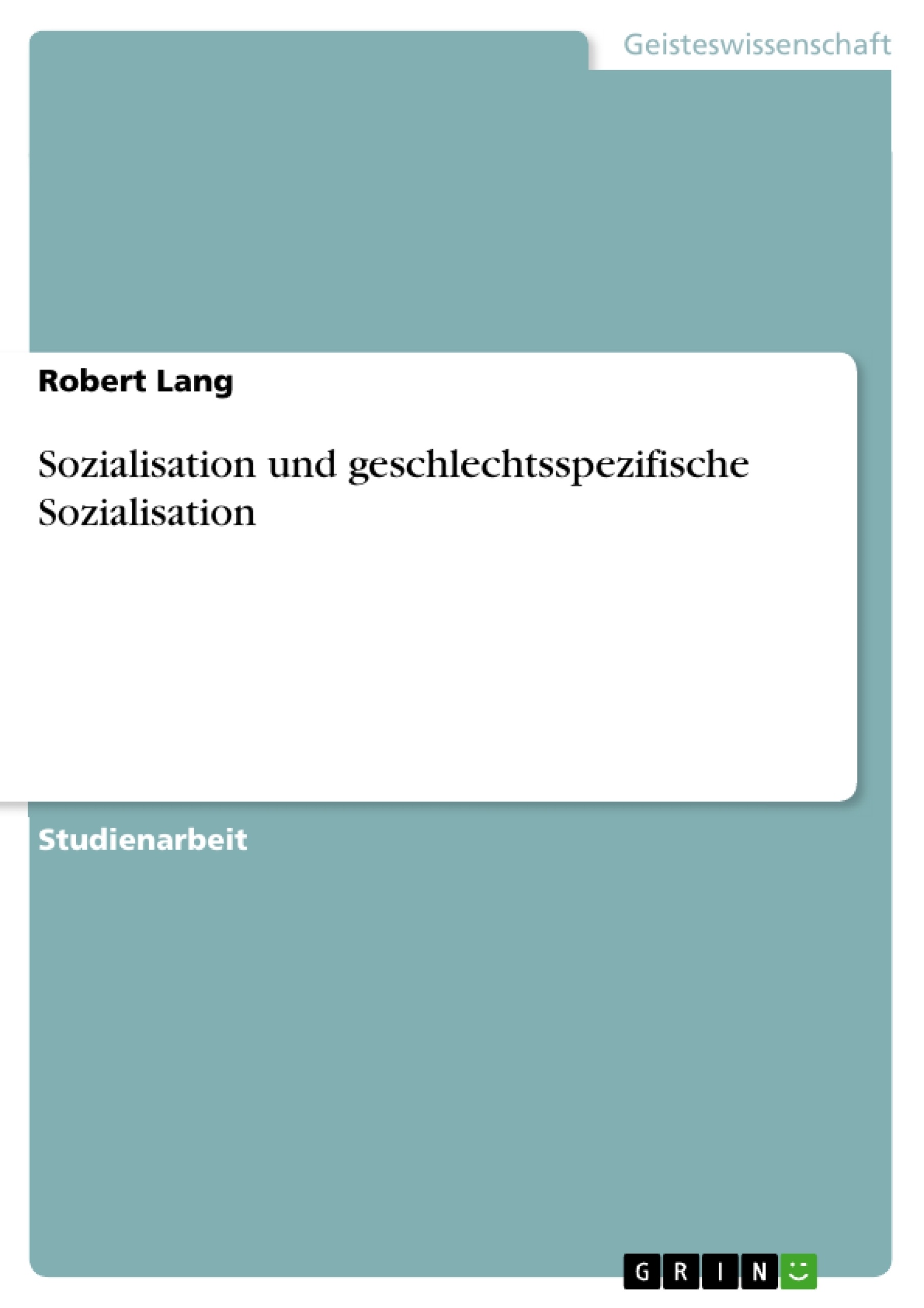Was macht uns zu dem, was wir sind? Dieser tiefgründige Einblick in die Mechanismen der Sozialisation und geschlechtsspezifischen Sozialisation enthüllt, wie wir von Geburt an durch Familie, Freunde, Schule, Beruf und Medien geprägt werden. Die Reise beginnt mit den grundlegenden Konzepten der Sozialisation, beleuchtet die prägende Frühentwicklung des Kleinkindes und die essenzielle Bedeutung von Bindungen für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Erfahren Sie, wie Kinder lernen, sich in der komplexen sozialen Welt zurechtzufinden, Rollen zu übernehmen und ein Bewusstsein ihrer selbst zu entwickeln. Ein Exkurs zu den Theorien von Freud, Mead und Piaget bietet einen faszinierenden Einblick in die unterschiedlichen Perspektiven auf die kindliche Entwicklung, während die Auseinandersetzung mit dem Leben ohne Sozialisationsprozess die Notwendigkeit von emotionaler Wärme und stabilen Beziehungen unterstreicht. Der zweite Teil widmet sich der Frage, inwieweit unser Verhalten biologisch bedingt ist und wie stark es durch die Sozialisation von Mädchen und Jungen beeinflusst wird. Die kritische Analyse verschiedener Theorien zu geschlechtsspezifischem Verhalten, darunter die Ansichten von Freud, Chodorow und Hagemann-White, wirft ein neues Licht auf die Konstruktion von Geschlechterrollen. Entdecken Sie, wie Kinder ihre geschlechtliche Rolle erlernen und welche Konsequenzen dies für ihre Identitätsentwicklung hat. Abschließend wird ein Ausblick auf die Möglichkeiten einer veränderten Geschlechterordnung gegeben, in der Kinder die Freiheit haben, ihre Identität jenseits polarisierter Rollenbilder zu entfalten. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die die komplexen Prozesse verstehen wollen, die uns zu dem machen, was wir sind, und die sich für eine Gesellschaft einsetzen, in der jedes Individuum sein volles Potenzial entfalten kann. Es regt zum Nachdenken über gesellschaftliche Normen, Erziehungspraktiken und die Bedeutung von Vielfalt an. Tauchen Sie ein in eine Welt der Erkenntnisse und entdecken Sie die verborgenen Kräfte, die unser Leben prägen. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für Eltern, Pädagogen, Sozialarbeiter und alle, die sich für die Entwicklung des Menschen und die Gestaltung einer gerechteren Gesellschaft interessieren. Ein Buch, das nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch zum Handeln inspiriert und neue Perspektiven eröffnet. Dieses Werk ist ein Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Natur und ein Wegweiser für eine Zukunft, in der Individualität und Gleichberechtigung Hand in Hand gehen.
Inhaltsverzeichnis
SOZIALISATION UND GESCHLECHTSSPEZIFISCHE SOZIALISATION
I. Sozialisation
1. Grundbegriffe der Sozialisation
2. Die Fr ü hentwicklung des Kleinkindes und die Bedeutung von Bindungen
3. Sozialisationsinstanzen
Die Familie
Peer-Gruppen
Schule
Beruf
Massenmedien
4. Leben ohne Sozialisationsproze ß
Exkurs: Theorien zur Entwicklung des Kindes
S. Freud
G. H. Mead
J. Piaget
Kritik an den Theorien und Übereinstimmungen in den Theorien
5. Resozialisation
II. Geschlechtsspezifische Sozialisation
1. Welche Verhaltensunterschiede sind biologisch bedingt?
2. Unterschiede in der Sozialisation von M ä dchen und Jungen
3. Theorien zu geschlechtsspezifischem Verhalten
S. Freud
N. Chodorow
C. Hagemann-White
4. Wie lernen Kinder ihre geschlechtliche Rolle?
5 Ausblick
III. Literaturverzeichnis
I. Sozialisation
Wir alle sind spätestens ab dem Zeitpunkt unserer Geburt einem Sozialisationsprozeß unterworfen, der unter anderem der Aufrechterhaltung unseres sozialen Systems dient, es uns aber auch ermöglicht, unsere Identität zu finden und zu entwickeln. Der Sozialisationsbegriff wurde erstmals in den 40er Jahren in der amerikanischen Forschungsliteratur explizit verwendet1 und die zentrale Bedeutung dieses Prozesses für das Individuum erkannt. Emil Durkheim2 prägte den Begriff des ,,kollektiven Bewußtseins", womit er meinte, daß die Normen und Werte, die einer Gesellschaft gemein sind, auch diese Gesellschaft zusammenhalten(vgl. Amann, Anton)3.
1. Grundbegriffe der Sozialisation
Sozialisation ist der Prozeß, in dem der Mensch in die ihn umgebende Gesellschaft und Kultur hineinwächst und zu einem gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt wird. In diesem Prozeß wird das Kind allmählich zu einer Person, die über Fertigkeiten und ein Wissen von sich selbst verfügt.
Im Unterschied dazu bezeichnet Erziehung jenes bewußte Handeln, dessen Ziel es ist, die Persönlichkeitsstruktur positiv zu beeinflussen.(vgl. Korte/Schäfers)4
Sozialisation findet immer im Rahmen von Gesellschaft, Kultur und Person statt, wobei diese Größen korrelativ sind, keine ist also ohne die andere denkbar, jede entsteht in und gegenüber den anderen (vgl. Stromberger/Teichert)5. Dieser Prozeß ist also immer abhängig von der jeweiligen Kultur, wobei aber auch diese Kultur einem ständigen Wandel unterworfen ist. So beginnen etwa alle Babys in einem bestimmten Alter zu lächeln. Da auch blinde Kinder im selben Alter beginnen zu lächeln, läßt dies die Annahme zu, daß dieses Verhalten angeboren ist. Später jedoch lernen Kinder, wann dieses Verhalten als passend empfunden wird, was zwischen verschiedenen Kulturen variiert. Nicht das Lächeln also wird erlernt, sondern wann und wo es als angemessen aufgefaßt wird. Außerdem dauert dieser Vorgang das ganze Leben hindurch an, wobei er jedoch im Kleinkindalter wesentlich intensiver ist als in späteren Jahren. Es handelt sich hier jedoch keinesfalls um eine ,,kulturelle Programmierung", bei der das Kind die Einflüsse seiner Umwelt passiv aufnimmt, sondern das Kind ist von Anfang an ein aktiv daran beteiligtes Wesen. Erwachsene reagieren auf das Verhalten des Kleinkindes in der Annahme, aus dessen Verhalten Schlußfolgerungen ziehen zu können, wie wir etwa annehmen, daß das Weinen eines Kindes Hunger, Unwohlsein oder Langeweile bedeuten könnte oder das Lächeln Zufriedenheit. Diese Auffassungen behandeln die Reaktionen als soziale Handlungen des Kleinkindes. Aber auch die Kinder haben sehr wohl die Möglichkeit, auf die Einflüsse ihrer Umwelt selektiv zu reagieren.
Zum Vorgang der Sozialisation ist die Bindung an bestimmte Individuen von großer Bedeutung. Die primäre Beziehung, die in den meisten Fällen diejenige zwischen Mutter und Kind ist, wird mit starken Gefühlen besetzt, auf deren Grundlage komplexe Prozesse des sozialen Lernens abzulaufen beginnen. (vgl. Giddens, Anthony)6
Ein grundlegendes Problem im Sozialisationsprozeß ist der Konflikt von personaler Autonomie und sozialer Determiniertheit der Person, denn die Person muß zur Übernahme der sozialen Normen gebracht werden, und gleichzeitig muß sie zur selbständigen Anwendung dieser Regeln in konkreten Situationen befähigt werden Dies ist nur durch die autonome Beteiligung der zu sozialisierenden Person möglich. Der einzelne wird geprägt durch die Erlebnisse unmittelbarer Interaktion, in denen von vornherein der Eigenanteil am sozialen Geschehen mit erfahren und die Möglichkeit individueller Autonomie zu einem primären Erlebnis wird. Sozialisation geschieht im Rahmen von Kommunikation und Interaktion, wobei für die soziale Interaktion das Vorhandensein allgemein anerkannter und geteilter Symbole wie etwa der Sprache Voraussetzung ist. Die Sozialisation einer Person im Rahmen von Interaktionen ist also ein Prozeß des Lernens von Symbolen und Rollen, wobei der einzelne lernt, sich in die Rollen anderer zu versetzen und dadurch die Erwartungen und Reaktionen anderer zu antizipieren und beim eigenen Handeln zu berücksichtigen. Dabei lernt das Individuum auch, sich selbst aus der Sicht der anderen zu sehen, was für den Aufbau des ,,Selbst" unbedingt notwendig ist. (vgl. Korte/Schäfers)7
2. Die Frühentwicklung des Kleinkindes und die Bedeutung von Bindungen
Im Alter von etwa drei Wochen kann ein Kleinkind seine Mutter oder eine sonstige primäre Bezugsperson von anderen Leuten unterscheiden. Es kann sie jedoch nicht als Person erkennen, sondern reagiert auf bestimmte Merkmale wie etwa die Stimme, Geruch oder die Art und Weise, wie es gehalten wird. Das Kind hat noch keinen Begriff für die Unterscheidung zwischen menschlichen Wesen und materiellen Gegenständen.
Mit etwa sieben Monaten verfestigt sich die Beziehung zur Bezugsperson. Die Mutter wird als eigenständige Person erkannt, die auch dann existent ist, wenn sie nicht unmittelbar sichtbar ist. Das Kind beginnt die ersten Erfahrungen mit der Zeit zu machen, denn das Kind erinnert sich an die Mutter und erwartet ihre Rückkehr. Kinder sind nun in der Lage, auch nach versteckten Dingen zu suchen, da sie beginnen zu verstehen, daß Dinge eine eigenständige Existenz haben, unabhängig davon, ob sie sie unmittelbar sehen können oder nicht. Im Alter von zwei bis drei Jahren entwickeln Kinder zunehmend die Fähigkeit, die Interaktionen und Emotionen anderer zu verstehen. Sie sind nun in der Lage, andere zu trösten, aber auch bewußt zu ärgern. (vgl. Giddens, Anthony)8
3. Sozialisationsinstanzen
Der Mensch durchläuft in seinem Sozialisationsprozeß mehrere Stadien. In der primären Sozialisation entwickelt sich ein Kleinkind zu einer sozialen Person, das Ergebnis ist der in der entsprechenden Gesellschaft handlungsfähige Mensch. Diesen Prozeß durchlaufen Kleinkinder in erster Linie in der Familie. Die sekundäre Sozialisation bezeichnet alle Vorgänge auf Basis der primären Sozialisation, die die Persönlichkeitsstruktur des einzelnen noch weiter verändern, wie dies in Peer-Gruppen oder in der Schule geschieht. (vgl. Korte/Schäfers)9
Die Familie
Sozialisationsinstanzen bezeichnen jene strukturierten Gruppen und sozialen Kontexte, innerhalb derer signifikante Sozialisationsprozesse ablaufen. Im Grunde gibt es so viele Sozialisationsinstanzen wie Gruppen, in denen wir uns bewegen. Aber in allen Kulturen ist die primäre Sozialisationsinstanz die Familie, wobei jedoch die Form der Familie sehr unterschiedlich sein kann. In modernen Familien wachsen Kinder oft in Haushalten auf, die aus Mutter, Vater und eventuell ein bis zwei Geschwistern bestehen, manche Kinder jedoch auch in Ein-Personen-Haushalten oder werden auch von verschiedenen Paaren von Müttern und Vätern versorgt, wie das etwa bei geschiedenen Eltern und Stiefeltern vorkommen kann. In vielen Kulturen sind aber auch Tanten, Onkel und Enkel häufig Teil eines einzelnen Haushaltes. In traditionellen Gesellschaften wird oft schon durch die Familie, in die das Kind hineingeboren wird die soziale Position des Kindes für den Rest seines Lebens festgelegt In modernen westlichen Gesellschaften ist diese Position nicht so sehr festgelegt, aber auch hier zeigt sich, daß Kinder eher selten größere Sprünge in höhere soziale Schichten machen, da die soziale Klasse der Herkunftsfamilie die Sozialisation nachhaltig beeinflußt. Die Kinder erwerben Verhaltensweisen und Ansichten, die typisch für die Eltern oder andere in ihrer unmittelbaren Umgebung sind. Aber natürlich übernehmen Kinder nicht fraglos die Perspektive ihrer Eltern, da sie auch die Möglichkeit haben, sie selektiv zu prüfen und zu übernehmen oder eben nicht zu übernehmen. Außerdem werden Kinder noch von einer Vielzahl anderer Sozialisationsinstanzen geprägt, die zu vielen Unterschieden in der Sichtweise von Kindern und der Elterngeneration führen.
Peer-Gruppen
Eine weitere wichtige Sozialisationsinstanz ist die Peer-Gruppe. Darunter versteht man eine Gruppe von etwa gleichaltrigen Kindern, die auf Freundschaft beruht. In manchen traditionellen Gesellschaften werden Peer-Gruppen als Altersstufen formalisiert, und es gibt bestimmte Zeremonien und Riten, die den Übergang des Einzelnen von einer Altersstufe zur nächsten markieren. Piaget und Mead haben beide auf die Bedeutung dieser Peer-Gruppen hingewiesen. Piaget etwa legte besonderes Augenmerk darauf, daß die Beziehungen in solchen Gruppen ,,demokratischer" und ,,egalitärer" sind als zwischen Eltern und Kind. Eltern haben doch mehr oder weniger die Möglichkeit, gewisses Verhalten zu erzwingen, was in diesen Gruppen nicht in dieser Form möglich ist. Obwohl ein Kind mit großem Durchsetzungsvermögen oder großer Körperkraft versuchen kann, andere zu dominieren, so beruhen diese Beziehungen doch auf wechselseitiger Zustimmung, und daher müssen oft Kompromisse geschlossen werden. In den Peer-Gruppen haben Kinder die Möglichkeit, gewisse Verhaltensregeln zu testen und zu erkunden.
Schule
Die Erziehung in der Schule ist eigentlich durch den festgelegten Lehrplan ein formaler Prozeß, aber in subtilerer Form auch eine Sozialisationsinstanz, da es neben dem Lehrplan auch das verborgene Curriculum gibt, welches das Lernen der Kinder beeinflußt. Hier müssen Kinder lernen, in der Klasse still zu sitzen, pünktlich zum Unterricht zu erscheinen und die Regeln der Schule zu befolgen. Aber auch die Reaktionen der Lehrer beeinflussen die Erwartungen, die die Kinder an sich selber haben. Das hat nun auch wieder Auswirkungen auf die spätere Berufswelt. Interessant ist hier auch, daß man annehmen müßte, daß die Schule es Kindern ermöglichen müßte, sich über die mit ihrem sozialen Hintergrund verknüpften Beschränkungen hinwegzusetzen und die soziale und wirtschaftliche Sprossenleiter hinaufzusteigen, wenn sie in der Schule erfolgreich sind. Man sollte also meinen, daß Menschen jene Positionen erreichen können, für die sie auf Grund ihrer Begabungen und Fähigkeiten geeignet sind. Tatsächlich aber verstärkt die Schulerziehung aber sehr oft noch die existierenden Ungleichheiten.
Beruf
Wie bereits erwähnt, ist der Übergang ins Berufsleben in unseren modernen Gesellschaften eine wichtige Sozialisationsinstanz, da der Einstieg ins Arbeitsleben ein weit einschneidenderes Erlebnis bedeutet als in traditionellen Gesellschaften, wo die Arbeit nicht so klar von anderen Aktivitäten getrennt ist. In modernen Gesellschaften verlangt die Arbeitswelt meist größere Anpassungen der Sichtweise oder des Verhaltens einer Person.
Massenmedien
Sozialisation findet aber nicht nur auf der persönlichen, sondern auch auf der unpersönlichen Ebene statt, nämlich durch Massenmedien wie etwa Zeitungen, Bücher und das Fernsehen, wobei bei Untersuchungen festgestellt werden konnte, daß Menschen wohl am meisten dazu neigen sich vom Fernsehen beeinflussen zu lassen Wenn sich Meldungen in Zeitungen von denen im Fernsehen unterschieden, neigen die Leute am ehesten dazu, der Fernsehversion Glauben zu schenken. Über den Einfluß des Fernsehens wurden generell schon unzählige Untersuchungen durchgeführt, wobei aber der Großteil dieser Untersuchungen zu keinem endgültigen Befund kommt. Beispielsweise konnte bis heute noch nicht schlüssig nachgewiesen werden, inwieweit die Darstellung von Gewalt das aggressive Verhalten von Kindern fördert. Zweifellos aber haben die Medien grundlegenden Einfluß auf die Einstellungen und Auffassungen der Leute durch die große Vielfalt von Informationen, die sie vermitteln.
Weiteren Sozialisationsinstanzen begegnen wir immer dann, wenn wir große Teile unseres Lebens in verschiedenen Gruppen oder sozialen Kontexten verbringen. Als weitere Sozialisationsinstanzen wären noch Vereine, Klubs oder religiöse Gemeinschaften zu nennen. (vgl. Giddens, Anthony)10
4. Leben ohne Sozialisationsprozeß
Mit ungefähr fünf Jahren ist ein Kind ein ziemlich autonomes Wesen, das eine gewisse Disziplin und Selbstregulierung beherrscht, wie etwa körperliche Bedürfnisse zu kontrollieren und sich mit ihnen in angemessener Weise auseinanderzusetzen. Sie sind in den Grundabläufen des häuslichen Lebens relativ unabhängig und bereit, sich weiter in die Außenwelt hinauszuwagen.
Dieses Stadium kann kein Kind ohne den Schutz und die Fürsorge von engen Bezugspersonen erreichen. Untersuchungen des Psychologen John Bowlby11. haben gezeigt, daß Kinder ohne enge und liebevolle Beziehung zu einer bestimmten Bezugsperson im späteren Leben unter ernsthaften Persönlichkeitsstörungen leiden. Bowlby behauptet auch, daß ein Kind, dessen Mutter kurz nach der Geburt stirbt, von Ängsten geplagt werden würde, die einen starken Einfluß auf seinen späteren Charakter haben würden, was als Theorie der mütterlichen Deprivation bekannt wurde. Dabei ist jedoch anzumerken, daß es nicht unbedingt die leibliche Mutter sein muß, mit der das Kind in engem Kontakt stehen muß, sondern daß es grundsätzlich einen dauerhaften und engen Kontakt zu einem anderen Menschen haben muß, um sich gesund entwickeln zu können.
Der Nachweis von Langzeitauswirkungen der frühkindlichen Deprivation ist naturgemäß schwierig, da keine Experimente durchgeführt werden können. Obwohl man aus Versuchen mit Affen nicht ohne weiteres auch auf Menschen schließen kann, zeigen Forschungen über menschliche Kinder doch Parallelen zu Beobachtungen, die im Tierreich gemacht wurden. So hat Harry Harlow Experimente mit Rhesusaffen durchgeführt, die er getrennt von ihren Müttern aufgezogen hat. Er hat dabei festgestellt, daß in Isolation aufgezogene Affen ein außergewöhnliches Ausmaß an Verhaltensstörungen gezeigt haben. Wenn sie mit anderen Affen zusammengebracht wurden, zeigten sie sich ausnehmend ängstlich oder feindselig und weigerten sich, mit ihnen zu interagieren. Außerdem waren sie unfähig, sich mit anderen Affen zu paaren. Affen, die zwar ohne die Mutter, aber mit anderen jungen Affen aufgezogen wurden, zeigten keine Verhaltensstörungen, woraus Harlow schloß, daß es für eine normale Entwicklung darauf ankommt, daß der Affe Beziehungen zu einem oder mehreren Artgenossen entwickeln kann, aber nicht so sehr, daß die leibliche Mutter anwesend ist.
So müssen auch Kinder die Möglichkeit haben, im Kleinkindalter und in der frühen Kindheit stabile und emotional enge Beziehungen mit zumindest einem anderen menschlichen Wesen einzugehen, um sich gesund entwickeln zu können.
Werden Kinder einer solchen Bindung beraubt, wie es beispielsweise durch eine Einweisung ins Krankenhaus geschehen kann, so verursacht die Trennung eine große emotionale Belastung für das Kind, und zwar am ausgeprägtesten im Alter von etwa sechs Monaten und vier Jahren. Dafür ist aber nicht so sehr die fremde Umgebung verantwortlich in die das Kind versetzt wurde, denn wenn die Mutter oder eine andere Bezugsperson ständig im Krankenhaus anwesend war, blieben die Konsequenzen aus.
Obwohl es nur seltene Beispiele von Kindern gibt, die mehr oder weniger gänzlich von anderen Personen isoliert waren, gibt doch beträchtliches Beweismaterial dafür, daß Personen, die während der Kindheit keine stabile Beziehungen hatten, sprachlich und intellektuell zurückgeblieben sind und große Schwierigkeiten haben, enge und dauerhafte Beziehungen mit anderen einzugehen. Ab dem Alter von etwa sechs bis acht Jahren wird die Behebung dieser Mängel immer schwieriger. (vgl. Giddens, Anthony)12
Exkurs: Theorien zur Entwicklung des Kindes
Wie Kinder zu einem Bewußtsein ihrer selbst kommen, also zu dem Bewußtsein, ein von anderen getrenntes Individuum zu sein, darüber wurden verschiedene Theorien aufgestellt. In den Prozessen, die dazu führen, ein Selbst-Bewußtsein zu entwickeln, werden wir auch zu sozialen Wesen, die mit anderen in geregelter Weise interagieren können.
Der Psychologe und Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud beschäftigte sich aus dem psychologisch-analytischen Ansatz heraus besonders damit, wie Kleinkinder lernen, ihre Ängste zu kontrollieren und mit den emotionalen Aspekten der Entwicklung des Kindes, wobei er dazu Erwachsene beobachtete und analysierte und daraus Rückschlüsse auf die frühkindliche Entwicklung zog.
Der amerikanische Philosoph und Soziologe George Herbert Mead befaßte sich in erster Linie damit, wie Kinder lernen, den Begriff des ,,Ich" zu verwenden.
Der Schweizer Erforscher des kindlichen Verhaltens Jean Piaget betrachtete die kindliche Entwicklung vor allem aus dem Blickwinkel der ,,Kognition" - er versuchte herauszufinden, wie Kinder lernen, über sich selbst und ihre Umgebung zu denken.
S. Freud
Nach der Lehre Freuds können Kinder nur dann zu einem autonomen Wesen werden, wenn sie lernen, die Anforderungen der Umgebung mit ihren dringenden Bedürfnissen, die aus dem Unterbewußten stammen, in Einklang zu bringen. Freud hat sich in seinen Untersuchungen hauptsächlich auf die Ablösung des Jungen von seinen Eltern konzentriert. Er meint, daß kleine Jungen lernen, daß sie sich von der Mutter ablösen müssen. Dabei empfindet der Knabe einen intensiven Antagonismus gegenüber dem Vater, da dieser die Mutter sexuell für sich vereinnahmt, was als Grundlage für den Ödipuskomplex gilt. Dieser Komplex wird überwunden, wenn das Kind seine erotischen Bindungen an die Mutter als auch den Antagonismus gegenüber dem Vater verdrängt. Wenn dies geschehen ist, hat sich das Kind von der frühen Abhängigkeit von den Eltern abgelöst und dadurch zu einer eigenen Identität gefunden. Freud setzt diesen Zeitpunkt beim Alter von ungefähr fünf Jahren an.
G. H. Mead
George Herbert Mead sieht die Entwicklung zur eigenständigen Person weniger von Spannungen ausgezeichnet als Freud, obwohl seine Auffassungen einige Ähnlichkeiten mit denen Freuds aufweisen. Seiner Meinung nach erwerben Kinder ein entwickeltes Selbst- Bewußtsein durch die Imitation anderer im Spiel. Dadurch schlüpfen sie in die Rolle der Erwachsenen, übernehmen die Rolle des anderen, und lernen auf diesem Wege, sich selbst mit den Augen anderer zu sehen. Selbst-Bewußtsein wird seiner Meinung nach erreicht, wenn zwischen mit ,,me" (,,ICH") und ,,I" (,,ich") unterschieden werden kann, wobei das ,,I" das unsozialisierte Kleinkind bezeichnet und das ,,me" das soziale Selbst. So wie Freud ist auch Mead der Meinung, daß Kinder ungefähr im Alter von fünf Jahren autonome Akteure werden, die sich selbst deuten können und außerhalb der unmittelbaren Familie agieren können
J. Piaget
Im Unterschied zu Freud und Mead, die Kinder nie direkt untersuchten, verbrachte Jean Piaget einen Großteil seines Lebens mit der Beobachtung von Kindern aller Altersstufen. Seine Arbeiten basieren auf der detaillierten Beobachtung einer beschränkten Anzahl von Individuen. Er wies besonders darauf hin, daß sich Kinder aktiv mit der Welt auseinandersetzen. Sie wählen und interpretieren die Dinge, die sie sehen, hören und fühlen. Aus seinen Beobachtungen von Kindern schloß er, daß der Mensch mehrere, deutlich abgegrenzte Stadien der kognitiven Entwicklung - also des Lernens, über sich selbst und seine Umgebung zu denken - durchläuft. Jedes Stadium hängt von der erfolgreichen Vollendung der vorhergehenden Phase ab und erfordert neue Geschicklichkeiten.
Von der Geburt bis zum ungefähren Alter von zwei Jahren durchläuft seiner Meinung nach das Kind das senso-motorische Stadium. Bis etwa dem Alter von vier Monaten kann ein Kind sich nicht von seiner Umwelt unterscheiden und kann auch Gegenstände nicht von Personen unterscheiden. Kleinkinder lernen nun durch die Berührung und Handhabung von Gegenständen und durch die physische Erforschung ihrer Umgebung über die Eigenschaften von Menschen und Gegenständen.
Im Alter von etwa zwei bis sieben Jahren befinden sich Kinder nach Piaget im prä- operationalen Stadium. Kinder erlernen jetzt die Sprache und können Wörter zur symbolischen Darstellung von Gegenständen und Bildern verwenden. Prä-operational nennt er diese Phase deshalb, weil das Kind seine sich entwickelnden geistigen Fähigkeiten noch nicht systematisch einsetzen kann. In dieser Zeit ist das Kind noch sehr egozentrisch, was nicht Selbstsüchtigkeit, sondern die Tendenz des Kindes bezeichnet, die Welt ausschließlich aus eigener Sicht zu interpretieren. Es kann beispielsweise nicht verstehen, daß andere Leute Gegenstände aus einer anderen Perspektive sehen als es selbst.
Die konkrete operationale Phase findet etwa im Alter von sieben und elf Jahren statt. Nun erwerben Kinder abstrakte logische Begriffe und sind nun fähig, Ideen wie jene der Kausalität ohne große Schwierigkeiten handzuhaben. Es kann nun mathematische Operationen wie Multiplikationen und Divisionen durchführen. Kinder sind nun auch schon wesentlich weniger egozentrisch.
Zwischen elf und fünfzehn findet die sogenannte formale operationale Phase statt, die jedoch nach Piaget nicht alle Erwachsenen erreichen, da die Entwicklung des formalen operationalen Denkens zum Teil von Bildungsprozessen abhängt. Er meint, daß Erwachsene mit weniger Schulbildung konkreter denken und große Überreste des Egozentrismus bewahren. Im formalen operationalen Stadium werden Kinder fähig, sehr abstrakte und hypothetische Ideen zu erfassen.
Kritik an den Theorien und Übereinstimmungen in den Theorien
An jeder dieser Theorien wurde auch viel Kritik geübt. So wurde an Freuds Theorie hauptsächlich die Idee kritisiert, daß Kleinkinder erotische Wünsche haben. Insbesondere vom Feminismus wurde Freud, wie wir später sehen werden, massiv kritisiert, da er seine Theorien hauptsächlich auf männliche Erfahrungen konzentrierte und ausschließlich vom männlichen Standpunkt betrachtete.
Mead wurde wesentlich weniger kritisiert als Freud, seine Theorien wurden aber auch nie in ausgestalteter Form publiziert. Seine Theorien liefern eher interessante Einsichten als eine allgemeine Interpretation der Entwicklung des Kindes.
An Piagets Arbeit wurde vor allem kritisiert, daß er seine Arbeit auf die Beobachtung einer kleinen Anzahl von Kindern stützte, die außerdem alle in derselben Stadt lebten, so daß eine solche Untersuchung sicher keine allgemeingültigen Ergebnisse liefern kann. Jedoch haben seine Ideen eine große Menge von Untersuchungen angeregt und viele seiner Ideen sind heute allgemein akzeptiert.
Es gibt aber auch einige interessante Verbindungen zwischen den Theorien. So sind sich alle drei Autoren einig, daß Babys in den ersten Monaten kein deutliches Verständnis von der Natur der Gegenstände und Personen seiner Umgebung oder seiner eigenen Identität haben. In den ersten zwei Lebensjahren erfolgt ein Großteil des kindlichen Lernens noch unbewußt, bevor die sprachlichen Fertigkeiten entwickelt sind, da das Kind noch über kein Selbst-Bewußtsein verfügt. Es scheint wahrscheinlich, daß Kinder durch den Prozeß der Differenzierung des ,,me" und ,,I" zu einem Bewußtsein ihrer selbst gelangen. (vgl. Giddens, Anthony)13
5. Resozialisation
Unter bestimmten Bedingungen kann eine erwachsene Person dem Vorgang einer Resozialisation ausgesetzt sein, wobei das Muster der vorher angenommenen Werte und Verhaltensmuster völlig zerstört und neu aufgebaut wird. Das kann vor allem dann geschehen, wenn Personen in eine geschlossene Organisation eintreten wie z. B. eine psychiatrische Anstalt, ein Gefängnis, eine Kaserne oder eine sonstige Umgebung, die von der Außenwelt abgesondert ist und straffe neue Verhaltensregeln aufweist. Besonders deutlich konnte eine rasche Änderung der Gesamtpersönlichkeit in Konzentrationslagern beobachtet werden. Häftlinge versuchten anfangs, ihre früheren Verhaltensweisen zu bewahren, was sich aber auf Dauer als unmöglich erwies. Durch Angst, Entbehrungen und Ungewißheit zerfiel die Persönlichkeit der Häftlinge. Manche verloren ihren Willen, ihre Initiative und das Interesse am eigenen Schicksal, worauf die meisten davon bald starben. Andere jedoch wurden in ihrem Verhalten wieder sehr kindlich und verloren das Zeitgefühl. Wer das erste Jahr im Konzentrationslager überlebte, wies meist eine völlig neue Persönlichkeit auf, er hatte einen Prozeß der Resozialisation durchgemacht, was es ihm ermöglichte, mit den Brutalitäten im Lager fertigzuwerden.
Dieser Vorgang der Resozialisation erfolgte durch die Imitation der Sichtweise und des Verhaltens der KZ-Wächter, so wie auch kleine Kinder die Erwachsenen nachahmen und dadurch lernen, sich durch deren Augen zu sehen.
Es scheint, daß in kritischen Situationen das Individuum durch die entstehenden Ängste, die denen eines Kleinkindes ähnlich sind, das des elterlichen Schutzes beraubt wurde, die erworbenen Reaktionen ablegt und die Persönlichkeit neu strukturiert wird.
II. Geschlechtsspezifische Sozialisation
Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts hat die Wissenschaft mit den Anfängen der Psychologie versucht, Unterschiede zwischen den Geschlechtern nachzuweisen, wobei sich die Soziologie weitestgehend mit einer Darstellung der geschlechtsspezifischen Unterschiede befaßte, die ebenso wie die Psychologie eine Überlegenheit des männlichen Geschlechts begründete und aufrecht erhielt.
Erst zu Beginn der 70er Jahre mit dem Aufkommen der neuen Frauenforschung begannen einige Forscherinnen, Untersuchungen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, indem sie versuchten, nicht nur Ergebnisse darzustellen, in denen Unterschiede zwischen den Geschlechtern sichtbar wurden, sondern auch eine Vielzahl von Daten veröffentlichten, in denen kein Geschlechtsunterschied erkennbar war. ,,Am Ende bleiben nur noch wenige Bereiche, in denen Unterschiede zwischen den Geschlechtern eindeutig belegt sind"14. In Untersuchungen hat sich nun herausgebildet, daß die Geschlechtsdifferenzen nicht von der patriarchalen Gesellschaftsstruktur zu trennen sind, wobei auch eindeutig eine Hierarchie im Geschlechterverhältnis festgestellt werden kann. (vgl. Brück, Brigitte et al)15
Dabei ist zwischen sexus" was die körperlichen Unterschiede meint und genus" das die psychologischen, sozialen und kulturellen Unterschiede bezeichnet, zu unterscheiden. (vgl. Giddens, Anthony)16
1. Welche Verhaltensunterschiede sind biologisch bedingt?
Bisher haben Frauen auf die Frage, worin sich die Geschlechter unterscheiden und warum das so ist, Antworten fast ausschließlich durch den Filter der patriarchalen Wissenschaft erhalten, wobei die Diskussion um die biologischen und kulturellen Anteile zur Erklärung der Geschlechtsunterschiede eine wichtige politische Funktion zur Aufrechterhaltung der bestehenden Geschlechtsrangordnung hat. Es wird immer wieder versucht, den Nachweis der Vorrangstellung des männlichen Geschlechts zu erbringen, um das Patriarchat als unüberwindbar erscheinen zu lassen.
Das Weibliche wird im traditionellen Verständnis verbunden mit Eigenschaften wie freundlich, hilfsbereit, sensibel, einfühlsam usw., während man Männern Eigenschaften wie Dominanz, Aggressivität, Kompetenz und Unabhängigkeit zuschreibt. Diese Vorstellungen bestimmen das Selbstbild von Männern und Frauen und entfalten als normative Leitbilder identitätsstiftende Wirksamkeit.
Damit verwandeln sich biologische Unterschiede in Zuschreibungen über männliche und weibliche Wesen an sich.
Da weder Gene noch Hormone ihre Wirkung unabhängig von Umwelteinflüssen entfalten, ist die Frage, welcher Bestandteil des Verhaltens biologisch bedingt ist, nach dem momentanen Stand der Wissenschaft nicht beantwortbar.
Einigermaßen erwiesen scheint zu sein, daß Männer aggressiver sind und Frauen größere verbale Fähigkeiten besitzen und Männer im visuell-räumlichen und mathematischen Denken überlegen sind, wobei sich die Ergebnisse von Untersuchungen je nach angewendetem statistischem Verfahren ändern. (vgl. Brück, Brigitte et al)17
Weiters konnte nachgewiesen werden, daß Verhaltensweisen und Vorstellungen vom Etikett abhängen, das einem Kind zugewiesen wird, womit biologische Unterschiede möglicherweise nicht als Ursache des unterschiedlichen Verhaltens, sondern als Signal dafür auftreten. (vgl. Giddens, Anthony)18
2. Unterschiede in der Sozialisation von Mädchen und Jungen
Normen und Werte werden offensichtlich unterschiedlich an die nächste Generation weitergegeben, wobei die Reaktionen der Kinder auf die unterschiedliche Behandlung durch die Erwachsenen lange Zeit als Imitations- oder Identifikationslernen der jeweiligen Geschlechterrolle beschrieben wurde. Simone de Beauvoir19 hat mit ihrem Ausspruch ,,Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es" einen Denkanstoß für die frauenfeindliche Sozialisation im Patriarchat gegeben.
Schon Babys werden von Erwachsenen völlig unterschiedlich behandelt, je nachdem ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Kleine Kinder lernen schon sehr bald, auch schon auf der non-verbalen Ebene, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu erkennen und beginnen bald, die Unterschiede ihres Verhaltens sowie des Verhaltens zueinander zu erkennen.
Selbst wenn Eltern sehr bemüht darum sind, ihre Kinder geschlechtsneutral zu erziehen, so stoßen sie bald an von außen gesetzte Grenzen, da sie einerseits unbewußt ihre Vorstellungen weitergeben und andererseits auch die Einflüsse der Umwelt nicht umgehen können. (vgl. Brück, Brigitte et al)20
In Kinderbüchern und Filmen werden seit einiger Zeit doch verstärkt Mädchen dargestellt, die Abenteuer erleben und außerhäuslichen Tätigkeiten nachgehen, aber nach wie vor werden kaum Jungen dargestellt die häusliche Tätigkeiten verrichten Auch Spielzeug wird nach wie vor stark geschlechtsspezifisch angeboten und beworben. Peer-Groups verstärken das bis dahin erlernte geschlechtsspezifische Verhalten im allgemeinen noch. In der Pubertät müssen Jungen, besonders solche der Unterschicht, sich davor hüten, ,,weibisches Verhalten" zu zeigen, um nicht als verweichlicht oder gar homosexuell zu gelten. Mädchen sind in dieser Zeit einem besonderen Druck ausgesetzt, die weibliche Rolle zu übernehmen. (vgl. Giddens, Anthony)21
3. Theorien zu geschlechtsspezifischem Verhalten
Zu den geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen wurden verschiedenste Theorien aufgestellt, die große Unterschiede aufweisen, je nachdem ob sie aus weiblicher oder männlicher Sicht erstellt wurden.
S. Freud
Für Freud22 war die Anatomie bestimmend für den Lebensweg von Jungen und Mädchen, wobei Frauen für ihn eine defizitäre Abweichung von der Norm darstellten, die den Mangel des Penis nur durch die Geburt eines Kindes kompensieren können. Jungen werden sich ihrer männlichen Identität durch die Verdrängung erotischer Gefühle gegenüber der Mutter und durch die Annahme der Überlegenheit des Vaters bewußt. Mädchen hingegen werten die ebenfalls ,,penislose" Mutter ab und übernehmen deren passive Haltung durch die Erkenntnis, nur die ,,Zweitbeste" zu sein. Damit stützt er sich jedoch auf eine Theorie, daß der Penis der Vagina von Natur aus überlegen ist. In seinen Theorien entpuppt sich außerdem ,,der <Mensch> ... regelhaft als Mann, der sich mit Selbstverständlichkeit als Repräsentant des Ganzen fühlt" (Christa Rohde-Dachser 1990)23.
Feministinnen haben an Freud unter anderem kritisiert, daß seine Psychoanalyse von einer Defizitperspektive ausgegangen ist und daß er die gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen die Entwicklungsprozesse vonstatten gingen, nicht berücksichtigte. Ebenso haben sie kritisiert, daß er grundsätzlich das ,,Männliche" höher bewertete und die Mutterschaft als biologische Bestimmung überbewertete. (vgl. Brück, Brigitte et al)24
N. Chodorow
Nancy Chodorow25 ist eine amerikanische Soziologin, die die Entwicklung der unterschiedlichen Geschlechtsidentität aus dem Ablösungsprozeß von der ersten Bezugsperson ableitet. Sie betont die Rolle der Mutter im Lernen der Geschlechtsunterschiede wesentlich stärker als Freud. Chodorow meint, daß der Prozeß der Ablösung von der Mutter entscheidend für die Entwicklung der Identität ist. Jungen müssen ihrer Meinung nach ihre ursprüngliche Nähe zur Mutter zerstören und erhalten ihr Männlichkeitsverständnis aus allem, was nicht weiblich ist. Das heißt also, daß männliche Identität durch Trennung gebildet wird, woraus sich ergibt, daß Männer später unbewußt ihre Identität bedroht fühlen, wenn sie mit anderen emotionell eng verbunden sind. Sie verdrängen ihre Fähigkeit, ihre eigenen Gefühle und die anderer zu verstehen. Sie müßten sich an einen Mann anlehnen können, der ihm ,,Männlichkeit" vorlebt, was aber selten möglich ist, da Männer überwiegend abwesend sind. Das Mädchen muß die Nähe zur Mutter nicht zerstören und kann so länger mit der Mutter verbunden sein. Damit hat sie auch später ein Gefühl der persönlichen Identität, das mehr Kontinuität zuläßt, sich aber auch hauptsächlich über Beziehungen definiert. Damit dreht sie Freuds Sichtweise insofern um, als sie das Männliche und nicht das Weibliche als defizitäres Geschlecht definiert. (vgl. Giddens, Anthony)26
C. Hagemann-White
Carol Hagemann-White27 hat festgestellt, daß in einer Gesellschaft, die ein System der Zweigeschlechtlichkeit etabliert hat, von allen Menschen verlangt wird, sich jeweils eindeutig dem einen oder dem anderen Geschlecht zuzuordnen, da Zwischenformen und Übergänge kulturell nicht zugelassen werden. Sie meint, daß Kinder sich die Geschlechtszugehörigkeit mit dem Erwerb der Sprache aneignen und sich deshalb in das System der Zweigeschlechtlichkeit einordnen weil dies eine lebenswichtige Anpassung bedeutet ohne die sie in einer geschlechtlich polarisierten Gesellschaft nicht existieren können. (vgl. Brück, Brigitte et al)28
4. Wie lernen Kinder ihre geschlechtliche Rolle?
Also nicht die biologischen Merkmale, sondern die Beziehungen und Interaktionen zwischen den Menschen unterschiedlichen Geschlechts liefern Kindern in der Zeit des Spracherwerbs wie eine Art ,,Grammatik" die notwendigen Anhaltspunkte für die Unterscheidung zwischen Frauen und Männern. Dabei lernen sie auch, daß Männer grundsätzlich höher bewertet werden und daß Mädchen ,,schlecht" oder doch zumindest ,,schlechter" als Jungen sind. Mädchen reagieren darauf oft mit Verweigerung der eigenen Körperlichkeit bis hin zur Magersucht, Überanpassung, Resignation und Selbsthaß.
Jungen finden hingegen keinen emotionalen Halt über die Identifikation mit dem Vater als Mann, da dieser meist abwesend ist und auch weil diese Identifikation mit dem Tabu der Homosexualität besetzt ist, was körperliche und emotionale Nähe nahezu ausschließt. (vgl. Brück, Brigitte et al)29
5. Ausblick
Die Frage, ob die Sozialisation oder die Biologie mehr zur Frau- bzw. Mann-Werdung beiträgt, ist nicht zu beantworten, da ,,Biologie" und ,,Soziologie" in Bezug darauf nicht zu trennen sind (Marianne Krüll 1989)30. Das Festhalten an biologischen Unterschieden dient denjenigen, die die Geschlechterdifferenz als Alltagstheorie durchzusetzen vermögen, also im Patriarchat der Unterordnung der Frau unter die Interessen der Männer. Wird das Frau- und Mann-Werden jedoch als Ergebnis des Sozialisationsprozesses angesehen, können Alternativen gesucht und gefunden werden. Weiters wäre es notwendig, daß Frauen sich nicht mehr an männliche Normen und Verhaltensweisen anpassen (müssen).
Hilge Landweer und Mechthild Rumpf31 führen den feministischen Ansatz ,,Alles ist Biologie" weiter, indem sie behaupten, ,,Biologische Unterschiede sind kulturell überformt" bis zur dekonstruktivistischen Sichtweise ,,Alles ist Kultur - inklusive der Biologie". Demnach können ,,die Begriffe Mann und m ä nnlich dann ebenso einfach einen weiblichen Körper bezeichnen" wie umgekehrt (Judith Butler, 1991)32. Das Patriarchat wird sich wohl erst dann ändern, wenn unsere Kinder die Chance bekommen, sich ihre Identität aus einer Vielfalt von möglichen Lebensformen anstatt der polaren Geschlechterrolle auszuwählen. (vgl. Brück, Brigitte et al)33
III. Literaturverzeichnis
Amann, Anton
Soziologie - Ein Leitfaden zu Theorien, Geschichte und Denkweisen (Grundlagen des Studiums) Böhlau Studienbücher, 4. Verbindl. Aufl. 1996 3
Beauvoir Simone de
Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. Reinbek 1968 16
Bowlby, John
Mutterliebe und kindliche Entwicklung. Mit e. Beitr. v. Mary D. Salter Ainsworth. Beiträge zur Kinderpsychotherapie Bd. 13. 3. Auflage, Reinhardt, München 1973 8
Brück, Brigitte, Kahlert, Heike, Krüll, Marianne et al
Feministische Soziologie. Eine Einf ü hrung. Campus Studium Bd. 1092. Erw. u. überarb. Neuausg. 1997 14
Butler, Judith
Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt am Main 1991 S.23 19
Chodorow Nancy
Das Erbe der M ü tter. Psychoanalyse und Soziologie der Geschlechter. München 1985 17
Durkheim, Emil
Ü ber die Teilung der sozialen Arbeit. Eingel. von N. Luhmann, übers. von L. Schmidts, Frankfurt 1977 3
Freud, Sigmund
Die Weiblichkeit. In: Ders:
Gesammelte Werke, Bd. XV, Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Frankfurt am Main 1933 S. 119-145 17
Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. In: Ders: Gesammelte Werke, Bd. V, Frankfurt am Main 1905 S. 27-145 17
Über die weibliche Sexualität. In: Ders: Gesammelte Werke, Bd. XIV, Frankfurt am Main 1931 S. 515-537 17
Giddens, Anthony
Soziologie. Hrsg. von Christian Fleck/H. G. Zilian, Graz/Wien, 1. Aufl, Graz 4
Grubitzsch, Siegfried, Rexilius, Günter (Hg.)
Psychologische Grundbegriffe. Mensch und Gesellschaft in der Psychologie. Ein Handbuch. Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1987 3
Hagemann-White, Carol
Frauenbewegung und Psychoanalyse. Basel, Frankfurt am Main.1979 18 Sozialisation: weiblich - männlich? Opladen 1984 S.11 14
Korte, Hermann, Schäfers, Bernhard (Hrsg.)
Eine Einf ü hrung in die Hauptbegriffe der Soziologie, Opladen 1992 3
Krüll, Marianne
Die Geburt ist nicht der Anfang. Die ersten Kapitel unseres Lebens, neu erz ä hlt. 4., durchges. Aufl., Stuttgart 1989 19
Landweer, Hilge, Rumpf, Mechthild
Kritik der Kategorie >Geschlecht < In: Feministische Studien 11 (2) 1993 S. 3-9 19
Rohde-Dachser, Christa
Weiblichkeitsparadigmen in der Psychoanalyse. In: Psyche 44 (1) 1990 17
Stromberger, Peter, Teichert, Will
Häufig gestellte Fragen zu "Sozialisation und Geschlechtsspezifische Sozialisation"
Was ist Sozialisation?
Sozialisation ist der Prozess, in dem ein Mensch in die ihn umgebende Gesellschaft und Kultur hineinwächst und zu einem gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt wird. Es beinhaltet das Erlernen von Fertigkeiten, Wissen und Verhaltensweisen, die in einer bestimmten Gesellschaft als angemessen gelten.
Was sind Sozialisationsinstanzen?
Sozialisationsinstanzen sind strukturierte Gruppen und soziale Kontexte, in denen signifikante Sozialisationsprozesse ablaufen. Beispiele sind Familie, Peer-Gruppen, Schule, Beruf und Massenmedien.
Welche Rolle spielt die Familie bei der Sozialisation?
Die Familie ist die primäre Sozialisationsinstanz. Sie vermittelt grundlegende Werte, Normen und Verhaltensweisen. Die soziale Schicht der Herkunftsfamilie beeinflusst die Sozialisation nachhaltig.
Wie beeinflussen Peer-Gruppen die Sozialisation?
Peer-Gruppen, Gruppen von Gleichaltrigen, ermöglichen es Kindern, Verhaltensregeln zu testen, soziale Interaktionen zu üben und Kompromisse zu schließen. Sie bieten eine "demokratischere" Umgebung als die Familie.
Welche Bedeutung hat die Schule als Sozialisationsinstanz?
Die Schule vermittelt nicht nur Wissen, sondern auch soziale Kompetenzen wie Pünktlichkeit, Disziplin und das Befolgen von Regeln. Das "verborgene Curriculum" beeinflusst die Erwartungen der Kinder an sich selbst.
Wie wirken sich Massenmedien auf die Sozialisation aus?
Massenmedien wie Fernsehen, Zeitungen und Bücher vermitteln Informationen und beeinflussen Einstellungen und Auffassungen. Es gibt Debatten über den Einfluss von Mediengewalt auf Kinder.
Was passiert, wenn Kinder ohne Sozialisationsprozesse aufwachsen?
Kinder, die ohne enge und liebevolle Beziehungen zu Bezugspersonen aufwachsen, können im späteren Leben unter Persönlichkeitsstörungen leiden. Frühkindliche Deprivation kann sprachliche und intellektuelle Rückstände sowie Schwierigkeiten beim Eingehen von Beziehungen verursachen.
Was ist Resozialisation?
Resozialisation ist ein Prozess, bei dem eine erwachsene Person ein Muster von vorher angenommenen Werten und Verhaltensweisen vollständig zerstört und neu aufbaut. Dies kann in geschlossenen Organisationen wie Gefängnissen oder psychiatrischen Anstalten geschehen.
Was ist geschlechtsspezifische Sozialisation?
Geschlechtsspezifische Sozialisation bezieht sich auf die Art und Weise, wie Normen, Werte und Verhaltensweisen unterschiedlich an Mädchen und Jungen weitergegeben werden. Sie beeinflusst das Verständnis von Geschlechterrollen und Identität.
Welche Rolle spielen biologische Faktoren bei Geschlechtsunterschieden?
Die Debatte über biologische und kulturelle Anteile zur Erklärung der Geschlechtsunterschiede ist komplex. Es gibt Hinweise auf biologische Unterschiede in Bezug auf Aggressivität, verbale Fähigkeiten und räumliches Denken, aber die Umwelt spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Wie werden Mädchen und Jungen unterschiedlich sozialisiert?
Babys werden je nach Geschlecht unterschiedlich behandelt. Kinder lernen frühzeitig, Geschlechtsunterschiede zu erkennen und ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Spielzeug, Kinderbücher und Peer-Gruppen verstärken geschlechtsspezifische Verhaltensweisen.
Welche Theorien gibt es zu geschlechtsspezifischem Verhalten?
Es gibt verschiedene Theorien, darunter Freuds psychoanalytische Theorie, Chodorows Theorie über die Bedeutung der Mutter-Kind-Beziehung und Hagemann-Whites Theorie über die Anpassung an das System der Zweigeschlechtlichkeit.
Wie lernen Kinder ihre Geschlechterrolle?
Kinder lernen ihre Geschlechterrolle durch Beziehungen und Interaktionen mit Menschen unterschiedlichen Geschlechts, insbesondere durch Sprache. Sie erkennen, dass Männer oft höher bewertet werden, was zu unterschiedlichen Reaktionen bei Mädchen und Jungen führen kann.
Was sind die Perspektiven für die Zukunft der Geschlechterrollen?
Die Trennung von "Biologie" und "Soziologie" ist in Bezug auf Geschlechterrollen schwierig. Die Akzeptanz von Geschlechterdifferenz dient oft der Aufrechterhaltung der Unterordnung der Frau. Alternative Ansätze betrachten die Geschlechterrollen als Ergebnis von Sozialisationsprozessen und suchen nach neuen Lebensformen.
- Citar trabajo
- Robert Lang (Autor), 2002, Sozialisation und geschlechtsspezifische Sozialisation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107259