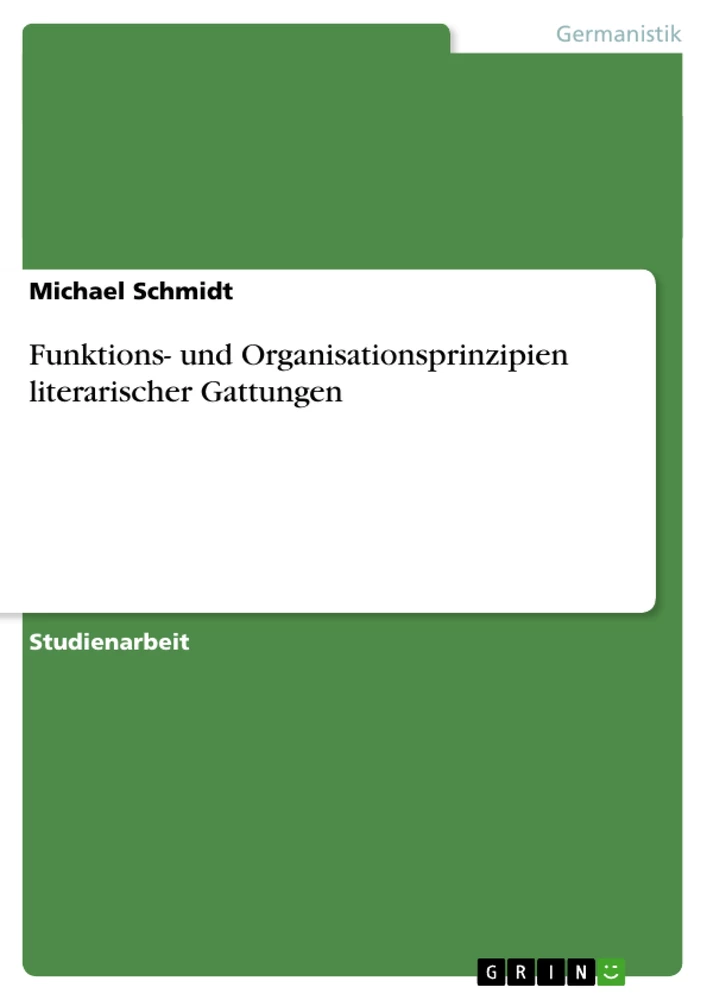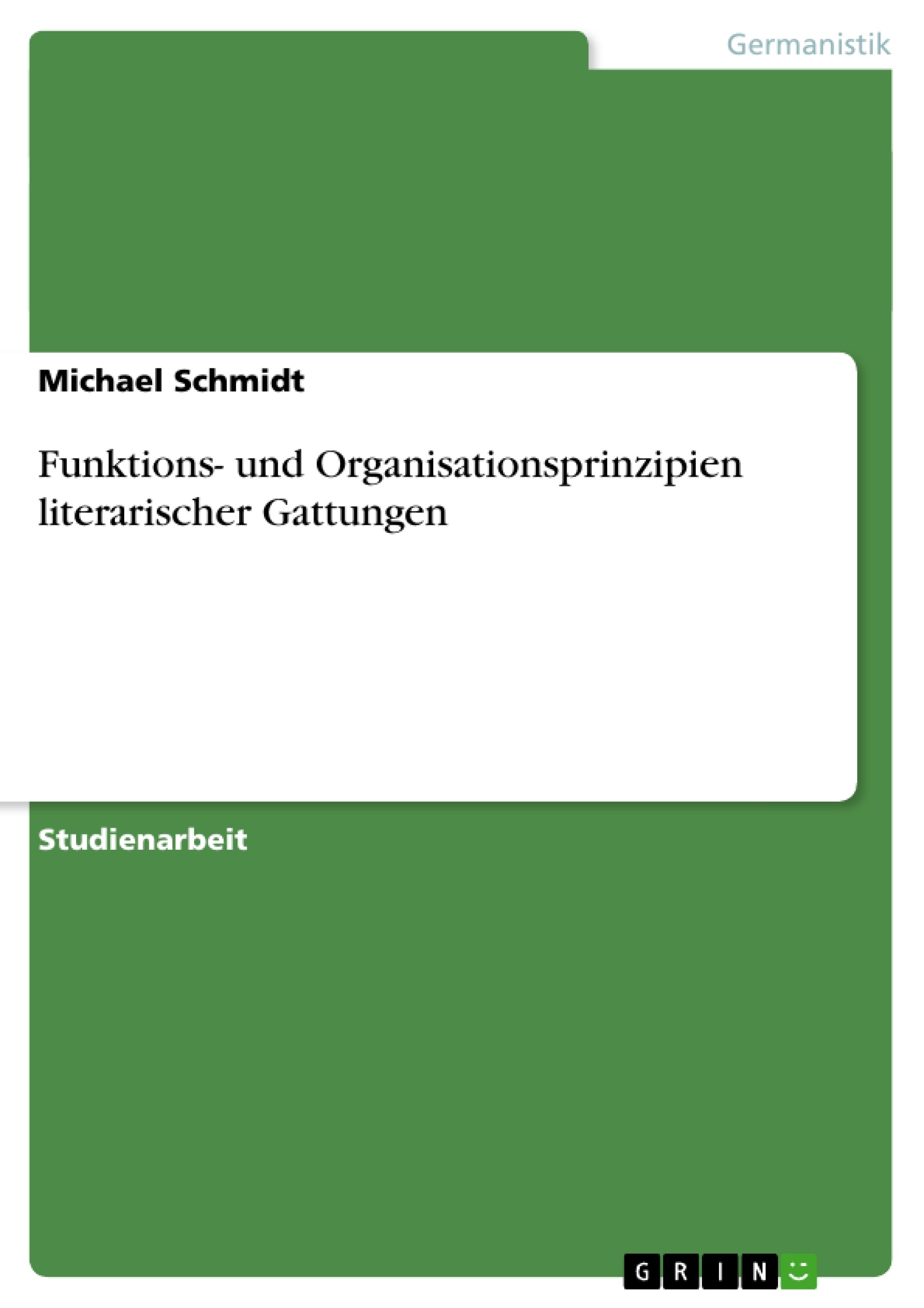Haben Sie sich jemals gefragt, warum wir literarische Texte in Schubladen stecken? Tauchen Sie ein in eine fesselnde Analyse der Theorien zur Einteilung literarischer Gattungen, die das Fundament unseres Verständnisses von Literaturwissenschaft bilden. Diese Arbeit seziert die vielfältigen Ansätze, von den normativen Trias-Modellen Goethes, Hegels und Staigers, die nach einer natürlichen Ordnung der Dichtkunst streben, bis hin zu den kommunikationsorientierten Konzepten des russischen Formalismus und Hans Robert Jauß', welche die historische und gesellschaftliche Bedingtheit literarischer Formen betonen. Entdecken Sie, wie formale, mediale und inhaltliche Kriterien ineinandergreifen, um die Grenzen zwischen Lyrik, Epik und Dramatik zu definieren, und warum diese starren Kategorien in der modernen Literatur oft an ihre Grenzen stoßen. Die Untersuchung beleuchtet die Schwächen der traditionellen Modelle, die dazu neigen, Werke aufgrund ihrer Unvereinbarkeit mit vorgegebenen Schemata auszuschließen, und eröffnet gleichzeitig neue Perspektiven auf die dynamische Beziehung zwischen Literatur, Gesellschaft und Leser. Erfahren Sie, wie Jauß' rezeptionsgeschichtlicher Ansatz eine flexiblere und umfassendere Methode bietet, um literarische Texte in ihrem jeweiligen historischen und kulturellen Kontext zu erfassen und zu bewerten. Diese tiefgreifende Analyse ist ein Muss für jeden, der sich für Literaturtheorie, Gattungslehre und die fortwährende Evolution literarischer Formen interessiert. Lassen Sie sich von den vielschichtigen Argumentationen fesseln und erweitern Sie Ihren Horizont im Bereich der Literaturwissenschaft.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1. Definitionen
2.2. Kriterien zur Einteilung
2.3. Die Hauptrichtungen der Theorien zur Gattungseinteilung
2.3.1.Normative, geschichtsphilosophisch und anthropologisch begründete Trias-Modelle
2.3.1.1. Die „Naturformen der Poesie“ Goethes
2.3.1.2. Die Dialektik Hegels
2.3.1.3. Die anthropologisch begründete Trias Staigers
2.3.1.4. Trias-Modell nach Sprachfunktion Bühlers
2.3.1.5. Bewertung der normativen, geschichtsphilosophisch und anthropologisch begründeten Trias-Modelle
2.3.2. Die kommunikationsorientierten und struktur- und funktionsgeschichtlich ausgerichteten Gattungskonzepte
2.3.2.1. Der russische Formalismus
2.3.2.2. Sozial- und funktionsgeschichtliche Gattungsbestimmung H.R. Jauß´
2.3.2.3. Bewertung
3. Gegenüberstellung der Hauptströmungen der Theorien zur Einteilung der literarischen Gattungen
4. Quellen- und Literaturverzeichnis
4.1.Sekundärliteratur
4.2.Sachbibliografie
1. Einleitung
Im Rahmen des Grundkurses „Einführung in die Literaturwissenschaft“ soll sich die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit mit dem Thema: „Wie lassen sich literarische Texte (Gattungen) voneinander abgrenzen und in ihren Funktions- und Organisationsprinzipien bestimmen?“ beschäftigen.
Weil die Problematik der Einteilung von Literatur so wichtig für die Literaturwissenschaft im allgemeinen ist, wird sie dementsprechend vielgestaltig diskutiert. Literaturwissenschaftler vieler Epochen und Schulen haben sich der Frage angenommen und viele unterschiedliche Ansätze entwickelt. Die Vielfalt der Theorien hat mich fasziniert und festgehalten. Um die Frage nach den Möglichkeiten einer Abgrenzung der literarischen Texte zu beantworten, werden nach einer Definitionserläuterung der wichtigsten Begriffe die Ordnungskriterien erläutert. Dann werden die hauptsächlichen Strömungen der Theorien zur literarischen Gattungseinteilung anhand einiger Vertreter vorgestellt und sowohl einzeln als auch ingesamt gegenübergestellt und bewertet. Als Literatur standen neben Artikeln aus dem Sachwörterbuch der Literatur Aufsätze von Wilhelm Voßkamp, Bernd Hamacher, Josef Körner und Monografien von András Horn, Karl Bühler auch Auszüge aus Goethes, Hegels und Staigers Werken zur Verfügung. Am Schluß soll eine Sachbibliografie die Möglichkeit zu weiterer Recherche geben.
2. Hauptteil
2.1. Definitionen
Bevor die Möglichkeiten, Literatur in Gattungen einzuteilen, erläutert werden, sollen zunächst Definitionen geliefert werden.
Wozu sind Gattungen überhaupt nötig? Sie sind als gemeinsame Grundlage für alle geltend und bewirken eine Vorstrukturierung der Erwartungshaltung.
Eine Gattung bildet sich heraus durch Stabilisierung und Institutionalisierung der Lesererwartungen.
Der Begriff „Gattung“ ist eine Sammelbezeichnung für literarische Gruppen und Formen. Gattungen sind heutzutage nicht erstarrte, konventionelle und normsetzende Formen, sondern hilfsweise Ordnungsschemata zur Klassifizierung von literarischen Werken.1
Gattungstheorien verhelfen zum besseren Verständnis der Literatur als ganzer. Durch die literarischen Gattungen erkennt man die Hauptmöglichkeiten der Literatur, etwas von dem, was sie zur Literatur macht; aber auch etwas vom Wesen des Menschen, der immer wieder Werke gerade dieser Gattungen produziert und genießt.
2.2. Kriterien zur Einteilung
Verschiedene Kriterien, um literarische Werke einzuteilen stehen zur Verfügung.
Werden formale Kriterien benutzt, so wird nach dem Druckbild geordnet, also nach Merkmalen wie einer Versform, dem Umfang des Textes, Schriftgröße anderen.
Die nächste Möglichkeit einer Einteilung ist durch die Unterscheidung nach medialen Kriterien gegeben. Es werden hier die Werke nach den Medien unterteilt, für die sie verfasst wurden. Hier geht die Aufteilung beispielsweise vom Hörspiel bis zur Internetliteratur.
Auch inhaltliche Kriterien zur Gattungsbestimmung sind denkbar.
Meist werden Gattungen durch eine Vermischung von formalen, medialen und inhaltlichen Kriterien bestimmt.2
2.3. Die Hauptrichtungen der Theorien zur Gattungseinteilung
Grundsätzlich lassen sich zwei Hauptrichtungen zur Gattungseinteilung unterscheiden. Eine lässt sich von normativen, geschichtsphilosophischen oder anthropologischen Prinzipien leiten. Die zweite Hauptrichtung hebt den kommunikativen und historischen Charakter von literarischen Gattungen hervor.
Die Dreiteilung der Gattungen war in der Antike unbekannt, auch wenn die Begriffe Lyrik, Epik, Dramatik und Poetik damals geschöpft worden waren. Sie dienten in antiker Zeit eher der Bestimmung von einzelnen Dichtarten.
Die Lyrik wird als die subjektivste Gattung bezeichnet, „[…]die innere Welt, das betrachtende empfindende Gemüt, das, statt zu Handlungen fortzugehen, vielmehr bei sich als Innerlichkeit stehen bleibt[…]“3 Nicht nur die Intensität des verdichteten Gefühls oder die Erlebnisstärke, sondern auch die Durchdringung, Verdichtung und Bewegung des Sprachmaterials zu künstlerischer Gestaltung sind wesentliche Kriterien der Lyrik. Lyrische Literatur ist reich an sinnverdichtenden Bildern, Symbolen und Chiffren.
Epik ist die erzählende Dichtung, als Vermittlung zwischen Ereignis und Zuhörer. Stets steht die Handlung im Vordergrund. Sie gilt als mittlere der drei Gattungen, weil sie objektiver als die Lyrik ist, aber subjektiver als die Dramatik, da die Vorgänge weder im Innern des Dichters spielen, noch in darstellenden Personen objektiv vorgeführt werden.4 In epischer Literatur werden die Vorgänge als vergangen dargestellt, wohingegen in dramatischen Texten die Handlung als vollkommen gegenwärtig übermittelt wird. Zwischen Ereignis und Leser herrscht in epischen Texten eine zeitliche und räumliche Distanz, die über den Erzähler verringert wird.5
Dramatische Literatur wirkt durch die Geschlossenheit der Handlung, die durch Dialoge, Monologe oder die szenische Darstellung auf der Bühne den Rezipienten einbindet. Grundbestandteil dramatischer Texte ist eine Spannung durch entgegengesetzte Kräfte oder gegensätzliche Handlungen, die in wechselwirkenden Aktionen die dramatische Handlung entfalten.6
2.3.1.Normative, geschichtsphilosophisch und anthropologisch begründete Trias-Modelle
2.3.1.1. Die „Naturformen der Poesie“ Goethes
Für die erste Hauptrichtung steht als zu allererst Goethes Modell, die Trias der Naturformen, auch organologische Trias genannt wird. Goethe war der Meinung, alle Texte müssten unbedingt den drei Hauptgattungen zu- oder untergeordnet werden. Diese beschrieb er folgenderweise:
„…die klar erzählende, die enthusiastisch aufgeregte und die persönlich handelnde: Epos, Lyrik und Drama.“7 Goethe sah hier die Ureinteilung, die aus den Grundfunktionen des seelisch-geistigen Lebens erwachsen war.
Weiter unterteilte Goethe die drei Hauptgattungen in historisch bedingte und variable Untergattungen und Genres. Als Beispiel sei hier die Unterteilung von Lyrik in unmittelbare, reine Lyrik und in mittelbare Lyrik genannt.
Historisch bedingt waren diese Untergattungen nach Goethes Auffassung deshalb, weil er die mittelbare Lyrik als zweitrangig gegenüber den ältesten Formen der Lyrik, den Liedern sah.
Nochmalige Unterteilungen der Untergattungen erfolgten idealerweise nach formalen Kriterien, wie an den Beispielen Sonett, Briefroman und Einakter verdeutlicht. Andererseits wurde manchmal inhaltlich kategorisiert: Der Bildungsroman als Darstellung der Entwicklung einer einzelnen Person und Gespenstergeschichten sollen als Beispiele genügen.8
Bei manchen Werkarten wie Novellen, Hymnen, Tragödien und Komödien geben formale und inhaltliche Kriterien in Gemeinschaft die Anhaltspunkte.
Die Problematik dieser Gattungstrias ist der Punkt, auf den sie ursprünglich baut, den sie eigentlich als Vorteil sah. Die strenge Normierung, der zwingende Charakter und eine genaue Begrenzung der Werkarten sind zum Hindernis geworden. Kunstformen, die unfreiwillig oder absichtlich unpassend für dieses Schema sind, müssten aus dem Bereich der Literatur verwiesen werden. Nur unvermischte Reinformen der Literatur, deren Vorbilder meist musterhaft aus der Antike übernommen sind, können nach Goethes Schema eingeordnet werden. Zudem sind Goethes „Naturformen der Poesie“ tendenziös: Epik wird in Groß-, Mittel- und Kleinformen unterschieden, die Literatur also teilweise entwürdigt, als wäre eine Kleinform weniger wert als die seiner Meinung nach einzig wahre Großform, das antike Epos.
2.3.1.2. Die Dialektik Hegels
Hegels Dialektik ist ein Beispiel für eine Gattungsbildung nach geschichtsphilosophischen Prinzipien.
Epische Poesie sei die Form der Darstellung der äußeren Realität, eine objektive Darstellung von Handlungen. Nach der Methode der Dialektik beinhaltet die Lyrik die Darstellung des Subjektiven, geschildert würden Emotionen an Stelle von Handlungen. Damit bilde die Lyrik einen Gegenpol zur Epik. Die Dramatik sah Hegel als Verknüpfung Objektivität der Epik und der Subjektivität der Lyrik, weil „[…]wir ebenso sehr eine objektive Entfaltung als auch deren Ursprung aus dem Inneren von Individuen vor uns sehen, so dass sich das Objektive somit als dem Subjekt angehörig darstellt, umgekehrt jedoch das Subjektive einerseits in seinem Übergange zur realen Äußerung, andererseits in dem Lose zur Anschauung gebracht ist, das die Leidenschaft als notwendiges Resultat ihres eigenen Tuns herbeiführt.“9
Hegel kam mit dieser Schlussfolgerung zu einer Abfolge der Dichtarten in der Literaturgeschichte, an deren Abschluss ein „Ende der Kunst“ stehe. Dieses bestünde aus einer Selbstbeschäftigung der Literatur mit sich selbst, also einer Selbstreferentialität. Die Kunst allgemein würde nichts wirklich Neues mehr erschaffen.10
Die Problematik bei Hegels Dialektik ist die Zweideutigkeit der verwendeten Begriffe Subjektivität und Objektivität. Besonders zeigen sich die Zuordnungsschwierigkeiten bei Dramen. In der Lyrik ist der Autor das Subjekt, der über seine innere Welt reflektiert. Die Subjektivität des Dramas hat einzelne Personen zum Subjekt, die sich „lyrisch“ verhalten können, also auf eine innere Welt bezogen und aus ihrer Perspektive über Äußeres berichten. Jedoch ist dies kein dramentypischer Zwang, meist sprechen und handeln sie, um ihren eigenen Willen zu demonstrieren oder durchzusetzen. Hier verschiebt sich die Definition von „subjektiv“ vom Auktorialen wie in der Lyrik dahingehend, dass Subjektivität nur das Handeln der Personen von innen her bedingt. Ähnlich zeigt sich die Zweideutigkeit des Begriffes „Objektivität“.
Solche Ungenauigkeiten bei Definitionen zeigen den Misserfolg von Hegels Systematisierungsversuchen.11
2.3.1.3. Die anthropologisch begründete Trias Staigers
Emil Staiger begründete 1946 in den „Grundbegriffe[n] der Poetik“ seine Version der Gattungstrias anthropologisch. Er teilte die verschiedenen Dichtarten den Dimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu. Die Vergangenheit ist seiner Meinung nach in Form der Erinnerung bei lyrischen Texten repräsentiert, die Gegenwart als Vorstellung in der Epik und die Zukunft als Dimension ist in Form der Spannung in dramatischen Werken vertreten. Staiger ging davon aus, dass nicht die historischen Aspekte von vorherrschenden Werkarten durch die Literaturgeschichte hindurch die Gattungsbildung bestimmen, sondern das menschliche Grundempfinden von Emotionalem, Bildlichem und Logischem, welches das Wesen des Menschen ausmacht.
2.3.1.4. Trias-Modell nach Sprachfunktion Bühlers
Eine weitere Möglichkeit der Gattungssystematisierung ist, die Dichtarten nach den Funktionen der für sie typischen Rede einzuteilen. Dazu muss man sich die Frage stellen: Was will der Sprechende mit der Rede erreichen? Grundlegende Überlegungen zu dem Verhältnis zwischen Gattung und Sprachfunktion hat Karl Bühler angestellt12. Er unterschied zwischen drei Funktionen der Sprache.
Sprache könne Gegenstände und Sachverhalte darstellen, ihre Einstellung zum Gemeinten kundgeben und an die Adressaten appellieren, um ein Verhalten auszulösen. Bühler stellte in seinen Überlegungen fest, dass in der gesprochenen Rede fast immer alle drei Funktionen beisammen sind, jedoch in unterschiedlicher Dominanz. Den weiteren Funktionen der Sprache, wie der metasprachlichen, phatischen oder poetisch-ästhetischen entsprechen nach Bühlers Ansicht keine speziellen Literaturgattungen.
Eine Schwäche in der Konzeption liegt jedoch bei der Inkonsequenz im Wechsel vom Autor zur handelnden Gestalt. Ein Autor will kundtun und darstellen, aber die Gestalt kann auslösen.
2.3.1.5. Bewertung der normativen, geschichtsphilosophisch und anthropologisch begründeten Trias-Modelle
Das allgemeine Problem der triadischen Gattungssysteme ist die starke Normierung, Präskription. Vorgeschrieben ist, wie Literatur zu sein hat, welche Merkmale ein Werk aufweisen muss, um episch, dramatisch oder lyrisch zu sein. Die ideale künstlerische Literatur ist demnach rein und unvermischt mit den Merkmalen anderer Dichtarten. Verschiedene Formen der Literatur werden kurzerhand aus dem Bereich von Kunst verwiesen oder sind sehr schlecht zuzuordnen. Dazu zählt die ältere didaktische Lehrdichtung oder verschiedene Gebrauchsformen der Literatur wie Briefe, Essays, Dokumentarstücke oder Tagebücher. Der Versuch, für diese Dichtarten eine Extra-Gattung zu schaffen verdeutlicht die Unzulänglichkeit der Trias-Modelle, zumal die grundsätzliche Idee einer natürlichen Ordnung verworfen wird. Eine Rest- und Sammelklasse umfasst doch wieder eine Unmenge an verschiedenen Arten von Kunst, für die keine verbindenden Kriterien gelten, als dass sie nicht zu Lyrik, Epik oder Drama passen, also nicht- fiktional sind.
Eine Chance zur Lösung der Probleme der triadischen Modelle ergibt sich, wenn man statt von Dichtungsklassen von den Eigenschaften als Wesenszüge und Sammelbegriffe spricht. Staiger hat diese Überlegung folgenderweise zum Ausdruck gebracht: „Lyrik braucht keineswegs lyrisch zu sein, und Lyrisches gibt es nicht nur in der Lyrik. […]Lyrik: das ist ein Sammelbegriff, ein Fach, in das Gedichte, kurze Stücke in Versen eingelegt werden. Der Ausdruck `lyrisch´ dagegen bezeichnet einen stilistischen Wesenszug, an dem eine einzelne Dichtung mehr oder minder Anteil haben kann.“13
2.3.2. Die kommunikationsorientierten und struktur- und funktionsgeschichtlich ausgerichteten Gattungskonzepte
Die zweite Hauptströmung beinhaltet die kommunikationsorientierten und struktur- oder funktionsgeschichtlich ausgerichteten Gattungskonzepte.
In diesen Konzepten werden die Organisationsprinzipien der triadischen Modelle verworfen. Stattdessen werden die literarischen Gattungen als historisch bedingte Kommunikations- und Vermittlungsformen angesehen.
Literarische Gattungen gelten als soziokulturelle, literarisch-soziale Konsensbildungen und nicht als normative, transgeschichtliche Formkonstanten.14
2.3.2.1. Der russische Formalismus
Verschiedene russische Literaturwissenschaftler haben ihre Gattungstheorie als literarische Evolution verstanden.15 Sie untersuchten verschiedene Textkonstanten und deren Abweichungen, damit wollten sie literarische Typenbildungen rekonstruieren. Die Verbindung der Gesetzmäßigkeiten der literarischen Evolution, also des Entstehens mit Blüte und Verfall der Gattung mit sozialen und historischen Einflüssen verzerren jedoch die Analyseergebnisse und sind nur schwerlich auszuschalten.16 Perspektiven auf den Ablauf der Zeit und dominantere oder schwächere Einflüsse machen eine ständige Neubewertung nötig.
2.3.2.2. Sozial- und funktionsgeschichtliche Gattungsbestimmung H.R. Jauß´
Hans Robert Jauß hat einen rezeptionsgeschichtlichen Ansatz entwickelt. Er vertritt die Ansicht, literarische Gattungen seien durch einen zeitlich Prozess fortgesetzter „Horizontstiftung und Horizontveränderung“ zu bestimmen. Jauß analysierte verschiedene formale und prägende Dominanten und erweiterte die Untersuchungen um die Frage nach dem Erwartungshorizont der zeitlich nahen Rezipienten. Dadurch werden die Entstehung und Ausprägung literarischer Gattungen entscheidend beeinflusst.17 Jauß ist der Meinung, dass erst durch die wechselseitige Analyse von verschiedenen „Erwartungen“ und den „Antworten“ der Werke eine Gattungsgeschichte genauer ermittelbar ist.
Um jedoch gattungstheoretische Untersuchungen anstellen zu können, sind sozial- und funktionsgeschichtliche Analysen noch ausstehend. Im Rahmen dieser Analysen werden die Selektionsstruktur der literarischen Gattungen und das Verhältnis der Selbstständigkeit der jeweiligen Gattung zu der Abhängigkeit zur Gesellschaft und der Zweckbedingtheit beleuchtet.
Die Selektionsstruktur ist die Anhäufung von Text- und Lesererwartungen, die im sozialen und literarischen Kontext stehen. So müssen immer die literatur- und zeitgeschichtlichen Verbindungen angegeben werden, um das Verhältnis einer besonderen Gattung zu anderen Formen der Literatur darzustellen.
2.3.2.3. Bewertung
Bei dieser Gattungstheorie werden die Zweckformen auf natürliche Weise mit eingebunden, weil sich die gesamte Literatur den Fragestellungen nach relativer Selbstständigkeit und gesellschaftlicher Abhängigkeit stellen muss. Hier wird auch eine Normierung vermieden, da die Faktoren rückblickend von Jedem anders bewertet werden können. So lassen sich Wünsche, Bedürfnisse und Probleme der Gesellschaft und die Resonanz der Literatur für diese Gesellschaft bewerten.
3. Gegenüberstellung der Hauptströmungen der Theorien zur Einteilung der literarischen Gattungen
Als Ergebnis der angestellten Beobachtung der unterschiedlichsten Modelle zur literarischen Gattungsbestimmung bleibt festzuhalten, dass die triadischen Modelle mit ihrer strengen Normierung unzulänglich für die moderne Literatur mit bewussten Grenzübertretungen sind. Mit Anpassungen wie einer Rest- und Sammelklasse wirken sie wie theoretisches Flickwerk, das der literarischen Realität hinterher hechelt. Eine größere Stabilität versprechen die moderneren Gattungskonzepte, die kommunikationsorientiert und struktur- und funktionsgeschichtlich ausgerichtet sind. Sie erlangen diese Stabilität dadurch, dass Literatur nicht als selbstständig existent angesehen wird, sondern im Verhältnis zu der zugehörigen Gesellschaft. Am vielversprechendsten ist meines Erachtens nach das Gattungssystem Hans Robert Jauß´. Auf unkomplizierte Weise kann damit die Literatur sämtlicher Zeitalter, Generationen und Kulturen in einen Kontext eingefügt und bewertet werden, auch zeitspezifische Sonderformen. Jauß´ Gattungstheorie ist zukunftsfähig, da sie von der Anlage her nicht nur historisch rückwirkend zutrifft.
Es bleibt das Resümee frei nach Albert Einstein: Entweder ist die Theorie einfach oder falsch.
4. Quellen- und Literaturverzeichnis
Es wurde keine Primärliteratur verwendet.
4.1.Sekundärliteratur
Bühler, K., Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Stuttgart/ New York 1982.
Goethe, J.W., Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des „West-Östlichen Divans“ (1819) in: Trunz, E. (Hg.), Goethes Werke, Bd.2, 6. Aufl. Hamburg 1962, S. 187.
Hamacher, B., Aspekte der Textgruppenbildung, in: Eicher/Wiemann (Hg.): Arbeitsbuch Literaturwissenschaft, S. 171-176.
Hegel, G.W.F., Vorlesungen über die Ästhetik III. In: ders., Werke in 20 Bänden, Bd. 15, Frankfurt/M. 1970, S.321 ff.
Horn, A., Theorie der literarischen Gattungen: ein Handbuch für Studierende der Literaturwissenschaft, Würzburg 1998, S. 13.
Körner, J., Generik oder Lehre von den Dichtungs- (Wortkunst- )Gattungen. In: Einführung in die Poetik. Frankfurt/M. 1949, S.39-51. Staiger, E., Lyrik und lyrisch. In: Grimm, R. (Hg.): Zur Lyrik-Diskussion, Darmstadt 1966, S. 75.
Voßkamp, W., Gattungen. In: Brackert, H., Stückrath, J. (Hg.): Literaturwissenschaft. Ein Grundkurs. Reinbek 1992, S. 253-269.
Wilfahrt, Gero v., s.v. Drama, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 2001.
Wilfahrt, Gero v., s.v. Epik, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 2001. Wilfahrt, G.v, s.v. Gattungen, in: Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 2001.
4.2.Sachbibliografie
Andreotti, M., Die Struktur der modernen Literatur. Neue Wege der Textanalyse. Bern, Stuttgart 1983
Beck, R., Terminologie der Literaturwissenschaft. Ein Handbuch für das Anglistikstudium, Ismaning 1998.
Berger, Willy R., Gattungstheorie und vergleichende Gattungsforschung. In: Schmeling, M. (Hg.): Vergleichende Literaturwissenschaft. Theorie und Praxis. Wiesbaden 1981, S. 99-124
Bickmann, C., Der Gattungsbegriff im Spannungsfeld zwischen historischer Betrachtung und Systementwurf: eine Untersuchung zur Gattungsforschung an ausgewählten Beispielen
literaturwissenschaftlicher Theoriebildung im 20. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1984.
Hansen-Löve, A. A., Der russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung. Wien 1978.
Hempfer, K., Gattungstheorie. Information und Synthese. München 1973.
Hernadi, P., Beyond Genre. New Directions in Literary Classification. Ithaca, London 1972.
Holenstein, E., Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus. Frankfurt/M. 1975.
Jauß, H.R., Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Frankfurt/M. 1991.
Jauß, H.R., Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt/M. 1992. Jauss, H.R. u.a. (Hg.): Theorie literarischer Texte. Göttingen 1973 Lenk, H. E. H., Deutsche Gesprächskultur: ein Lese- und Übungsbuch für das professionelle Konversationstraining, Helsinki, 1995.
Martini, F., Literarische Form und Geschichte: Aufsätze zu Gattungstheorie und Gattungsentwicklung vom Sturm und Drang bis zum Erzählen heute, Stuttgart 1984.
Müller-Dyes, K., Gattungen. In: Arntzen, H. u.a.: Wiessen im Überblick. Literatur. 2. Aufl. Freiburg 1976, S. 264-327
Müller-Dyes, K., Literarische Gattungen: Lyrik, Epik, Dramatik. Freiburg 1978
Raible, W., Was sind Gattungen? Eine Antwort aus semiotischer und textlinguistischer Sicht. In: Poetica 12 (1980), S. 320-349
Staiger, E., Grundbegriffe der Poetik. München 1971 Voßkamp, W., Gattungen als literarisch-soziale Institutionen. Zu Problemen sozial- und funktionsgeschichtlich orientierter Gattungstheorie und -historie. In: Hinck, W. (Hg.): Textsortenlehre - Gattungsgeschichte. Heidelberg 1977, S. 27-42
Voßkamp, W. (Hg.), Historische und aktuelle Konzepte der Literaturgeschichtsschreibung. Zwei Königskinder? Zum Verhältnis von Literatur und Literaturwissenschaft. Tübingen 1986.
Wagenknecht, C.(Hg.), Germanistisches Symposion. Zur Terminologie der Literaturwissenschaft. Akten des XI. Germanistischen Symposions der Deutschen Forschungsgemeinschaft Würzburg 1986, Stuttgart 1989.
Willems, G., Das Konzept der literarischen Gattung: Untersuchungen zur klassischen deutschen Gattungstheorie, insbesondere zur Ästhetik F. Th. Vischers, Tübingen 1981.
[...]
1 Wilfahrt, G.v, s.v. Gattungen, in: Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 2001
2 Hamacher, B., Aspekte der Textgruppenbildung, in: Eicher/Wiemann (Hg.): Arbeitsbuch Literaturwissenschaft, S. 172
3 Hegel, G.W.F., Vorlesungen über die Ästhetik III. In: Hegel, G.W.F., Werke in 20 Bänden, Bd. 15, Frankfurt/M. 1970, S.321 ff
4 Wilfart, Gero v., s.v. Epik, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 2001
5 Horn, A., Theorie der literarischen Gattungen: ein Handbuch für Studierende der Literaturwissenschaft, Würzburg 1998, S.
6 Wilfart, Gero v., s.v. Drama, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 2001
7 Goethe, J.W., Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des „West-Östlichen Divans“ (1819) in: Trunz, E. (Hg.), Goethes Werke, Bd.2, 6. Aufl. Hamburg 1962, S. 187
8 Körner, J., Generik oder Lehre von den Dichtungs- (Wortkunst-)Gattungen. In: Einführung in die Poetik. Frankfurt/M. 1949, S.39-51
9 Hegel, G.W.F., Vorlesungen über die Ästhetik III. In: Hegel, G.W.F., Werke in 20 Bänden, Bd. 15, Frankfurt/M. 1970, S.321 ff.
10 Hamacher, B., Aspekte der Textgruppenbildung, in: Eicher/Wiemann (Hg.): Arbeitsbuch Literaturwissenschaft, S. 174.
11 Horn, A., Theorie der literarischen Gattungen: ein Handbuch für Studierende der Literaturwissenschaft, Würzburg 1998, S. 13.
12 Bühler, K., Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Stuttgart/New York 1982
13 Staiger, E., Lyrik und lyrisch. In: Grimm, R. (Hg.): Zur Lyrik-Diskussion, Darmstadt 1966, S. 75
14 Voßkamp, W., Gattungen. In: Brackert, H., Stückrath, J. (Hg.): Literaturwissenschaft. Ein Grundkurs. Reinbek 1992, S. 256
15 ebd.
16 ebd.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine wissenschaftliche Hausarbeit zum Thema: „Wie lassen sich literarische Texte (Gattungen) voneinander abgrenzen und in ihren Funktions- und Organisationsprinzipien bestimmen?“. Es untersucht verschiedene Theorien zur Einteilung literarischer Gattungen.
Welche Ordnungskriterien werden zur Abgrenzung literarischer Texte erläutert?
Es werden formale (Druckbild, Versform, Umfang), mediale (Hörspiel, Internetliteratur) und inhaltliche Kriterien zur Gattungsbestimmung vorgestellt.
Welche Hauptrichtungen der Theorien zur Gattungseinteilung werden unterschieden?
Es werden zwei Hauptrichtungen unterschieden: normative, geschichtsphilosophisch oder anthropologisch begründete Ansätze und kommunikationsorientierte, struktur- und funktionsgeschichtlich ausgerichtete Gattungskonzepte.
Welche Trias-Modelle werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt Goethes "Naturformen der Poesie", Hegels Dialektik, Staigers anthropologisch begründete Trias und Bühlers Trias-Modell nach Sprachfunktion.
Was ist die Kritik an den normativen Trias-Modellen?
Die Kritik an den normativen Modellen ist ihre starke Normierung, Präskription und die Schwierigkeit, moderne Literatur mit bewussten Grenzübertretungen einzuordnen. Viele neuere oder spezielle Literatur-Formen passen nicht in das Schema und werden ausgegrenzt.
Welche kommunikationsorientierten Gattungskonzepte werden vorgestellt?
Es werden der russische Formalismus und die sozial- und funktionsgeschichtliche Gattungsbestimmung nach H.R. Jauß vorgestellt.
Was ist der rezeptionsgeschichtliche Ansatz von H.R. Jauß?
Jauß vertritt die Ansicht, dass literarische Gattungen durch einen zeitlichen Prozess fortgesetzter „Horizontstiftung und Horizontveränderung“ zu bestimmen sind. Er analysiert Erwartungshorizonte der Rezipienten und deren Einfluss auf Entstehung und Ausprägung literarischer Gattungen.
Welche Bedeutung hat die Selektionsstruktur nach Jauß?
Die Selektionsstruktur bezeichnet die Anhäufung von Text- und Lesererwartungen im sozialen und literarischen Kontext. Sie verdeutlicht die literatur- und zeitgeschichtlichen Verbindungen zwischen Gattungen.
Welche Vor- und Nachteile werden den verschiedenen Gattungstheorien zugeschrieben?
Die triadischen Modelle werden als unzulänglich für die moderne Literatur kritisiert, während die neueren, kommunikationsorientierten Konzepte mehr Stabilität versprechen, da sie Literatur im Verhältnis zur zugehörigen Gesellschaft betrachten.
Welche Literatur wurde im Rahmen der Arbeit verwendet?
Es wurde Sekundärliteratur von unter anderem Bühler, Goethe, Hamacher, Hegel, Horn, Körner, Staiger und Voßkamp verwendet, die im Literaturverzeichnis aufgeführt sind.
- Quote paper
- Michael Schmidt (Author), 2002, Funktions- und Organisationsprinzipien literarischer Gattungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107250