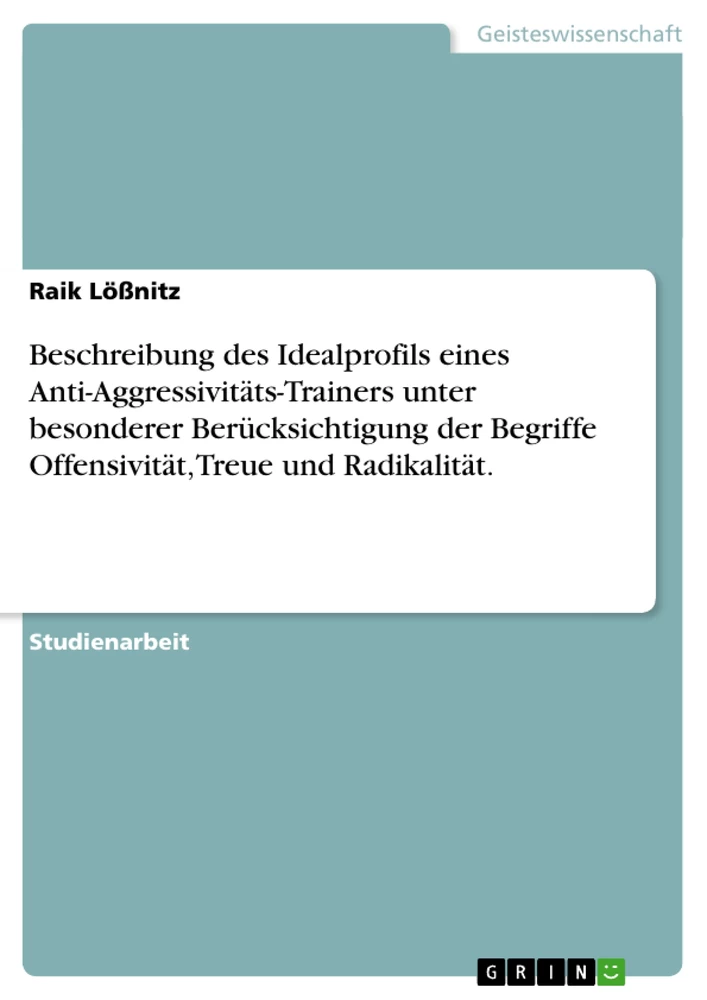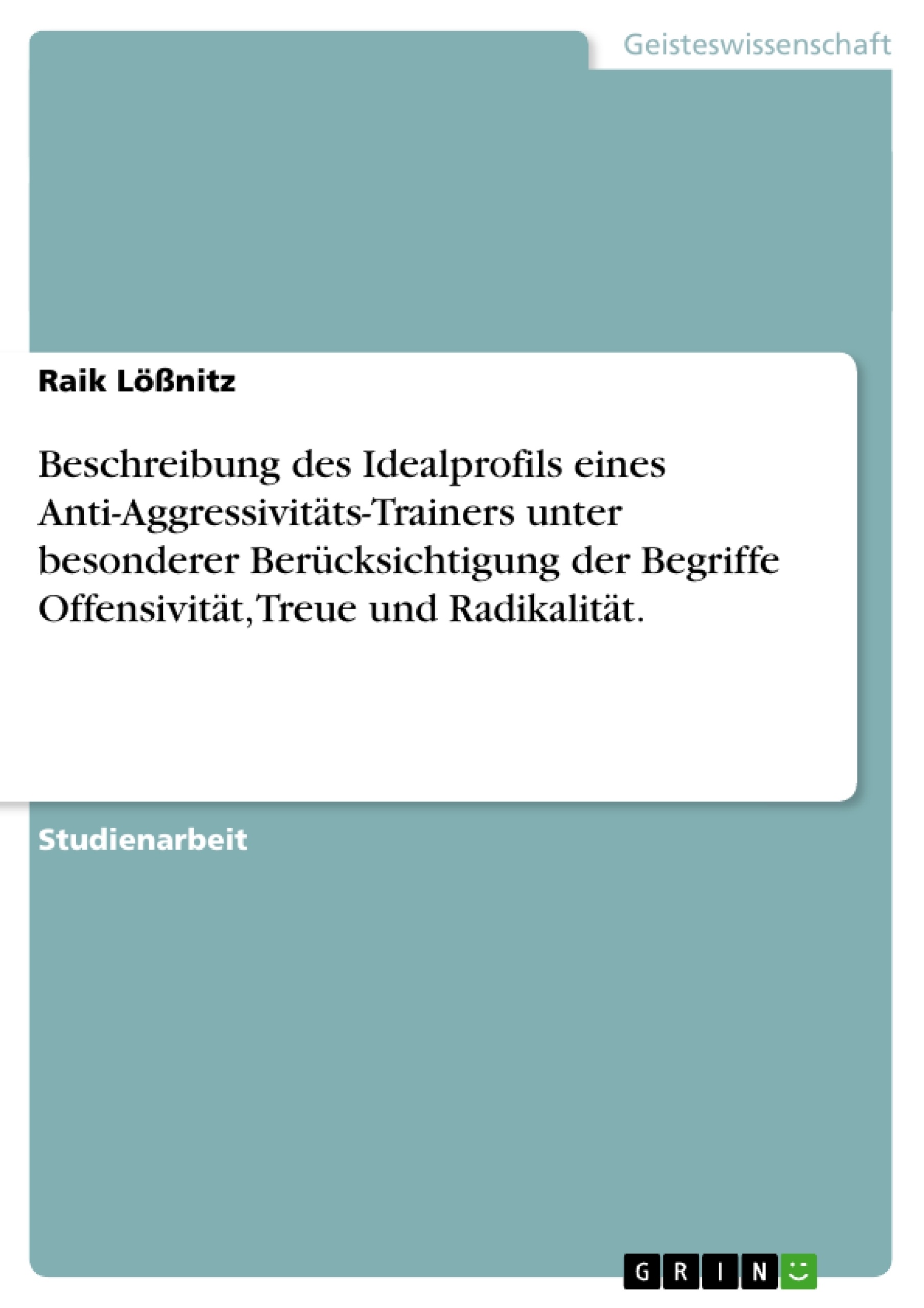Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Zum Umgang mit Tätern und Opfern
3. AAT-TrainerIn - „Advocatus diaboli“ und Opferlobby
3.1. Offensivität als Grundfähigkeit des AAT-TrainerInnenprofils
3.2. Treue als Grundlage für die Wirksamkeit der AAT-TrainerInnen
3.3. Radikalität als „Sprengsatz“ für Wachstum
1. Einleitung
Ein Aufschrei des Entsetzens durchfährt regelmäßig das deutsche Fernsehpublikum angesichts reißerisch aufgemachter und quotenträchtiger Berichte über Mord und Totschlag, Vergewaltigung und Opfer anderer schwerer körperlicher Mißhandlungen auf bundesdeutschen Straßen, in Wohnungen, öffentlichen Verkehrsmitteln, in Asylheimen, auf Spielplätzen, Schulhöfen, Klassenzimmern oder einschlägig bekannten Rotlichtvierteln. Seriöse Zeitschriften wie auch Boulevard-Gazetten schildern auflagesteigernd und detailgetreu den (vermeintlichen) Hergang von Gewalttaten und zoomen die auf das schlimmste zugerichteten Opfer auf die Titelseiten.
Gewaltmeldungen gehören inzwischen schon zum Alltag und werden den Bürgern als „wachsende Welle der Gewalt“ präsentiert. Ob nun die auf Kampf und Zerstörung abgerichteten Kampfhunde, die stellvertretend für die Gewaltbereitschaft, die Minderwertigkeitsgefühle, den Machthunger und die Potenzphantasien ihrer „haltlosen Halter“ zur unkontrollierbaren Gefahr für andere Mitmenschen werden oder das „Balkon- Monster“, welches sich des nachts über wehrlose Frauen hermachen. Ob gelangweilte Jugendliche, die aus Frust und Langeweile Steine von Autobahnbrücken werfen oder gar die jüngsten und tragischen Beispiele von Schülern, die wegen schlechter Noten und anderer Misserfolge ihre MitschülerInnen und LehrerInnen als Geiseln nehmen, verletzen oder töten, die Liste ließe sich problemlos ergänzen. So tragisch alle diese Vorfälle für die unmittelbaren Opfer und deren Angehörigen sind, so individuell das Leid im Einzelfall auch ist, gemeinsam verbindet sie die reißerische und „tränenreiche“ Berichterstattung, die sich fast mechanisch anschließenden Politikerstatements ( „ Unser erster Gedanke gilt jetzt den Opfern und ihren Hinterbliebenen “), die z.T. hitzigen Debatten in der (Fach-)Öffentlichkeit und das sich daran anschließende und geradezu gewollt anmutende „ Aussitzen “ und Ausblenden tatsächlicher Veränderungen.
Der Umgang mit und die Berichte über diese tragischen Vorfälle schüren die Angst unter der Bevölkerung und heizen immer wieder auch die Forderung nach Gesetzesänderungen und härteren Strafen an - einer Forderung, der gern auch von Politikern, mit Blick auf Wählerstimmen, in eiligen Statements Rechnung getragen wird. „ Politiker reagieren in der angeheizten Stimmung mit demonstrativ gezeigter Aktionsfähigkeit: Sie fordern Strafverschärfungen, obwohl alle Befunde deutlich machen, dass härtere Strafen keine Lösung des Problems sind. “ (Stiels-Glenn, M. 1997, S.239)
Bei der Gewaltdiskussion in der (medialen) Öffentlichkeit wird schnell ge -und verurteilt und wenig differenziert, vorallem, was den Begriff und die Ursachen von Gewalt betrifft. Da es weder dem Thema noch dem Umfang der hier vorliegenden Arbeit entspricht, möchte ich zu den Erklärungsansätzen und Ursachenkomplexen an dieser Stelle nicht näher eingehen. Gewalt als destruktive und gesellschaftlich nicht hinzunehmende Form der Aggressivität wird zunehmend brutaler, macht Angst, verunsichert und schränkt die Handlungs - und Bewegungsfreiheit vieler Menschen ein, daran besteht kein Zweifel. Politik, Sozialarbeit und Schule sind herausgefordert, auch im Hinblick auf die Tatsache, daß die Zahl von ( vorallem männlichen) Kindern bis 10 Jahren, die an schweren und gefährlichen Körperverletzungen beteiligt sind und eine deutliche Gewaltbereitschaft aufweisen, in den letzten Jahren angestiegen sind. (vgl. Therwey, M. / Pöhlker,R., 1997, S.112).
Inzwischen sind, insbesondere nach den ausländerfeindlichen Anschlägen zu Beginn der 90‘er Jahre, eine Vielzahl von neuen und neu verpackten (alten) Konzepten, Ansätzen und Modellen entwickelt und installiert worden - besonders im Rahmen der gewaltpräventiven Kinder und Jugendarbeit. Die einhellige Meinung: Prävention ist der Königsweg - da dürfen wir nicht Kleckern sondern müssen Klotzen. Jedoch wird auch die intensivste Präventionsarbeit im schul- und sozialpädagogischen Kontext nur unzureichend zur Lösung der Gewaltproblematik im Lande beitragen, wenn sich die Politik auf Finanzspritzen für derartige Projekte beschränkt und grundsätzliche politische und sozioökonomische Veränderungen blockiert. „Pädagogik, Sozialarbeit und Therapie können nicht die Gewaltproblematik lösen, wenn die politische, ökonomische und kulturelle Landschaft dem entgegenstehen.“ (Stiels-Glenn, M. 1997, S.241)
Und solange das so ist, werden wir sicher weiterhin mit den reißerischen Gewaltberichten überschwemmt, bekommen die Gewalttäter ihre Öffentlichkeit (für die Tat und nicht für die Reue und Wiedergutmachung) und werden die Opfer und ihr Leid ausgesaugt und ein weiteres mal mißbraucht.
Doch was geschieht, wenn die Taten und die Aufregung nichts mehr hergeben, wenn neue Sensations-und Katastrophenberichte das Interesse absorbieren? Was wird aus den Opfern und deren Leiden und was aus den Tätern, wenn diese hinter den Toren der Knäste verschwinden? Was geschieht, wenn Scheinwerfer und Blitzlichter abgeschaltet sind?
2. Zum Umgang mit Opfern und Tätern
Sofern die Gewalttat bekannt und/oder angezeigt wurde, richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Täter. In den schweren Fällen wird er weggesperrt. Im Rahmen der Strafvollzugspraxis richtet sich der Focus dann meist auf das Wohlverhalten und das „Nicht-negativ-Auffallen“ hinsichtlich der Anstaltsregeln und - erwartungen.
„ Die Veränderung menschenverachtender und feindseliger Grundhaltungen im Sinne des Bürgers (Opfer) ist so nicht zu erwarten. Und: Alle Täter werden nach Strafende wieder entlassen, unabhängig davon, ob der Strafvollzug „ gearbeitet “ oder gar „ gewirkt “ hat... “
(Heilemann,M./Fischwasser v. Proeck, G., 2000)
Indem sich der Focus einseitig auf den Täter richtet, wird das Opferleid und die Opferperspektive ausgeblendet. Das Opfer wird nicht nur mit den körperlichen und psychischen Folgen der Tat (Schmerz, Angst, Ohnmacht, Kontrollverlust, Einschränkung der Lebensqualität) allein gelassen, sondern es erlebt sich häufig selbst, durch die „ Schuldumkehr im Kopf “ (ebenda), als verantwortlich und schuldig für den Übergriff und letztlich die gesamte Situation. Vielmehr noch: Ist Anzeige erstattet worden und der Täter verurteilt und inhaftiert, so beginnt nicht selten für das Opfer die nächste Bedrohung. Da während der Haftzeit vielfach nicht wirklich und wirksam an der Veränderung der Täterpersönlichkeit und an seiner Grundeinstellung zu Gewalt und Männlichkeitsnormen gearbeitet wird, sich der Täter nicht mit den Folgen der von ihm verursachten Verletzungen und Zerstörungen auseinandersetzen muss und er sich ebensowenig um eine aktive Wiedergutmachung zu bemühen hat, lebt das Opfer in einer über Monate und Jahre stetig anwachsenden Angst vor Bedrohungen und Angriffen durch Freunde und Bekannte des Täters und besonders vor den Racheakten des Täters selbst.
Heruntergebrochen auf die Gewaltszenarien im Schul- und Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen, dem Täterverhalten und Opfererleben sowie auf den Umgang und der Arbeit mit Tätern und Opfern, werden Parallelen zur eben beschriebenen Situation sichtbar. Auch hier stehen zunächst die Täter im Mittelpunkt. Sanktionen, Schulverweise, Schulausschlüsse, jugendrichterliche Weisungen wie Arbeitsauflagen, die Teilnahme an sozialen Trainingskursen sowie Freizeit- oder Wochenendarreste, sind Reaktionen im Einzelfall.
Häufen sich gewaltsame Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen, wächst der präventive (und oft politische) Handlungsdruck in Stadtteilen und Kommunen. Arbeitsgruppen entstehen und im Rahmen der Vernetzung verschiedenster Institutionen, Träger und Vereine werden Konzepte und Modelle zur Gewalteindämmung und -prävention erarbeitet. Vielfach beweist die Praxis jedoch, dass ein großer Teil der Arbeitsenergie innerhalb der Arbeitskreise, in der institutionsübergreifenden Kontaktaufnahme und Kontaktpflege und im gegenseitigen Versichern der „Einsicht einer dringenden Notwendigkeit“ hängenbleibt. Zu oft erschöpft sich sozialarbeiterisches Engagement gegen Gewalt in Diskussionen und Erklärungen, in Handlungskonzepten statt in konzeptionellem Handeln. Zu oft scheitert effektive Anti- Gewalt-Arbeit und wirksamer Opferschutz schlichtweg an der Finanznot der Kommunen. Und so ließe sich noch zu oft die alte Posse über die sozialarbeiterische Profession: „Schön dass wir darüber gesprochen haben“ aufwärmen - ein Schlag ins Gesicht derer, die monate- und jahrelang an den Folgen von Gewalt leiden (und leiden werden).
Hoffnung machen uns die Beispiele, in denen Präventionkonzepte nicht nur entwickelt sondern tatsächlich auch umgesetzt werden. Jedoch beschränken sich viele Konzepte, gerade auch im Rahmen der sekundärpräventiven Arbeit, auf die Allgemeingültigkeit und -wirkung. Der Einzelfall, die Arbeit am einzelnen Täter und die Berücksichtigung der Opfer wird häufig schlichtweg übersehen.
Rainer Gall beschreibt das wie folgt an einem Beispiel: „ Das Konzept in Oberhausen unter dem Titel „ Jugend und Gewalt - verstehen, aber nicht einverstanden sein “ war praxistauglich. Es fehlten jedoch drei Aspekte, um zu einer vollständigen Sichtweise zu gelangen:
- Die Konfrontation der Täter mit den Folgen der Tat für das Opfer (einschließlich der Wiedergutmachung)
- Stärkung der Opfer (auch zukünftiger, potentieller)
- die Konfrontation und Stärkung der scheinbar Unbeteiligten (Zuschauer) “ (Gall, R., 1997, S.158)
Die fehlende radikale Konfrontation des Täters und das Ausbleiben individueller, wachstumsfördernder und erkenntniserweiternder Interventionen sowie das Ausblenden der Opferperspektive, sei es im Knast, in jugendgerichtlichen Erziehungs- und Sanktionsentscheidungen oder im Rahmen schul- und sozialpädagogischer Präventionsrogramme, verhindert meist eine tatsächliche Verhaltens- und Einstellungsveränderung, somit den Abbau von Gewaltbereitschaft und letztlich die Resozialisierung und Reintegration.
Soweit so gut, doch wer macht den Job?
Spätestens an dieser Stelle wird es Zeit auf die Frage aus der Einleitung dieser Arbeit zu antworten. Was geschieht also wenn die Scheinwerfer und Blitzlichter abgeschalten sind? Dann sind hoffentlich AAT-TrainerInnen zur Stelle und knipsen den „Spot“ an. Sie richten ihre Aufmerksamkeit auf beide - die Täter wie auch die Opfer.
3. AAT-TrainerIn - „Advocatus diaboli“ und Opferlobby
Sie haben einen klaren Auftrag (von tatsächlichen und potentiellen Opfern), eine daraus resultierende Verpflichtung („...Grenzen zu tangieren und zu überschreiten.“ (Heilemann,M., 2000), ein klares Ziel (Veränderung des Machtanspruches und anderer destruktiver Persönlichkeitsanteile des Täters) und ein besonderes Profil.
Sie sind Pazifisten und Provokateure, sind „penetrant“ in ihren Forderungen und unerschöpflich im Loben, sie reißen alte, graue und widerspenstige Mauern in den Köpfen der Täter ein und schaffen das Fundament für ein neues Ich, für Selbstliebe, Selbstwertgefühl und Selbstbewußtsein. Sie sind „Präventionsverfechter(innen)...“ (Heilemann, M. 1999) und „ ...friedliche Krieger für Nichtangriff und Nichtzerstörung, die aber immerüber ein riesiges Arsenal von Lösungsinstrumenten verfügen und an diesem Arsenal beständig und exzessiv feilen. “ (ebenda)
Sie arbeiten, auf der Grundlage eines optimistischen Menschenbildes, hart und massiv (in der Anfangsphase) und einfühlsam, solidarisch und wachstumsfördernd (in der Endphase) am Täter. Sie tun dies aber immer im Auftrag der/des Opfer/s. Dabei verfügen sie über fachliche Kompetenz, über Charisma und geistige Flexibilität. Sie zeichnen sich durch rhetorische Schlagfertigeit aus, verfügen über „Nehmerqualitäten“ im Sinne einer psychischen und körperlichen Belastbarkeit und erreichen über ihre „Performance“, ihre Ausstrahlungskraft, ihren Witz, ihren Optimismus und ihre Kreativität (beim Entwickeln immer neuer Methodenbausteine) die Aufmerksamkeit des (potentiellen) Täters sowie die nötige Attraktivität und die Anziehungskraft für die Teilnehmer ihrer Trainings. Sie legen, in Anlehnung an die Provokative Therapie (vgl. Farelly/Brandsma, 1974), dreist, fröhlich, provozierend und mit inszenierter Empörung, in der Rolle des „Advocatus Diaboli“, „ ...den Finger in die konflikt-und aggressionsgeladenen Wunden... “ der Täter. (Burschyk, L./ Sames, K./ Weidner, J., 1997, S.81)
3.1. Offensivität als Grundfähigkeit des AAT-TrainerInnenprofils
Offensiv meint zunächst angreifend oder angriffslustig. Wie passt das jedoch in ein Behandlungs- oder Therapiekonzept zur Arbeit mit Gewalttätern oder gewaltbereiten Kindern und Jugendlichen? Sind nicht gerade die Angriffslust und Angriffsbereitschaft die Kriterien, die es in der Arbeit mit (potentiellen) Gewalttätern zu senken oder gar zu beseitigen gilt? Setzen wir Angriffslust und -bereitschaft in den Kontext zu destruktiver Aggression, zur physischen und psychischen Gewaltausübung, zu Unterdrückung und Zerstörung, so mag das stimmen. Offensiv meint jedoch auch das „aus der Deckung kommen“, sich zu öffnen, ein Ziel selbstbewusst in Angriff zu nehmen, sich seiner Stärke bewußt zu sein und etwas zu wagen.
Vor diesem Hintergrund erhält der Begriff Offensivität eine wesentliche Bedeutung für die Arbeit am und mit dem Gewalttäter.
Gegenüber seinen (potentiellen) Opfern war es der Täter bisher gewohnt in der Offensive zu sein. In seinem Drang nach „ kurzfristiger persönlicher Wiedergutmachung “ (Heilemann, M., 2000) und Kompensation für zuvor erlebte Demütigungen, Kränkungen, Misserfolge und Zurückweisungen, geht er eine einseitige Beziehung zum Opfer ein. Sein Ziel ist die totale Unterwerfung des Opfers und dadurch die kurzfristige Aufwertung seines Selbstwertes und eine „ narzistische Zufuhr “ (Heilemann, M., 2000).
In den Trainings und im Kontakt mit den AAT-TrainerInnen erlebt der Täter eine veränderte Situation: Der Trainer geht offensiv (und nicht ängstlich - defensiv) eine Beziehung zum Täter ein, spricht ihn an, motiviert ihn zur Teilnahme, provoziert und lockt ihn. „ Der Anreiz zur Teilnahme liegt darin, daßnur die „ Harten “ und „ Coolen “ diese Sonderbehandlung durchstehen (provokatives Locken). “ (Prass, M., 1998)
Die TrainerInnen vertreten offensiv die Opferinteressen und eröffnen dem Täter, was dieser im Verlaufe des Trainings zu erwarten hat. Sie „verführen“ ihn gewissermaßen zum Verrat an seinen bisherigen (für die Gesellschaft destruktiven) geschlechts- und schichtspezifischen Normen, Werten und Idealen und somit an seiner Schicht und bieten ihm „neue“ Ziele und Werte an.
Offensiv und “hart am Mann segelnd“ (Heilemann, M., 2000), setzt er wechselnd „erkenntnisorientierte und handlungsorientierte Interventionselemente“ (ebenda) ein, greift er vehement und konfrontativ die destruktiven und blockierenden Persönlichkeitsanteile an, um unmittelbar danach (Rein-Raus-Methode) lobend, motivierend und „gierig“ den „ Genie- Punkt “ (ebenda), also seine ganz besondere konstruktive Fähigkeit, Begabung, sein spezielles Talente und seinen Entwicklungsfortschritt und Erkenntniszuwachs zu berühren und zu benennen. Über konsequentes und offensives Loben (nicht nur für die „grandiosen“ Fortschritte sondern auch für die mühsamen Anstrengungen) tritt der/die AAT-TrainerIn als UnterstützerIn und „Wachstumscoach“ auf. Das Ziel: Der (ehemalige) Täter entdeckt bei sich selbst neue Kompetenzen auf die er stolz sein kann. Er erfährt Bewunderung, erlangt Selbstsicherheit und Selbstvertrauen und wird motiviert zu weiteren Anstrengungen. Er erlebt seine Wirksamkeit (Wirksamkeit des Ich ’ s), entdeckt neue Begabungsreserven, genießt Lob, Zuwendung und Nähe und ist stolz auf seine eigenen Leistungen. Der Täter verändert seine Einstellung zu sich selbst, wird zunehmend vom „gecoachten“ Trainingsteilnehmer, vom „ Therapiekonsumenten “ (ebenda) zum „ Selbstcoach “ (ebenda) und kann letztlich gelassener, wohlwollender, lobend und souveräner auf seine Mitmenschen reagieren.
„ Hierbei ist insbesondere die Offensivität, die Dreistigkeit, die Einfühlsamkeit und die Flexibilität zwischen harter und weicher Ansprache im Trainerteam gefragt. Die Bereitschaft, sich körperlich einzubringen (Näheübungen, Provokationübungen) ist Grundlage des Trainerprofils. Insbesondere handlungsorientierte Interventionen, die direkt das Verhalten des Täters in dem aktuellen Moment verändern undübenden Charakter haben, gehören zum Interventionsauftrag “ (ebenda).
Offensiv beziehen die TrainerInnen andere Veränderungsagenten zu den verschiedenen Handlungs- und Methodenbausteinen in den Trainingsverlauf ein (friedvolle Karatemeister, prominente Leistungssportler, Modells, Türsteher), um einerseits die neuen Werte für den Trainingsteilnehmer deutlich und attraktiv zu machen, andererseits aber auch, um ihm eine möglichst realitätsnahe Überprüfung seines tatsächlichen Kompetenzzuwachses zu ermöglichen.
Letztlich arbeiten die AAT-TrainerInnen selbst offensiv, kreativ und in Zusammenarbeit mit anderen TrainerInnen an der Entwicklung neuer wirksamer Konzepte und Methodenbausteine für die Arbeit mit den verschiedensten Zielgruppen, setzen sich offensiv für die Implementierung des AAT-Trainings in den verschiedensten Handlungsfeldern (Schule, Jugendarbeit, Jugendhilfe, Jugendgerichtshilfe, Strafvollzug, Multiplikatorenarbeit etc.) ein und arbeiten beständig an der Verbesserung ihrer persönlichen, ihrer kognitiven und körperliche Kompetenz und somit an ihrer Wirksamkeit.
3.2. Treue als Grundlage für die Wirksamkeit der AAT-TrainerInnen
Zunächst erst einmal legt der (männliche) Täter vor:
Für ihn bedeutet Treue zu schicht-und geschlechtsspezifischen Verhaltens- und Handlungsmustern, Zugehörigkeit, Sicherheit und Identitätsstütze. Bereits frühzeitig wird er auf schicht- und geschlechtsspezifische Werte und Ideale festgelegt. Entsprechend seiner Herkunftsschicht können diese differieren. Aufgrund des Umfanges dieser Arbeit kann ich an dieser Stelle nicht näher auf diese Unterschiede, insbesondere bezüglich der eher innerhalb der unteren Schicht und der mittleren Schicht primärsozialisierten Gewalttäter eingehen. Beiden Gruppen gemein jedoch ist, daß das Ausüben von Gewalt (in unterschiedlicher Form und mit unterschiedlichen Mitteln) für sie eine kompensatorische Funktion hat, u.a. auch deshalb, da sie im Kontakt und in der Auseinandersetzung mit Angehörigen der jeweils anderen Schicht eine Dissonanz und Infragestellung ihrer bisher verinnerlichten Werte und Ideale erleben. „ Hauptsächlich ist also die Treue zu den früh erlernten Schichtmustern erklärungsrelevant bezüglich der Wahl der Gewaltform. “ (Heilemann, M., 2000)
Für einen großen Teil der Täter aus der eher unteren Schicht ist von besonderer Bedeutung, an den vermittelten Männlichkeitidealen wie Stärke, Durchsetzungsfähigkeit, Ehrverteidigung (und somit eine niedriger Kränkungsschwelle), Überlegenheit, physische Aggression, etc. festzuhalten.
Gewaltlosigkeit, Weichheit, Nähebedürfnis, Einfühlungsvermögen, gar offene Angst und Rückzug, werden von ihnen als „weibisch“, „schwach“, „feige“ oder „schwul“ bezeichnet und empfunden. Da sie sich in ihrem sozialen Umfeld (z.B. peer-group) ständig der Bewertung anderer Jugendlicher (auch weiblicher) aus der gleichen Schicht ausgesetzt sehen, befürchten sie bei „unmännlichem“ Verhalten den Gesichtsverlust, die Abwertung und Ablehnung. Dem zufolge sind sie selbst auch treue Verfechter der vorgelebten und übernommen Werte und sind bemüht, diese möglichst auch deutlich nach außen sichtbar werden zu lassen (gewalttätige Handlungen / Symbole). Dies symbolisiert einerseits „ ...das Bedürfnis nach mehr brutaler Männlichkeit anstatt liebevoller Väterlichkeit, Mitmenschlichkeit oder Freundschaft “ (Struck, P.,1999), andererseits verdeutlicht es die Angst vor dem Verlust der Identität und Zugehörigkeit und das Ausmaß der Notwendigkeit, genau diesen Idealen bis auf das Letzte treu zu sein. Jede Kritik und jeden Angriff auf diese Ideale versucht der schichtkonforme Täter, notfalls brutal (also „männlich“) und möglichst „final“ (erst zuschlagen, dann evtl. reden) abzuwehren. Anderes Rollenverhalten, eine andere Grundhaltung empfindet er als Verrat (an seiner Schicht, an seinen männlichen Vorbildern, an seiner peer - group). „ Diese subjektiv wahrgenommene Treuepflicht und diese „ Haltekräfte “ (Heilemann, M..,2000) führen letztlich zu „Angst vor Veränderung“ aus „Angst vor Verrat“. Dieser (scheinbar) manifesten Treue, dieser Angst und Abwehr müssen die AAT- TrainerInnen ihrerseits mit der Treue zu ihren Ideale und Überzeugungen begegnen, denn dies ist die Grundlage für ihre Wirksamkeit. Die wirksamen AAT-TrainerInnen sind innere Pazifisten und fühlen sich den humanistischen Idealen verpflichtet. Sie sind überzeugt von der „ universellen Gleichheit “ (ebenda) und dem Recht jedes einzelnen Menschen auf ein Leben ohne Einschränkung, Demütigung, Kränkung und Zerstörung. Ihr Handeln ist geprägt von der Treue zu ihren Idealen und Überzeugungen, zur Treue zu ihren „Auftraggebern“ (den tatsächlichen oder potentiellen Opfern) und von dem Ziel, dass ihnen der (potentielle) Körperverletzer, Unterdrücker und Zerstörer auf ihrem friedlichen Weg folgt.
Von dieser Grundidee geprägt sind sie selbst bereit und in der Lage zu folgen, zu dienen und das weiterzureichen was sie selbst an Fähigkeiten, Überzeugungen, an Mitgefühl, Demut, Dankbarkeit und Offenheit in sich tragen.
Ihre Wirksamkeit resultiert aus der uneingeschränkten Überzeugung, dass jeder Mensch (auch und besonders der Täter) über ein Wachstumspotential verfügt. Es ist ihr Ziel, die Wachstumsblockade (die Angst vor Veränderung und Verrat) des Täters aufzulösen, sein Wachstum zu fördern und ihn auf seinem neuen, friedvolleren Weg zu unterstützen. Aus dieser Überzeugung und Treue erwächst ihre Kraft und Wirksamkeit zu überzeugen, resultiert ihre Berechtigung Aufmerksamkeit, Lob und Unterstützung einzufordern (zur „Refinanzierung“ der eigenen Energie) und letztlich auch ihre Legitimation Autoritäten nicht zu fürchten.
3.3. Radikalität als „Sprengsatz“ für Wachstum
„Der/die Anti-Aggressivitäts-TrainerIn muß radikaler sein als der Schläger“, ist einer der zentralen Leitgedanken und ein Handlungsauftrag für jede/n TrainerIn. Radikalität meint in diesem Zusammenhang zum einen die Gründlichkeit und Kompromisslosigkeit bezüglich der Offensivität, der Treue, der Opferorientiertheit, der uneingeschränkten Wachstumsförderung des Täters und der Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit. Radikal treten die TrainerInnen insbesondere auch im Rahmen der Konfrontation, die in der Anfangsphase des Trainings eine zentrale Bedeutung hat, auf. Sie setzen der Täterbrutalität ihre Trainer-Radikalität entgegen (vgl. Heilemann,M., 2000).
Besonders im Training mit Wiederholungstätern haben es die TrainerInnen mit Profis zu tun. Die Täter sind Profis im Provozieren und Inszenieren, im Zweikampf, im Bagatellisieren und Legitimieren und im Umgang mit Strafverfolgungsbehörden (vgl. Heilemann,M., 1998). Sie schützen sich gekonnt und mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten vor der Realität ihrer Tat und deren Folgen. Ihr Interesse ist eine möglichst große Distanz zwischen sich und den Trainern, dem tatsächlichen Opferleid und einer emotionalen Betroffenheit über ihr feiges, brutales und menschenverachtendes Handeln. Der „heiße Stuhl“ ist das Schlüsselloch durch das der Täter muß (vgl. Heilemann, 2000). Hier wird der Täter radikal von den TrainerInnen mit der Tat und den Opferleiden konfrontiert. Ziel ist es, die Schutzfassade aus Legitimationsargumenten und Neutralisierungsstrategien zu verdeutlichen und aufzuweichen.
Der Täter soll Betroffenheit, Ekel und Abscheu vor der eigenen Tat empfinden. Er soll erkennen, dass er eine einseitige Täter- Opfer- Beziehung eingegangen ist, um sich kurzfristig aufzuwerten, seinen Machtanspruch zu befriedigen und sich, stellvertretend für frühere Demütigungen, Zurückweisungen, Liebesentzug etc., zu rächen. Er muss die (lebenslange) Verantwortung für seine Tat/Taten übernehmen und direkt oder stellvertretend eine aktive, individuelle und überprüfbare Wiedergutmachung leisten.
Um zum emotionalen Kern der Täterpersönlichkeit vorzudringen, dürfen und müssen die TrainerInnen, mit Rückbezug auf die Opfer, die (scheinbaren) Grenzen der Täter berühren oder überschreiten, müssen deren Aufmerksamkeit radikal einfordern und gewinnen und dürfen in keinem Moment unterlegen sein.
„ Das Trainerteam mußdie Lufthoheit, sowohl in der Quantität (Anzahl der Personen) in der Radikalität (mentale Stärke) und hinsichtlich der kognitiven Differenziertheit (Schlagkräftigkeit der Argumente)übernehmen. Sie müssen im Auftrag der Opfer eines sicherstellen: Der Täter mußspüren, „ dass er hier mit seiner alten Identität nicht gewinnen kann “. (ebenda)
Erst auf dieser Grundlage ist das Idealziel des Trainings, nämlich die Abkehr des Täters von Gewalt, sein nachfolgendes Wachstum im Sinne einer umfassenden Kompetenzerweiterung, sein gewaltloses Verhalten auch in Bedrohungs- und Kränkungssituationen und letztlich sein möglicherweise aktives Engagement für Gewaltlosigkeit und Frieden (in Schule, Gemeinde etc.) zu organisieren und zu realisieren.
Raik Lößnitz
Literatur:
Burschyk,L./Sames,K.-H./WeidnerJ. in: ‚Gewalt im Griff‘, Weidner,Kilb,Kreft (Hrsg.),Weinheim/Basel, 1997 Farrelly,,F./Brandsma,J.M.: Provokative Therapie, Berlin/Heidelberg, 1986
Gall, R. in: Gewalt im Griff, Weidner,J./ Kilb,R./ Kreft,D. (Hrsg.), Weinheim/Basel,1997
Heilemann,M./Fischwasser v. Proeck,G.: Konzept 2000, Anti-Aggressivitäts-Training, „Hamelner Modell“, 2000
Heilemann,M.: unveröffentliches Manuskript im Rahmen der 3. AAT-Seminareinheit am ISS Frankfurt/Main, 4/2000
Heilemann,M.: „Innerer Pazifist“ als Leitidee, unveröffentlichtes Manuskript, November 1999 Heilemann,M.: Kampagne gegen Gewalt, in: ZfStrVO 4/98
Prass,M.: ‚Coolness-Training‘- Anti-Aggressivitäts-Training „Fitness-Training, um cooler zu werden“,
Stiels-Glenn, M. in : Weidner,J ./ Kilb,R. / Kreft,D. (Hrsg.), Gewalt im Griff, Weinheim /Basel, 1997
Struck, Peter: „Ein Junge, der sanft ist, hat es heute schwer“, Artikel in: Flensburger Tageblatt, 30.07.1999
Häufig gestellte Fragen zum Text
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Er behandelt den Umgang mit Tätern und Opfern von Gewalt, die Rolle von AAT-TrainerInnen (Anti-Aggressivitäts-TrainerInnen) und deren Profil, inklusive Offensivität, Treue und Radikalität als Schlüsselelemente.
Welche Rolle spielen AAT-TrainerInnen im Kontext des Textes?
AAT-TrainerInnen werden als "Advocatus diaboli" und Opferlobby beschrieben. Sie haben den Auftrag, das Ziel und das Profil, das auf einer klaren Verpflichtung basiert. Sie arbeiten mit Tätern, um deren Machtanspruch und destruktive Persönlichkeitsanteile zu verändern. Sie sind sowohl Pazifisten als auch Provokateure, fördern Selbstliebe, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein.
Was bedeutet "Offensivität" im Kontext des AAT-TrainerInnenprofils?
Offensivität bedeutet hier nicht nur angriffslustig zu sein, sondern auch aus der Deckung zu kommen, sich zu öffnen, selbstbewusst Ziele zu verfolgen und etwas zu wagen. AAT-TrainerInnen gehen offensiv auf die Täter zu, vertreten die Opferinteressen und bieten den Tätern neue Ziele und Werte an.
Warum ist "Treue" eine Grundlage für die Wirksamkeit von AAT-TrainerInnen?
Treue bezieht sich hier auf die Treue der TrainerInnen zu ihren Idealen und Überzeugungen, insbesondere den humanistischen Idealen und dem Recht jedes Menschen auf ein Leben ohne Gewalt. Diese Treue ermöglicht es ihnen, die Wachstumsblockaden der Täter aufzulösen und sie auf einem friedlicheren Weg zu unterstützen.
Was bedeutet "Radikalität" im Kontext des Textes?
Radikalität bedeutet Gründlichkeit und Kompromisslosigkeit in Bezug auf Offensivität, Treue, Opferorientiertheit, Wachstumsförderung und Transparenz. Insbesondere in der Konfrontationsphase des Trainings mit Wiederholungstätern setzen die TrainerInnen ihre Radikalität ein, um die Schutzfassade der Täter aufzuweichen und sie mit den Folgen ihrer Taten zu konfrontieren.
Welche Kritik wird an der medialen Berichterstattung über Gewalt geübt?
Der Text kritisiert die reißerische und "tränenreiche" Berichterstattung über Gewalt, die Angst in der Bevölkerung schürt und zu übereilten politischen Reaktionen führt, ohne die eigentlichen Ursachen der Gewalt zu bekämpfen. Es wird bemängelt, dass die Opfer und Täter nach dem Abflauen des öffentlichen Interesses oft allein gelassen werden.
Welche Alternativen zum üblichen Umgang mit Tätern und Opfern werden vorgeschlagen?
Der Text plädiert für eine stärkere Berücksichtigung der Opferperspektive und die Notwendigkeit, die Täter mit den Folgen ihrer Taten zu konfrontieren. Es wird die Rolle von AAT-TrainerInnen hervorgehoben, die sowohl mit Tätern als auch mit Opfern arbeiten und auf eine Verhaltens- und Einstellungsveränderung der Täter abzielen.
Was sind die Kernaussagen zur Prävention?
Obwohl Prävention als der Königsweg angesehen wird, wird betont, dass auch die intensivste Präventionsarbeit im schul- und sozialpädagogischen Kontext nicht ausreicht, solange die Politik grundsätzliche politische und sozioökonomische Veränderungen blockiert.
- Quote paper
- Raik Lößnitz (Author), 2002, Beschreibung des Idealprofils eines Anti-Aggressivitäts-Trainers unter besonderer Berücksichtigung der Begriffe Offensivität, Treue und Radikalität., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107228