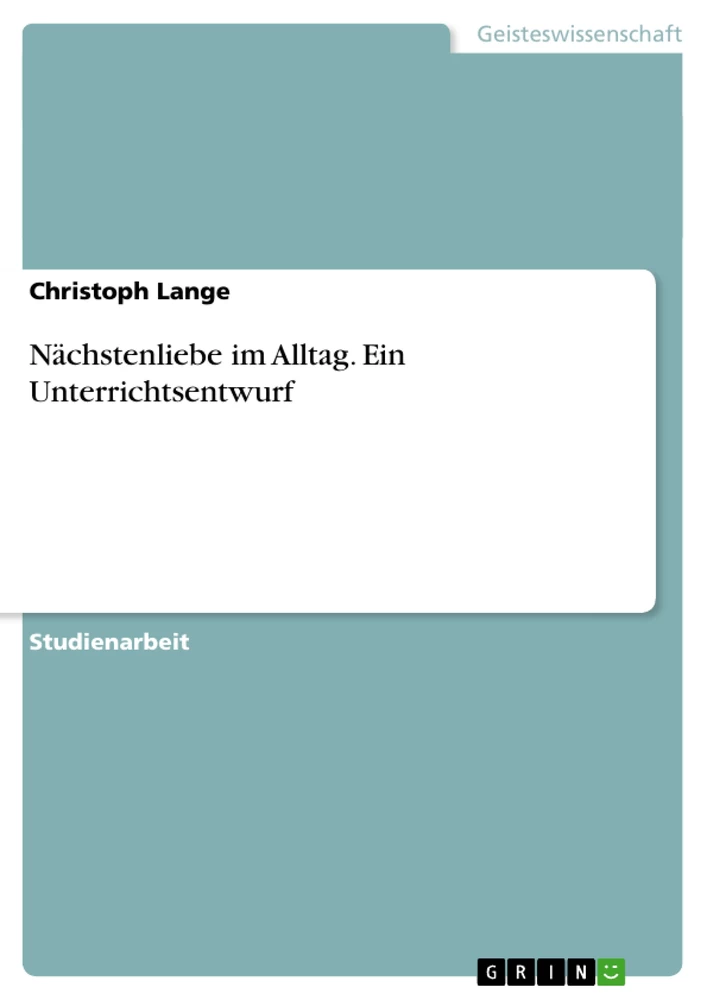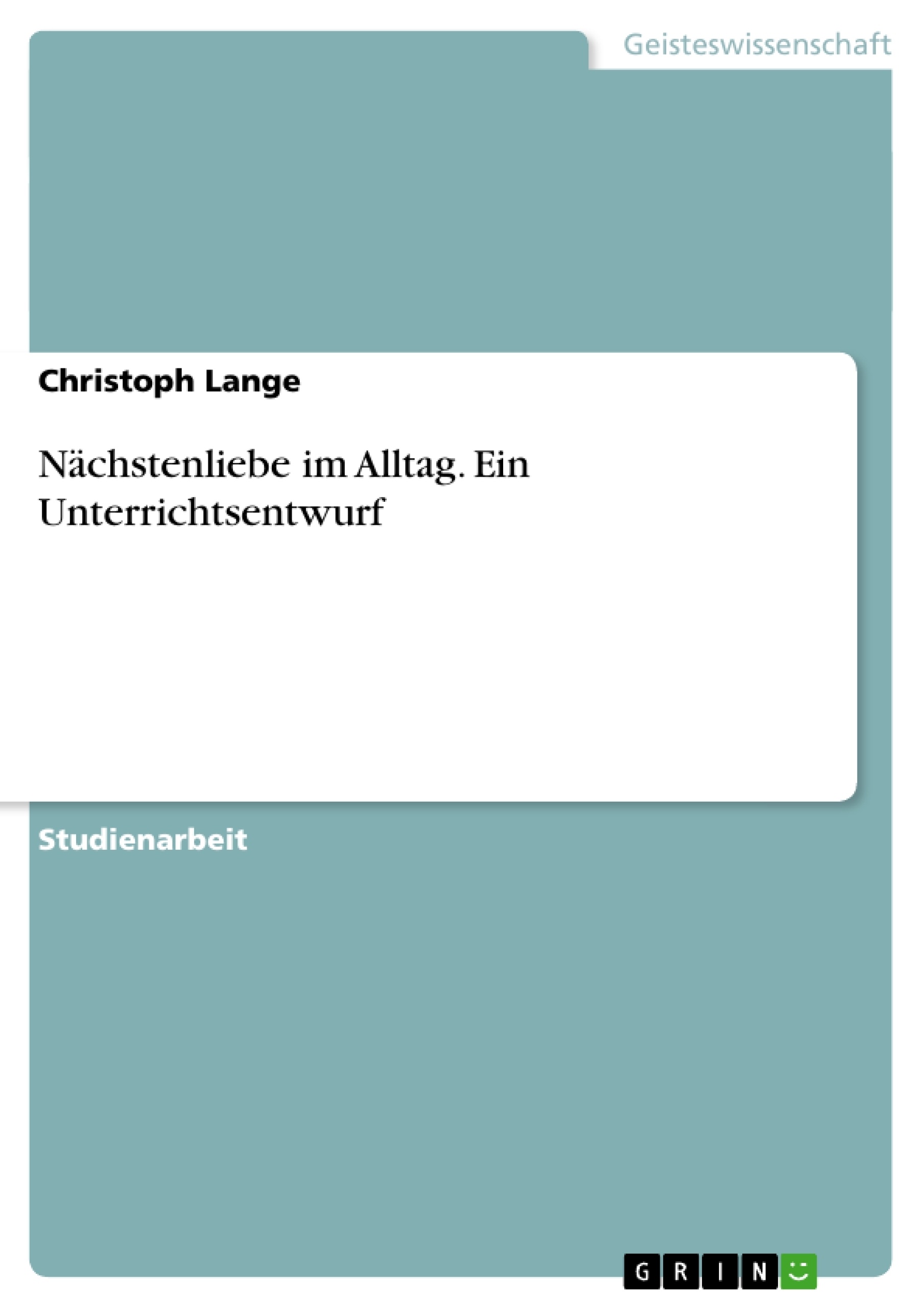Was bedeutet es wirklich, Nächstenliebe im oft so fordernden Alltag zu leben? Diese Frage steht im Zentrum einer tiefgründigen Auseinandersetzung, die uns dazu anregt, über christliche Werte und deren Relevanz in der modernen Gesellschaft nachzudenken. Anhand einer detaillierten Analyse des didaktischen Bedingungsfeldes, fachwissenschaftlicher Erkenntnisse und fachdidaktischer Überlegungen wird ein umfassender Einblick in die Thematik der Nächstenliebe gewährt. Der Leser wird auf eine Reise mitgenommen, die von der theoretischen Fundierung bis zur praktischen Anwendung im Schulunterricht reicht. Dabei werden Stundenentwürfe präsentiert, die als konkrete Beispiele dienen, wie das abstrakte Konzept der Nächstenliebe im Klassenzimmer vermittelt und für Schülerinnen und Schüler greifbar gemacht werden kann. Es geht darum, die oft zitierte Floskel mit neuem Leben zu füllen und zu zeigen, dass Nächstenliebe nicht nur eine Aufgabe für Einzelne oder bestimmte Berufsgruppen ist, sondern eine Aufforderung an jeden von uns. Die Arbeit beleuchtet, wie christliche Ethik und Dogmatik die Basis für ein Leben in Zuwendung und Verantwortung bilden können, und wie diese Werte in einer von Wettbewerb geprägten Welt ihren Platz finden können. Es wird untersucht, inwiefern die Schülerinnen und Schüler bereits Erfahrungen mit Nächstenliebe gemacht haben und wie diese Erfahrungen im Unterricht aufgegriffen und erweitert werden können. Ziel ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Nächstenliebe mehr ist als nur das Vermeiden von Konflikten; sie ist vielmehr ein aktives Engagement für das Wohl anderer, das sich in Worten, Gedanken und Taten manifestieren kann. Eine Einladung, über die eigene Rolle in der Gesellschaft nachzudenken und die Kraft der Nächstenliebe im eigenen Leben zu entdecken. Diese Arbeit ist somit nicht nur eine Analyse, sondern auch eine Inspiration, die dazu ermutigt, christliche Werte im Alltag zu leben und einen Beitrag zu einer mitfühlenderen Welt zu leisten.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Analyse des didaktischen Bedingungsfeldes
2 Fachwissenschaftliche Analyse
3 Fachdidaktische Analyse
4 Methodische Überlegungen
4.1 Erste Unterrichtsstunde
4.2 Zweite Unterrichtsstunde
5 Stundenentwürfe
5.1 Entwurf für die erste Unterrichtsstunde
5.2 Entwurf für die zweite Unterrichtsstunde
Vorwort
Die Gliederung der einzelnen Punkte innerhalb dieser Arbeit richtet sich nach dem Vorschlag von Adam und Lachmann[1].
Bei der Darstellung der beiden Unterrichtsstunden gehe ich von der geplanten Fassung aus. Da die Probleme, die sich während der ersten Stunde ergaben, wichtig sind für das Verständnis der Gestaltung der zweiten Einheit, werde ich in einem eigenen Absatz kurz darauf eingehen.
1 Analyse des didaktischen Bedingungsfeldes
Die Schule, an der das Praktikum im WS 97/98 gehalten wurde, war das Marie–Therese–Gymnasium, das einzige städtische Gymnasium in Erlangen.
Die Schüler setzten sich überwiegend aus Kindern mittelständisch geprägter Elternhäuser der Stadt und des süd–östlichen angrenzenden Landkreises zusammen, wobei die Schule einen Teil ihres Einzuggebietes in den letzten Jahren durch die Gründung eines Gymnasiums in Spardorf verloren hat.
Die Praktikumsklasse, die zunächst aus fünf Jungen und neun Mädchen bestand, war eine siebte Klasse. Im Verlauf des Dezembers stieß ein weiterer Schüler hinzu, der sich wegen schulischer Probleme hatte zurückversetzen lassen. Nach den Zwischenzeugnissen Ende Februar kam noch eine weitere Schülerin in die Klasse, so daß sich die Gruppe für den Religionsunterricht schließlich auf 16 Schüler erweiterte.
Da alle Schüler zu derselben Klasse gehörten, kannten sie sich bereits aus den übrigen Unterrichtsfächern. Für den Religionsunterricht stellten die Schüler jedesmal eine eigene Sitzordnung her. Direkt vor dem Lehrerpult steht zunächst eine lange Reihe, an deren rechter Hälfte (vom Pult aus gesehen) die gesamten Jungen der Klasse saßen. Dahinter befanden sich jeweils links und rechts zwei weitere kurze Bankreihen, an denen nochmals kleinere Mädchengruppen saßen. Bedingt durch diese breite Frontstellung“ ergaben sich gewisse Proble- ” me, die Schallmauer“ , die sich durch die vorderste Gruppe manchmal ergab, ” zu durchdringen und auch die hinteren Reihen zu erreichen.
Die Atmosphäre innerhalb der Klasse kann als sehr gut und äußerst angenehm bezeichnet werden. Kleinere Unruhen, die sich unter anderem durch die Veränderungen in der Sitzordnung nach dem Hinzukommen des neuen Schülers ergaben, ließen sich ohne größere Probleme in den Griff bekommen. Aus diesem Grund wurden Überlegungen in der Praktikumsgruppe, die Sitzordnung zu verändern, letztendlich nicht in die Tat umgesetzt. Die große Bereitwilligkeit der Schüler zur Mitarbeit erleichterte den Unterricht als Praktikant — sowohl die lebhafteren als auch die eher ruhigen Schüler ließen sich ohne allzu große Anstrengung in die Unterrichtsarbeit integrieren. Interessanterweise war die Existenz von ungetauften Schülern aus dem Unterrichtsverlauf heraus nicht erkennbar, da diese nicht durch augenscheinliches Desinteresse o. ä. auffielen. Die teilweise doch sehr unterschiedliche religiöse Sozialisation der einzelnen Schüler hingegen war in den Unterrichtsbeiträgen wiederzufinden, wobei aber allen Schülern ein insgesamt reges Interesse bescheinigt werden kann.
Wechselnde Unterrichtsformen stellten für sie kein Problem dar; erstaunlich war das mehrheitlich große Interesse an Bibelarbeit und selbst das Singen von Liedern fand nach eine gewissen Anlaufsphase großen Anklang.
In der Entwicklung der einzelnen Schüler waren, wie für diese Jahrgangsstufe nicht anders zu erwarten, durchaus Unterschiede erkennbar. Während ein Teil, besonders die Mädchen, bereits deutlich pubertierte, war der andere Teil noch deutlich kindhafter in seinem Verhalten und Erscheinen. Der mit der Pubertät beginnende Ablösungsprozeß vom Elternhaus, stand, wenn er überhaupt schon begonnen hatte, noch in den Anfängen. Kritische Anfragen an Stoff und Inhalt des Religionsunterrichts gehen vermutlich noch auf den Hintergrund des jeweiligen Elternhauses zurück.[2]
Die zwei Unterrichtsstunden wurden Anfang Februar 1998 an zwei direkt aufeinander folgenden Tagen gehalten.[3] Übergeordnetes Thema der Praktikumsstunden war der Themenbereich 6 Nächstenliebe“ des gymnasialen Lehrplans, ” der Verständnis dafür wecken soll, was es heißt, als Christ mit menschlicher Not umzugehen.[4] In den zwei hier vorzustellenden Unterrichtsstunden ging es speziell um Nächstenliebe im Alltag.
2 Fachwissenschaftliche Analyse
Nächstenliebe ist, aus christlicher Sicht, die Umsetzung der Liebe Gottes zu den Menschen unter den Menschen. Durch den Tod Christi für uns am Kreuz sind wir befreit, uns unter dem Einsatz all unserer Kräfte um eine Besserung des Verhältnisses der Menschen untereinander und eine Besserung der Umstände unter denen wir Leben zu bemühen.[5] Durch uns wirkt Gottes Liebe auf dieser Welt und an uns liegt es, so dem Reich Gottes den Weg zu bahnen.[6] Allerdings können weder christliche Dogmatik noch christliche Ethik die Umsetzung der Nächstenliebe wirklich inhaltlich entfalten, da es nicht um einzelne Werke geht, sondern um die ganze Zuwendung des Menschen zu seinen Mitmenschen. Die Nächstenliebe läßt sich nicht auf Taten begrenzen, sondern kann auch in Worten, in Gedanken, u. U. einmal nur in einem Zuhören konkret werden.“[7] ”
Die Weitergabe der Liebe, die wir von Gott erfahren haben, ist in ihrer Konkretisierung durch die Situationen bedingt, in denen Menschen einander begegnen und aufeinander angewiesen sind.“[8] Nächstenliebe heißt also, uneigennützig für den anderen da zu sein, es ist das Modell für christliches Leben überhaupt.[9] Wenn nun die Liebesforderung nicht mit unserer Realität vereinbar zu sein scheint, ist entweder die Forderung oder aber die Realität verkehrt. Nach Jesu Meinung ist die Realität änderungsbedürftig[10]; doch betrachtet man sich jedoch unsere heutige Gesellschaft, so scheint es als ob vielfach eher die Meinung vertreten wird, daß diese Forderung nicht mehr zeitgemäß ist.
3 Fachdidaktische Analyse
Für die Schüler ist dieses Modell eines christlichen Lebens mehr Fiktion als erfahrbare Realität. Sie erleben heute eine durch Wettbewerb in allen Bereichen bestimmte Gesellschaft, in der gewaltsame Auseinandersetzungen, wenn man die Presse oder das Fernsehen betrachtet, an der Tagesordnung stehen. Beispiele für gelebte Nächstenliebe erfahren sie in ihrem Alltag dagegen eher weniger. Als Beispiele dafür dienen zwar Personen wie Mutter Theresa und andere berühmte Personen der Vergangenheit und Gegenwart, doch berühren diese in keiner Weise die Lebenswirklichkeit der Schüler. Nächstenliebe ist in unserer Zeit vielfach zu einer Aufgabe einzelner Personen- und Berufsgruppen oder herausragender Persönlichkeiten geworden. Von ihnen erwartet man — oder zumindest traut man es ihnen zu — daß sie soziale Verantwortung wahrnehmen und sich für die hilfsbedürftigen Mitmenschen einsetzen. Der Arzt kümmert sich um die Verletzten, der Sozialarbeiter oder Streetworker um Arbeitslose oder Obdachlose. Die Aufforderung Gottes an uns alle, sich hier nach eigenem Vermögen einzubringen hingegen verhallt ungehört. Zwar sind Liebe oder Nächstenliebe immer noch viel gebrauchte Wörter, doch ein Versuch, diese dann auch inhaltlich zu füllen scheitert meist daran, daß die Verwendung eher floskelhaft ausfällt, da oft eine Auseinandersetzung mit dem Thema über den bloßen Wortgebrauch hinaus ausbleibt.
Ziel dieser Unterrichtseinheit ist es nun, den Begriff Nächstenliebe ansatzweise wieder mit Inhalt zu füllen und ihn für die Schüler etwas greifbarer zu machen. Ihnen soll gezeigt werden, daß Nächstenliebe etwas ist, das alle Menschen angeht.
[...]
[1]Adam/Lachmann (Hrsg.): Religionspädagogisches Kompendium, S. 150–157[?]
[2]vgl. Fraas: Religiosität des Menschen, S. 252f.[?]
[3]zunächst eine 5. Stunde, am nächsten Tag eine 2.
[4]KWMBI I So.–Nr. 1/1992, S. 16
[5]vgl. Joest: Dogmatik, Bd. 2, S. 473 [?]
[6]vgl. Evangelischer Erwachsenenkatechismus, S. 551ff.[?]
[7]Joest, S. 474
[8]Joest, S. 474
[9]Erwachsenenkatechismus, S. 1206
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert ein didaktisches Bedingungsfeld, fachwissenschaftliche Aspekte, fachdidaktische Überlegungen und methodische Ansätze für zwei Unterrichtsstunden zum Thema Nächstenliebe im Alltag.
Welche Schule wurde für das Praktikum ausgewählt?
Das Praktikum fand am Marie–Therese–Gymnasium in Erlangen statt.
Wie war die Zusammensetzung der Praktikumsklasse?
Die Klasse bestand anfangs aus fünf Jungen und neun Mädchen, erweiterte sich aber im Laufe der Zeit auf 16 Schüler.
Wie wurde die Atmosphäre innerhalb der Klasse beschrieben?
Die Atmosphäre wurde als sehr gut und äußerst angenehm beschrieben, mit einer großen Bereitschaft der Schüler zur Mitarbeit.
Was war das übergeordnete Thema der Praktikumsstunden?
Das übergeordnete Thema war Nächstenliebe im Alltag, im Rahmen des Themenbereichs 6 "Nächstenliebe" des gymnasialen Lehrplans.
Wie wird Nächstenliebe aus christlicher Sicht definiert?
Nächstenliebe wird als die Umsetzung der Liebe Gottes zu den Menschen unter den Menschen verstanden, wobei es nicht um einzelne Taten geht, sondern um die ganze Zuwendung des Menschen zu seinen Mitmenschen.
Warum ist Nächstenliebe für Schüler schwer greifbar?
Schüler erleben eine durch Wettbewerb bestimmte Gesellschaft und erfahren weniger Beispiele für gelebte Nächstenliebe im Alltag. Nächstenliebe wird oft als Aufgabe einzelner Personen- oder Berufsgruppen wahrgenommen.
Was ist das Ziel der Unterrichtseinheit?
Das Ziel ist, den Begriff Nächstenliebe wieder mit Inhalt zu füllen und ihn für die Schüler greifbarer zu machen, indem gezeigt wird, dass Nächstenliebe etwas ist, das alle Menschen angeht.
Wer sind Adam und Lachmann?
Adam und Lachmann sind Autoren deren Vorschlag zur Gliederung von wissenschaftlichen Arbeiten verwendet wurde. Ihre Arbeit ist das "Religionspädagogisches Kompendium".
- Quote paper
- Christoph Lange (Author), 1997, Nächstenliebe im Alltag. Ein Unterrichtsentwurf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107204