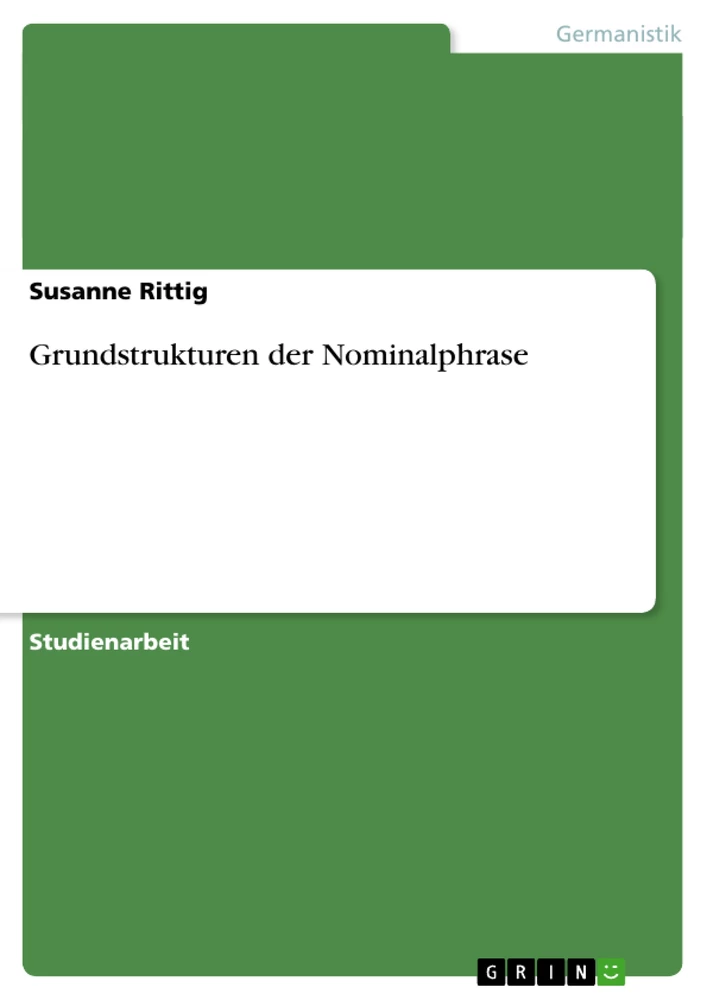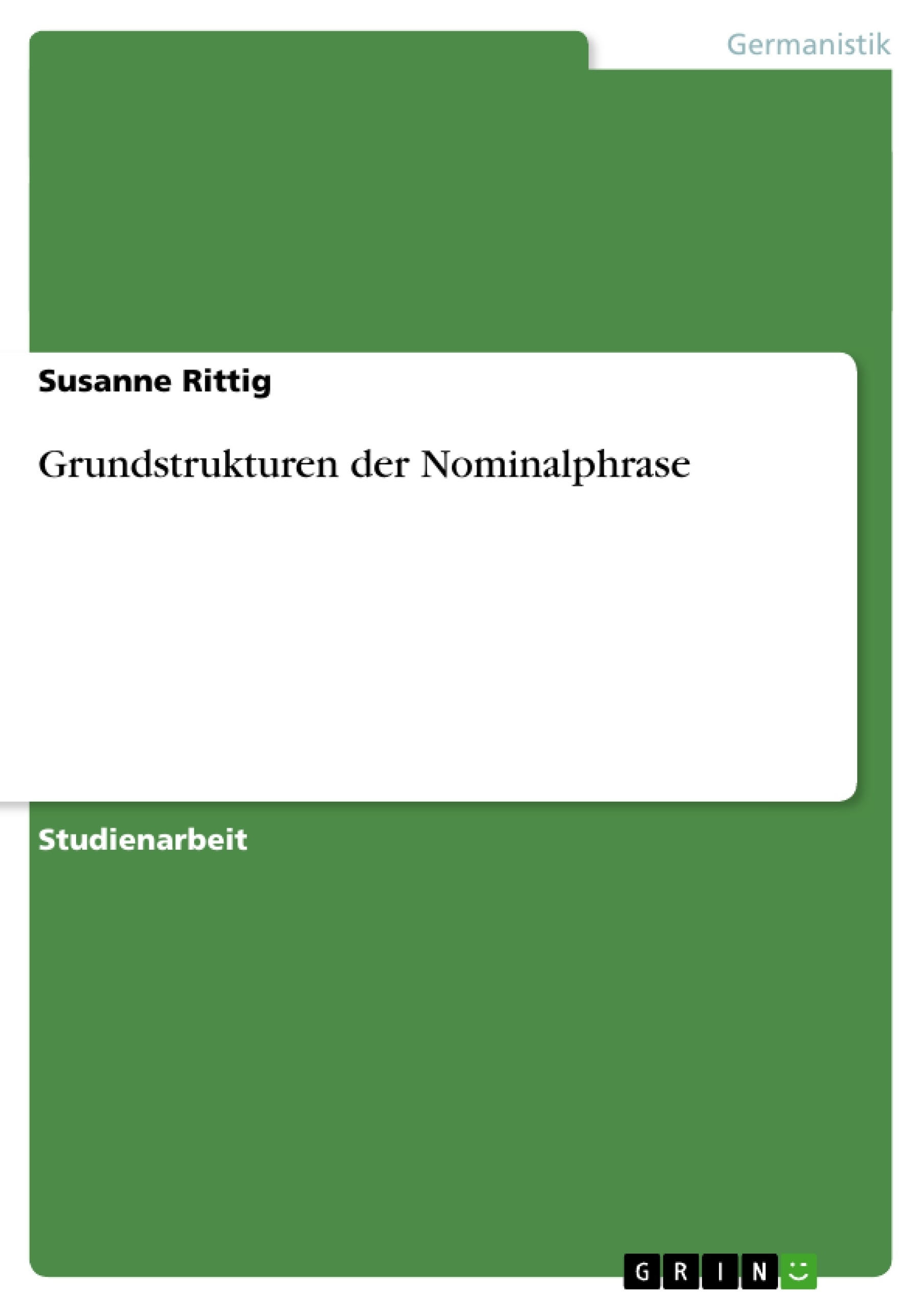Entdecken Sie die faszinierende Welt der deutschen Nominalphrase, ein komplexes Gefüge aus Artikeln, Nomen und ihren vielseitigen Begleitern! Diese tiefgreifende Analyse widmet sich der zentralen Rolle des Artikels, von seiner subtilen Beziehung zum Nomen bis hin zu seiner Funktion als entscheidende Determinante, die Wirklichkeitsbezug und Bedeutung verleiht. Tauchen Sie ein in die Feinheiten der Artikelflexion, die Unterscheidung zwischen definiten und indefiniten Kennzeichnungen und die quantifizierende Kraft, die in Artikeln verborgen liegt. Jenseits des Artikels enthüllt dieses Werk die vielfältigen weiteren Bestandteile der Nominalphrase, von den obligatorischen Determinativ bis zu den fakultativen Adjektiven und Genitivattributen, die im Vor- und Nachfeld agieren. Erforschen Sie die subtilen Regeln, die die Abfolge dieser Satelliten bestimmen, und gewinnen Sie ein tiefes Verständnis für die Struktur und den Aufbau komplexer Nominalphrasen. Lassen Sie sich von den Folgeregeln für Vor- und Nachfeld leiten, um stilistische Nuancen zu meistern und die Ausdruckskraft Ihrer Sprache zu verfeinern. Ob Germanistikstudent, Sprachwissenschaftler oder einfach nur Liebhaber der deutschen Sprache – diese umfassende Untersuchung eröffnet neue Perspektiven auf die grammatikalischen Feinheiten, die unsere Kommunikation prägen. Erfahren Sie, wie die präzise Anordnung von Determinativ, Adjektiv und Genitivus possessivus die Bedeutung und Wirkung eines Satzes beeinflusst, und meistern Sie die Kunst, Nominalphrasen bewusst und wirkungsvoll einzusetzen. Entdecken Sie die subtilen Unterschiede zwischen stellungsfesten, frei verschiebbaren und dislozierbaren Satelliten und lernen Sie, wie diese Flexibilität die Ausdruckskraft der deutschen Sprache bereichert. Ein unverzichtbarer Leitfaden für jeden, der die deutsche Grammatik in ihrer ganzen Tiefe verstehen und beherrschen möchte, um die Nuancen der Sprache vollends auszuschöpfen und die eigene sprachliche Kompetenz zu erweitern. Vertiefen Sie Ihr Wissen über Nominalphrasen und die Bedeutung von Artikeln, Determinantien und Quantoren im deutschen Satzbau.
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
2. Der Artikel in der Nominalphrase
2.1 Beziehung zum Nomen
2.2 Was ist ein Artikel ?
2.3 Artikelflektion
2.4 Artikel als Determinantien
2.5 Quantoren
3. Weitere Bestandteile der Nominalphrase
3.1 Satelliten im Vorfeld
3.1.1 Determinativ
3.1.2 Adjektiv
3.1.3 Genitivus possessivus
3.1.4 Situativangaben
3.2 Die Abfolge der Satelliten
3.3 Folgeregeln für das Vorfeld
3.4 Folgeregeln für das Nachfeld
4. Literaturangaben
1.Einleitung
Im nachfolgenden Text werde ich zunächst erläutern, was Artikel sind, welche Bedeutung sie für die Nominalphrase haben, wie sie flektiert werden, was ihre semantische Funktion ist und in welche Kategorien man sie unterteilen kann. Dabei werde ich mich an die Ausführungen in Peter Eisenbergs Grammatik halten.
Anschließend werde ich weitere, wichtige Bestandteile der Nominalphrase vorstellen und deren Regeln bezüglich Stellung und Abfolge erklären. Als Grundlage wird mir dabei die Grammatik von Ulrich Engel dienen.
2.Der Artikel in der Nominalphrase
Der Artikel hat für die Nominalphrase eine ganz besondere Bedeutung. Dies wird deutlich, wenn man sich überlegt, was eine Nominalphrase überhaupt ist. Betrachten wir das Nomen ohne den Artikel, so hat es nur rein namengebende Funktion. Erst in Verbindung mit einem Artikel erhält das Nomen Wirklichkeitsbezug, es wird in eine Nominalphrase überführt. Als Minimalbestandteil einer Nominalphrase ergibt sich also: Artikel + Nomen
2.1 Beziehung zum Nomen
Laut Eisenberg darf man nun aber nicht davon ausgehen, dass es sich beim Artikel nur um den Begleiter des Nomens handelt, auch wenn sein Hauptmerkmal das Auftreten mit dem Nomen ist. Der Artikel kann sehr wohl ohne das Nomen auftreten, auch wenn dies seltener vorkommt.
Beispiel: (1) Die Katze schläft
(2) * Katze schläft
(3) Die schläft
An den Beispielen (1)-(3) wird dies deutlich. In (1) sind Artikel und Nomen realisiert. In (2) wurde der Artikel weggelassen, als Folge davon wird der Satz ungrammatisch. Bei (3) ist das Nomen getilgt, der Satz ist dennoch wohlgeformt. Der Artikel ist also nicht vom Nomen abhängig.
Eine Abhängigkeit des Artikels vom Nomen besteht jedoch insofern, als dass das Genus des Artikels vom Substantiv regiert wird. Jedes Substantiv hat ein festgelegtes Genus, dass erst durch den Artikel sichtbar wird (der Hund, die Katze, das Tier). Am Artikel erkennen wir, ob ein Substantiv Maskulinum, Femininum oder Neutrum ist.
2.2 Was ist ein Artikel ?
Die Frage, was nun alles zu den Artikeln zählt, ist schwierig zu beantworten. Ich werde mich hierbei an Eisenbergs Einteilung in Artikel und Pronomen halten. Eisenberg bezeichnet als Artikelparadigmen nur die, „..., deren Formen speziell auf den adsubstantivischen Gebrauch abgestimmt sind.“(Eisenberg 1994, 160).Folglich zählen dieser, jener und einige nicht zu den Artikeln. Sie alle können auch ohne Substantiv auftreten. Genauso wenig gehören einer, keiner und meiner zu den Artikeln, denn sie können nie adsubstantivisch auftreten. Als Artikel werden nur der, ein, kein, mein/dein/sein bezeichnet ( also bestimmter, unbestimmter Artikel, Negationsartikel und Possessivartikel).
2.3 Artikelflektion
Zur Flektion der Artikel ist zu sagen, dass der bestimmte Artikel ähnlich wie die Pronomina flektiert, jedoch kann man bei bestimmten Artikeln keine Trennung von Stamm und Endung unternehmen. Als Schema gilt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei Possessivartikeln, dem unbestimmten Artikel und dem Negationsartikel lässt sich eine Trennung von Stamm und Endung vornehmen. Sie flektieren alle nach folgendem Schema:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als Ausnahme gilt dabei, dass ein keinen Plural hat. Ein ist im Plural nicht realisiert, der Plural wird durch das Substantiv selbst ausgedrückt.
Bsp.: (4) eine Katze → Katzen
Man spricht bei der Artikellosigkeit im Plural vom Nullartikel.
2.4 Artikel als Determinantien
Eisenberg ordnet den Artikeln verschiedene semantischen Funktionen zu. Er unterscheidet dabei zunächst zwischen definiten und nicht definiten Kennzeichnungen von Artikeln. Während die Artikel mit definiten Kennzeichnungen ein bestimmtes Ding aus einer Menge der benennbaren Dinge bezeichnen ( der Hund aus der Menge aller Hunde auf dem Hof ), tun Artikel mit nicht definiten Kennzeichnungen dies nicht ( ein Hund, kein Hund ). Als semantische Funktion des Artikels kann man also die Signalisierung von definit/nicht definit für den Hörer benennen. Man sagt auch, Artikel haben eine Funktion als Determinantien.
Mit Artikel-Substantiv-Verbindungen bezieht man sich nicht nur auf einzelne Objekte oder bestimmte Mengen von Objekten, sondern auch auf Gattungen.
Bsp.: (5a) Die Katze ist ein schlaues Tier
(5b) Eine Katze ist ein schlaues Tier
In (5a) und (5b) ist nicht eine bestimmte Katze gemeint, sondern die ganze Gattung Katze. Diese Art von Sätzen nennt man „generisch“. Obwohl in (5a) und (5b) der bestimmte und der unbestimmte Artikel scheinbar die selbe Bedeutung haben, kann man nicht davon ausgehen, dass dies immer so ist. Das verdeutlicht folgendes Beispiel.
Bsp.: (6a) Das Fahrrad wurde um 1850 erfunden
(6b) Ein Fahrrad wurde um 1850 erfunden
Während (6a) ebenfalls als generisch bezeichnet werden kann, ist (6b)in dieser Lesart ungrammatisch.
Sowohl im Singular wie im Plural bleibt in generischen Sätzen der Unterschied zwischen definit und nicht definit erhalten. Man bezieht sich entweder auf die ganze Gattung oder auf eine beliebige Teilmenge.
Weiterhin kann man Artikel spezifisch gebrauchen, das bedeutet, dass man durch den Artikel kennzeichnet, dass man ein ganz bestimmtes, einzelnes Objekt meint. Der Hörer hat für dieses Objekt eine kognitive Adresse.
Bsp.: (7) Ich habe einen Hund gekauft
Für manche Sätze gibt es zwei verschiedene Lesarten. Man kann sich sowohl auf ein ganz bestimmtes Objekt beziehen, also den Artikel spezifisch gebrauchen, man kann sie aber auch nicht spezifisch lesen, dann spricht man auch von indefiniter Lesart.
Bsp.: (8) Ich suche einen Hund
2.5 Quantoren
Neben der Artikelfunktion als Determinantien gibt es auch ein Funktion der Artikel als Quantoren. Unter Quantoren versteht man einfach gesagt die Artikel, mit denen Quantitäten bezeichnet werden. Zu Quantoren zählen teilweise Artikel wie z.B. ein, kein, aber auch Numeralia wie zwei, drei, … oder Pronomina. Quantoren können mit Determinantien kombiniert werden. Bsp.: (9) Die vielen Bilder.
Besonderes Kennzeichen der Quantoren ist ihre Dislozierbarkeit. Sie können im Gegensatz zu Determinantien vom Nomen getrennt werden.
Bsp.: (10a) Bäume haben wir viele gefällt (10b) *Bäume haben wir die gefällt Dagegen können Determinantien mit Nomen im Satz nach rechts herausgestellt werden, Quantoren mit Nomen jedoch nicht.
Bsp.: (11a)Ich habe es ihr gegeben das Geld (11b) *Ich habe es ihr gegeben viel Geld
3.Weitere Bestandteile der Nominalphrase
Eine Nominalphrase enthält immer ein Nomen als Kern und mindestens ein Determinativ als Satelliten.. Neben dem Determinativ kann eine Nominalphrase noch weitere Satelliten beinhalten. Satelliten sind in diesem Sinne Erweiterungsmittel für die Nominalphrase. Sie können aus einzelnen Wörtern oder Wortphrasen bestehen und dienen zur Ergänzung des Kerns. Sie lassen sich nach ihren Ausdrucksformen gliedern in:
1. Adjektive/Adjektivphrasen
2. genitivische Nominalphrasen
3. Präpositionalphrasen
4. Partikel/Partikelphrasen sonstiger Art
5. finite Nebensätze
6. Infinitivsätze
sowie wenige Satelliten anderer Art. Einem Nomen können fast beliebig viele Satelliten beigefügt werden. Diese sind dann entweder Ergänzungen oder Angaben zum Nomen.
3.1 Satelliten im Vorfeld
Man unterscheidet bei der Nominalphrase zwei Stellungsfelder für die Satelliten. Als Vorfeld bezeichnet man alles, was links vom Kern der Nominalphrase steht. Alles, was rechts steht, wird als Nachfeld bezeichnet. Steht in einem dieser Stellungsfelder gar nichts, sagt man, das Feld ist nicht besetzt.
Im Vorfeld einer Nominalphrase können verschiedene Satelliten stehen, die entweder Angaben oder Ergänzungen zum regierenden Nomen sind. Nomenangaben können bei beliebigen Nomen vorkommen, Nomenergänzungen jedoch nur bei bestimmten Nomen. Ich werde im Folgenden nur auf die Nomenangaben näher eingehen.
3.1.1 Determinativ
Jedes Nomen wird von einem Determinativ begleitet, auch wenn dieser nicht sichtbar ist (Nullartikel).Das Determinativ ist der einzige obligatorische Satellit des Nomens. Das Determinativ stimmt in Genus, Numerus und Kasus immer mit dem Nomen überein. Auch ist vom Determinativ die Flexion eines Adjektivs in der Nominalphrase abhängig sofern dieses im Vorfeld steht. Im Gegensatz zu der oben besprochenen Definition und Einteilung der Artikel nach Eisenberg teilt Engel die Determinative ein in:
- Possessive Determinative: sie „stellen ein Zugehörigkeitsverhältnis zwischen zwei Größen her“(Engel 1991, 607), z.B. mein Buch, seine Jacke
- Demonstrative Determinative: sie weisen auf ein bestimmtes Objekt hin, z.B. diese Kisten, jene H ä user
- Indefinite Determinative: sie tragen zu Existenzaussagen bei, z.B. manche Kinder, irgendein Baum
- Das negative Determinativ: es macht eine negative Existenzaussage, z.B. kein Geld
- Interrogative Determinative: sie dienen zum Erfragen von Größen, z.B. welche Tasche, was f ü r eine Ä rztin Im Regelfall steht immer nur ein Determinativ vor dem Nomen, Kombinationen sind jedoch (wie bereits erwähnt) möglich. Determinative können mit allen anderen Satelliten kombiniert auftreten, z.B. die große Sache (kombiniert mit Adjektiv).
3.1.2 Adjektiv
Es handelt sich hierbei um einen fakultativen Satelliten. Das Adjektiv steht im Regelfall zwischen dem Determinativ und Nomen, bzw. zwischen dem Sächsischen Genitiv und dem Nomen.
Bsp.: (12) Das schöne Boot
(13) Gabis gelbe Tasche
Wenn weder Determinativ noch Sächsischer Genitiv realisiert sind, steht das Adjektiv an erster Stelle der Nominalphrase.
Bsp.: (14) reife Äpfel
Die Adjektive richten sich bei ihrer Flektion in Genus, Numerus und Kasus nach dem Kern der Nominalphrase und werden von dem Determinativ beeinflusst. In Nominalphrasen mit bestimmtem Artikel wird das Adjektiv schwach flektiert, in Nominalphrasen mit Nullartikel wird es stark flektiert, bei unbestimmtem Artikel entsteht eine Mischung aus beiden Flektionsschemen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In seltenen Fällen bleiben Adjektive im Vorfeld unflektiert. Dieser Gebrauch ist allerdings heute meist veraltet und auf neutrale Nomina beschränkt (z.B. jung Siegfried, ein einzig Kind, Kölnisch Wasser). Adjektive bestimmen das regierende Nomen näher. Man kann zwischen verschiedenen Subklassen von Adjektiven unterscheiden, je nach dem, welche Art von Aussage sie machen:
- Quantifikative Adjektive, die etwas über die Quantität des Nomens aussagen, z.B. alle Kardinalzahlen
- Referentielle Adjektive, die auf Größen oder Textstellen verweisen oder Größen in eine bestimmte Ordnung bringen, z.B. alle Ordinalzahlen
- Qualifikative Adjektive, die etwas über die Qualität einer Sache aussagen.
- Herkunftsadjektive, die den Herkunftsort einer Sache benennen, z.B. Städtenamen wie der Hamburger Fischmarkt
- Klassifikative Adjektive, die eine Sache in eine Klasse einordnen, z.B. die st ä dtischen Kl ä ranlagen Die meisten Adjektive können ebenfalls Satelliten zu sich nehmen und bilden dann Adjektivphrasen. Dabei gehen dann wiederum die Satelliten dem Kern der Adjektivphrase voraus.
Bsp.: (15) der des Diebstahls beschuldigte Sohn
Das Adjektiv als Satellit der Nominalphrase lässt sich mit allen anderen Satelliten des Kerns kombinieren, z.B. Karls neuer Bus (mit Sächsischem Genitiv).
3.1.3 Genitivus possessivus
Der possessive Genitiv ist in den meisten Fällen dem Kern nachgestellt, er kann aber als Sächsischer Genitiv auch ins Vorfeld der Nominalphrase gerückt werden. Dann kann der obligatorische Determinativ allerdings nicht realisiert werden.
Bsp.: (16) Omas Auto
Ein Determinativ kann nur als Bestandteil des genitivischen Attributs die Nominalphrase einleiten.
Bsp.: (17) Meines Mannes Anzug
Der Sächsische Genitiv bringt immer ein Zugehörigkeitsverhältnis zum Ausdruck und kommutiert daher mit dem possessiven Determinativ.
3.1.4 Situativangaben
Sie erscheinen in poetischer Sprache und selten in der Alltagssprache im Vorfeld der Nominalphrase. Ansonsten sind sie immer im Nachfeld lokalisiert.
3.2 Die Abfolge der Satelliten
Im vorangehenden Textabschnitt über die Satelliten im Vorfeld der Nominalphrase wurden bereits die Stellungseigenschaften der jeweiligen Satelliten angegeben. Bei der Position der Satelliten unterscheidet man grundsätzlich drei Arten von Satelliten. Die erste Gruppe bilden die stellungsfesten Satelliten, die einem bestimmten Feld der Nominalphrase zugeordnet werden können. Dies sind z.B. Determinative und Adjektive, die immer im Vorfeld lokalisiert sind. Unter starken Einschränkungen können stellungsfeste Satelliten auch im anderen Feld vertreten sein. Eine weitere Gruppe bilden die frei verschiebbaren Satelliten, die sowohl Vorfeld als auch Nachfeld einer Nominalphrase besetzen können. Dazu gehören z.B. Nomen varians und invarians oder auch das Genitivus possessivus. Als letzte Gruppe sind die dislozierbaren Satelliten zu nennen, die nicht nur beide Felder besetzen können, sondern auch vom regierenden Nomen getrennt werden können und so zur Bildung einer diskontinu- ierlichen Nominalphrase führen. Zu ihnen gehören die oben genannten Quantoren, steigerbare Adjektive, Adjunkte und präpositive Attribute. Die Dislozierbarkeit hängt dann u.a. vom Kasus des regierenden Nomens ab (vgl. Engel 1991, 627-628).
Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass das Vorfeld viel häufiger besetzt ist als das Nachfeld, weil die beiden ausschließlichen Vorfeldelemente Adjektiv und Determinativ besonders häufig realisiert sind. Das Vorfeld muss, wie bereits erläutert immer mindestens ein Element enthalten, während das Nachfeld unbesetzt bleiben kann. Da das Nachfeld jedoch mehr Besetzungsmöglichkeiten bietet, ist es bei komplexen Nominalphrasen sehr wahrscheinlich, dass das Nachfeld mehr Elemente als das Vorfeld enthält.
3.3 Folgeregeln für das Vorfeld
Damit es beim Auftreten von mehreren Satelliten gleichzeitig nicht zu Problemen kommt, formuliert Engel einige Regeln für die Abfolge der Satelliten.
1. Das Determinativ steht immer am Anfang des Vorfeldes; bei mehreren Determinativen kommen zuerst die unflektierten, dann die flektierten.
2. Nomen varians und invarians stehen jeweils allein vor dem regierenden Nomen und schließen so weitere Vorfeldelemente aus
3. Der Sächsische Genitiv schließt ein Determinativ vor dem regierenden Nomen aus; er steht dann anstelle des Determinativs an erster Position in der Nominalphrase.
4. Das Adjektiv steht zwischen Determinativ und regierendem Nomen Bei mehreren Adjektiven entspricht die Abfolge der Reihenfolge der obengenannten Subklassen.
3.4 Folgeregeln für das Nachfeld
Auch für das Nachfeld legt Engel entsprechende Folgeregeln fest:
1. An erster Stelle des Nachfeldes stehen die genitivischen Attribute; stellungsgleich mit ihnen sind Nomen varians und invarians.
2. Dann folgen die präpositiven, direktiven, expansiven und nominalen Attribute (Es kann immer nur eines der genannten auftreten, sie schließen sich gegenseitig aus).
3. An dritter Stelle stehen die Qualitativangaben und Komitativangaben, die sich ebenfalls gegenseitig ausschließen.
4. An vierter Stelle folgen die Situativangaben.
5. An letzter Stelle stehen die satzartigen Attribute.
Gehäuft auftretende Elemente werden genauso angeordnet wie einfache Elemente.
Abweichungen von diesen Folgeregeln treten im Vorfeld lediglich bei den Subklassen der Adjektive untereinander auf, wobei darauf dann allerdings auf Sinnänderungen geachtet werden muss.
4. Literaturangaben
- Eisenberg, Peter: Grundriss der deutschen Grammatik. 3.Aufl. Stuttgart: Metzler 1994. Abschnitt 5.2.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Textes?
Dieser Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen sind Artikel in der Nominalphrase, die Beziehung zum Nomen, die Definition von Artikeln, Artikelflektion, Artikel als Determinantien, Quantoren und weitere Bestandteile der Nominalphrase wie Satelliten im Vor- und Nachfeld.
Was ist die Bedeutung des Artikels in der Nominalphrase?
Der Artikel verleiht dem Nomen Wirklichkeitsbezug und überführt es in eine Nominalphrase. Er ist ein Minimalbestandteil einer Nominalphrase (Artikel + Nomen).
Ist der Artikel vom Nomen abhängig?
Nein, der Artikel ist nicht vom Nomen abhängig, obwohl das Genus des Artikels vom Substantiv regiert wird.
Was zählt alles zu den Artikeln?
Laut Eisenberg zählen nur der, ein, kein, mein/dein/sein zu den Artikeln (bestimmter Artikel, unbestimmter Artikel, Negationsartikel und Possessivartikel).
Wie werden Artikel flektiert?
Der bestimmte Artikel wird ähnlich wie Pronomina flektiert. Possessivartikel, der unbestimmte Artikel und der Negationsartikel lassen sich in Stamm und Endung trennen und flektieren nach einem bestimmten Schema.
Was ist die semantische Funktion der Artikel?
Artikel signalisieren, ob ein Ding definit oder nicht definit ist. Sie haben eine Funktion als Determinantien.
Was sind Quantoren?
Quantoren sind Artikel, mit denen Quantitäten bezeichnet werden (z.B. ein, kein, zwei, drei).
Was sind Satelliten in der Nominalphrase?
Satelliten sind Erweiterungsmittel für die Nominalphrase, die aus einzelnen Wörtern oder Wortphrasen bestehen und zur Ergänzung des Kerns (Nomen) dienen.
Welche Arten von Satelliten gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Satelliten, darunter Adjektive/Adjektivphrasen, genitivische Nominalphrasen, Präpositionalphrasen, Partikel/Partikelphrasen, finite Nebensätze und Infinitivsätze.
Was ist das Vor- und Nachfeld der Nominalphrase?
Das Vorfeld ist alles, was links vom Kern der Nominalphrase steht, und das Nachfeld ist alles, was rechts steht.
Was ist ein Determinativ?
Ein Determinativ ist der einzige obligatorische Satellit des Nomens. Er stimmt in Genus, Numerus und Kasus immer mit dem Nomen überein.
Welche Arten von determinativen gibt es?
Possessive Determinative, Demonstrative Determinative, Indefinite Determinative, negative Determinative und interrogative Determinative.
Wie werden Adjektive flektiert?
In Nominalphrasen mit bestimmtem Artikel wird das Adjektiv schwach flektiert, in Nominalphrasen mit Nullartikel wird es stark flektiert, bei unbestimmtem Artikel entsteht eine Mischung aus beiden Flektionsschemen.
Was ist der Sächsische Genitiv?
Der Sächsische Genitiv ist eine Form des Genitivus possessivus, der ins Vorfeld der Nominalphrase gerückt werden kann.
Welche Regeln gelten für die Abfolge der Satelliten im Vorfeld?
Das Determinativ steht immer am Anfang des Vorfeldes; bei mehreren Determinativen kommen zuerst die unflektierten, dann die flektierten. Nomen varians und invarians stehen jeweils allein vor dem regierenden Nomen. Der Sächsische Genitiv schließt ein Determinativ vor dem regierenden Nomen aus. Das Adjektiv steht zwischen Determinativ und regierendem Nomen.
Welche Regeln gelten für die Abfolge der Satelliten im Nachfeld?
An erster Stelle des Nachfeldes stehen die genitivischen Attribute; stellungsgleich mit ihnen sind Nomen varians und invarians. Dann folgen die präpositiven, direktiven, expansiven und nominalen Attribute. An dritter Stelle stehen die Qualitativangaben und Komitativangaben, die sich ebenfalls gegenseitig ausschließen. An vierter Stelle folgen die Situativangaben. An letzter Stelle stehen die satzartigen Attribute.
- Quote paper
- Susanne Rittig (Author), 2002, Grundstrukturen der Nominalphrase, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107186