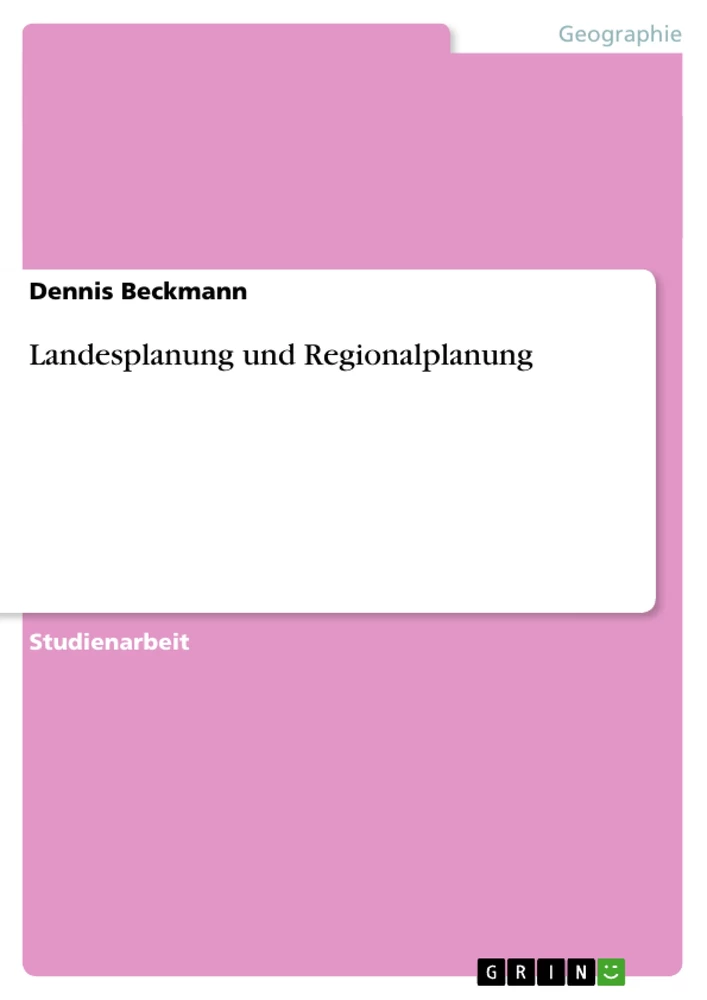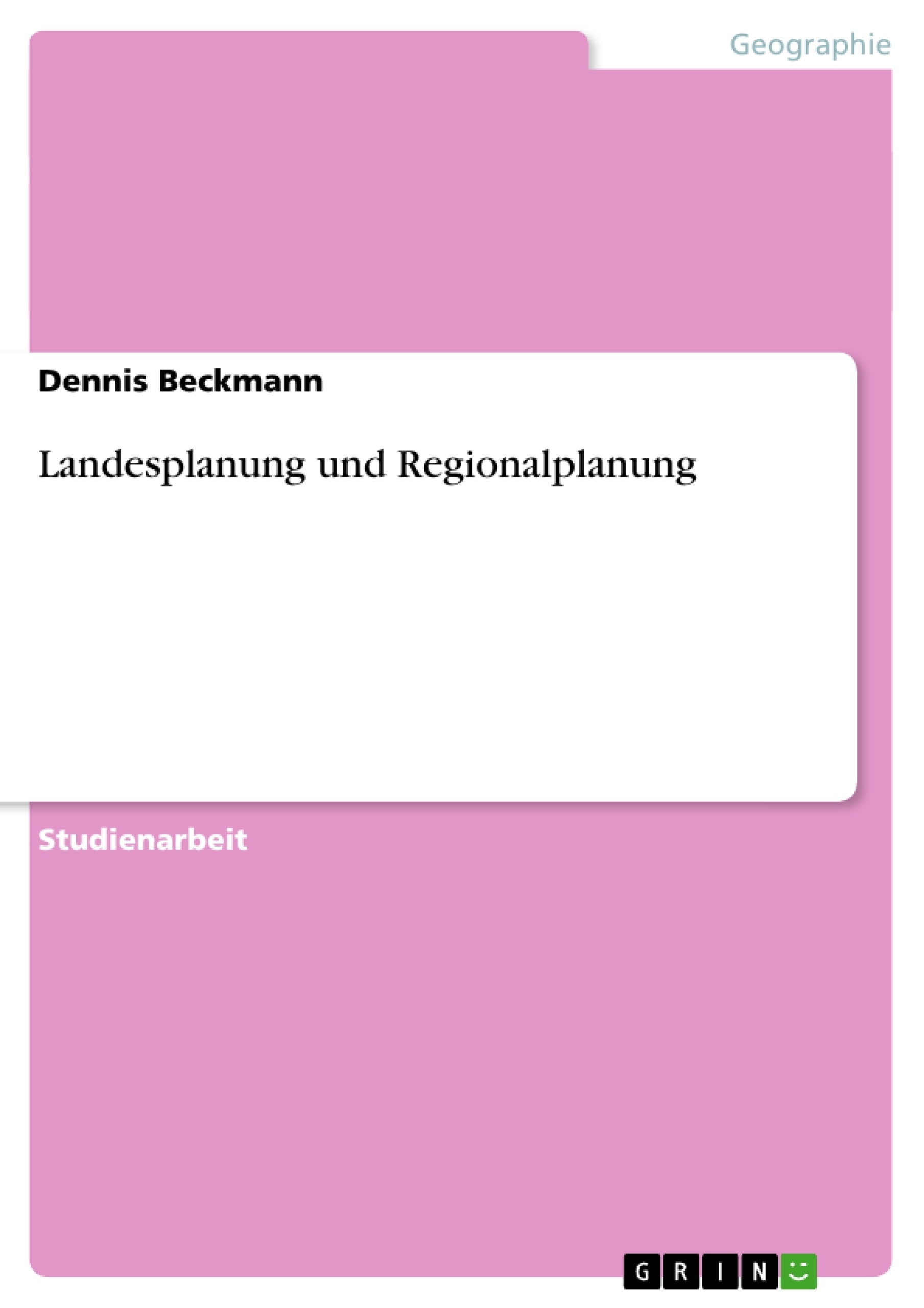In einer Welt, die sich ständig verändert und weiterentwickelt, stellt sich die dringende Frage: Wie gestalten wir unseren Lebensraum zukunftsfähig und nachhaltig? Dieses Buch enthüllt die komplexen Mechanismen der Landes- und Regionalplanung in Deutschland und bietet einen faszinierenden Einblick in die vielschichtigen Prozesse, die unsere Städte und Regionen formen. Von den grundlegenden politischen Leitvorstellungen des Bundesraumordnungsgesetzes bis hin zu den konkreten Maßnahmen der Regionalplanung vor Ort – der Leser wird auf eine spannende Reise durch das Dickicht der Gesetze, Verordnungen und Interessenkonflikte mitgenommen. Es wird verständlich, wie auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene zusammengearbeitet wird, um gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen, die Umwelt zu schützen und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Dabei werden die zentralen Instrumente der Raumordnung, wie Landesentwicklungspläne und regionale Raumordnungsprogramme, ebenso beleuchtet wie die Herausforderungen, die sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen Gesamtplanung und Fachplanungen ergeben. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Gegenstromprinzip, das als demokratischer Lösungsansatz zur Bewältigung konkurrierender Interessen dient. Doch wie gelingt es, die unterschiedlichen Ansprüche von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft in Einklang zu bringen? Welche Rolle spielen dabei die verschiedenen Akteure, von Landesplanungsbehörden über Kommunen bis hin zu Bürgern? Und wie können wir sicherstellen, dass unsere Planungen den Bedürfnissen zukünftiger Generationen gerecht werden? Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die Gestaltung unserer räumlichen Umwelt interessieren, sei es als Planer, Politiker, Wissenschaftler oder engagierter Bürger. Es bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der Landes- und Regionalplanung, sondern regt auch zum Nachdenken über die Zukunft unserer Städte und Regionen an. Tauchen Sie ein in die Welt der Raumordnung und entdecken Sie, wie wir gemeinsam eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft gestalten können. Die Analyse der Raumstrukturen, Siedlungsstrukturen und Infrastrukturmaßnahmen ermöglicht ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen der räumlichen Entwicklung. Das Buch bietet somit eine wertvolle Grundlage für die strategische Planung und Umsetzung von Projekten in den Bereichen Stadtentwicklung, Regionalentwicklung und Umweltschutz. Es zeigt auf, wie durch eine effektive Koordination und Beteiligung aller Akteure eine nachhaltige und ausgewogene Raumentwicklung erreicht werden kann.
Universität Hamburg Sommersemester 2001
Mittelseminar zur Regional- und Stadtplanung
Die Aufgaben der Landes- und Regionalplanung
Allgemein dient Planung dem Vorausdenken zukünftiger Handlungen. Die räumliche Planung oder Raumplanung ist die Übertragung des vorsorgenden Vorausdenkens auf den Raum. Mit ihrer Hilfe sollen die Strukturen eines Raumes geordnet und in ihrer Entwicklung gefördert werden. Somit hat sich der Begriff der Raumordnung gebildet (Spitzer 1995, S.14). In ihrem Inhalt betrifft die Raumordnung alle öffentliche und privaten Maßnahmen, stellt aber keine zentrale Gesamtplanung dar, sondern bildet den Ordnungsrahmen für die räumliche Ein- und Zuordnung öffentlicher Fachplanungen, kommunaler Bauleitplanung und öffentlicher und privater Investitionen.
Die Raumordung unterliegt klaren und grundlegenden politischen Leitvorstellungen, die verfassungspolitisch im Bundesraumordnungsgesetz (ROG) vom Bund formuliert sind (Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg- Vorpommern , S.6). Das ROG regelt gemeinsam mit dem Bundesbaugesetz die räumliche Entwicklung des gesamten Bundesgebietes.
Der Bund erlässt bei der räumlichen Planung Rahmenbedingungen, um den Zusammenhalt des Bundesstaates und eine Entwicklung vergleichbarer Ordnung in allen Bundesländern sicherzustellen. Zu den grundsätzlichen Leitvorstellungen der Raumordnung gehören z.B.:
- Schutz und Entwicklung der Lebensgrundlagen
- Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilräumen (u.a. Anpassung von Sozial- und Wirtschaftsstrukturen; ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ver- dichtungsräumen und ländlichen Räumen)
- Erhaltung und Stärkung ökologischer Funktion (Spitzer 1995, S.22).
Der Bund besitzt das Recht und die Kompetenz (n. Art.75 Ziff. 4d.GG), Rahmenvorschriften zu ändern und zu erlassen. Auf der Grundlage des ROG werden die Zielsetzungen der einzelnen Fachplanungen und der Landesentwicklung für das gesamte Bundesgebiet im Bundesraumordnungsprogramm (BROP) dargestellt (Leser, H. et. al.1997).
Aus dem Bundesraumordnungsgesetz geht die Verpflichtung der Bundesländer zur räumlichen Landesplanung hervor. Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung werden im vorgegebenen Rahmen auf Landesebene vertieft und auf die einzelnen Bedingungen des jeweiligen Bundeslandes modifiziert.
Auf dieser Basis werden in der Landesplanung Landesentwicklungspl ä ne- und programme erarbeitet (Spitzer 1995, S.24).
Es lassen sich folgende Inhalte und materielle Steuerungselemente in den Plänen und Programmen finden:
- Räumliche Gliederung
Innerhalb dieser Gliederung sollen Verdichtungsräume, ländliche Siedlungen und Förderungsgebiete voneinander abgegrenzt werden und eine Unterscheidung in Ordnungs-, Gestaltungs- und Entwicklungsräumen vorgenommen werden. Hierbei wird eine Unterteilung in Regionen eines Bundeslandes vorgenommen, was eine entscheidende Rolle für die Durchführung der Regionalplanung spielt.
- Regionale Siedlungsstruktur
Hierbei werden räumliche Verteilungen der Siedlungen und das sich zu entwickelnde Siedlungssystem festgelegt. Es werden Zentrale Orte in den Kategorien Ober-, Mittel und Unterzentren sowie ihre Verflechtungsbereiche bestimmt und festgelegt, in welchen bevorzugt angesiedelt und die Entwicklung gefördert werden soll. Die Bestimmung von Siedlungsachsen und somit die Festlegung von Trassen und überregionalen Achsen sollen die Infrastruktur und die bauliche Entwicklung bündeln, um Freiräume zu erhalten und Ressourcen zu sparen.
Ziel ist es, eine möglichst gleichmäßige Verteilung Zentraler Orte zu erhalten, die die Versorgung der Bevölkerung gebietsdeckend sicherstellt.
- Großräumige infrastrukturelle Maßnahmen Hier werden die wichtigsten Verkehrsverbindungen festgelegt
- Vorsorgestandorte Besonders für Industrie und andere großflächige Nutzung müssen geeignete Standorte sichergestellt werden, die z.B. eine mögliche Ausdehnung ermöglichen (beispielsweise Großkläranlagen, Mülldeponien, Abbau von Bodenschätzen etc.)
- Vorranggebiete
Gebiete, in denen Raumfunktionen besonders geschützt und/ oder entwickelt sind, werden als Eignungsräume festgelegt. Je nach der Bedeutung haben sie Vorrang vor allen anderen Nutzungen (Vorranggebiete) oder sie haben ein besonderes Gewicht in der Abwägung bei konkurrierenden Nutzungen (s. Vorsorgeraum). Schützenswerte Naturräume werden ausgewiesen, um Arten und Biotope zu erhalten. (Spitzer 1995, S.37)
Die gesamtplanerische Landes- und Regionalplanung koordiniert die Planung der Fachplanung . Die Gesamtplanung behandelt alle in Betracht kommenden Lebensplanung gleichwertig, ihre Schwäche liegt dabei aber in der fachlichen Genauigkeit. Die Fachplanungen haben den Vorteil ihrer hohen fachlichen Kompetenz. Sie befassen sich z.B. speziell mit Natur- und Landschaftsschutz, Städtebau, regionaler Wirtschaftsstruktur, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Verkehrs- und Nachrichtenwesen, Energie, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Altlastenbeseitigung, Immissionsschutz, Bildung, Kultur und Sport.
Die Fachplanungen übernehmen die fachliche Planung und deren Realisierung, wirken an den Programmen mit und beteiligt sich an der Bauleitplanung (Spitzer 1995, S.37). Sie sind in Bund, Ländern, Gemeinden und Bezirken installiert und verfügt über die zur Ausführung erforderlichen Finanzmittel (Leser, H. et.al.1997).
Die Planungen der Fachplanungen, die häufig untereinander konkurrieren, werden dann von der Gesamtplanung möglichst demokratisch in einem einheitlichen Plan oder Programm aufgenommen. So können auch Gruppeninteressen, entsprechend ihrer Bedeutung im Gesamtinteresse berücksichtigt werden.
Planungen konkurrieren häufig um Ressourcen, da jeder Planungsträger bei seiner Planung immer auch auf andere Planungsträger mit anderen Interessen und Zielen trifft. Deshalb ist es wichtig, dass ein Interessenausgleich und so ein Kompromiss zwischen den einzeln verfolgten Zielen stattfindet. Zur Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe gibt es das Gegenstromprinzip. Es läuft dabei in zwei Bereichen ab:
1. Zwischen den einzelnen Ebenen (Gesamtplanung und Fachplanung)
2. Innerhalb der einzelnen Ebenen (Gesamtplanung und Fachplanung), aber auch innerhalb der Fachplanungen.
Dabei kommt es aber nicht automatisch immer zu einer optimalen Einigung. Das Gegenstromverfahren läuft immer der Gefahr sich ineffizient zu differenzieren und durch Weisungsdiktatur außer Kraft gesetzt zu werden. Dennoch ist es ein demokratischer Lösungsweg, der aber sehr von der Qualität der Koordination der gesamtplanerischen Institutionen abhängt (Spitzer 1995, S.28ff).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1) Zielanpassung im Gegenstromverfahren. Entwurf H. Spitzer
Quelle: Spitzer, Hartwig (1995): Einführung in die räumliche Planung Ulmer Verlag, Stuttgart, Seite 31
Bei der Planung müssen bestimmte Standards eingehalten werden. Es gibt verschiedene Richtwerte für die Bevölkerungsentwicklung, Gewerbeansiedlungen und Wohnsiedlungen. Die gleichzeitige Erfüllung der Daseinsgrundbedürfnisse und Umweltstandards zum Schutz der Natur und Bevölkerung müssen ebenfalls erfüllt sein.
Ansonsten gibt es aber keinen allgemein verbindlichen Sachkatalog für Inhalte der Landesplanung (Spitzer 1995, S.38).
Ziel der Landesplanung ist die Erstellung eines Landesentwicklungsplan, dem aber verschiedene Vorarbeiten vorausgehen. Jede oberste Planungsbehörde wirkt in der Ministerkonferenz für Raumordnung mit und stimmt hier hinsichtlich ihrer Aktivitäten mit den anderen Bundesländern und der Bundesregierung ab. Je nach Bundesland besteht die Pflicht, einen Landesraumordnungsbericht zu erstellen, der über den Erfolg oder Misserfolg der bisherigen Maßnahmen und der noch vorgesehenen Entwicklungen reflektiert. Dabei ergibt sich die Gelegenheit, auch Analysen über die Entwicklung verschiedener Dynamiken (z.B. Pendlerströme) über Teilgebiete des gesamten Bundesgebiets anzufertigen (Spitzer 1995, S.38ff).
Viel gewichtiger ist aber die Erstellung eines Landesentwicklungsprogramms, das von den Landesregierungen erstellt wird. Die Erstellung wird von dem Landesplanungsgesetz vorgesehen und stellt eine abstraktere Vorstufe des Landesentwicklungsplans dar. Es enthält eine Vielzahl von Zahlen, Karten und Texten.
Die Erstellung eines Landesentwicklungsprogramms ist aber nicht zwingend erforderlich, da der planerische und der programmatische Teil auch in dem Landesentwicklungsplan vereinigt werden können.
Je nach Bundesland erhält die Regionalplanung eine unterschiedlich starke Stellung.
Bei einer sehr eigenständigen, Regionalplanung bietet sich aber die Erstellung eines Landesentwicklungsprogramms an, da es mehr Freiraum hinsichtlich der Zielsetzung gibt und es von Parteien und Parlament leichter zu kontrollieren ist, als der Landesentwicklungsplan. Gerade in den neuen Bundesländern fallen die Landesentwicklungspläne deswegen viel umfangreicher aus.
Der Grund liegt darin, dass programmatische Erklärungen in ihrer politischen Verbindlichkeit und in der Fixierung der räumlichen Auswirkung eine viel geringere Bedeutung hat, was vielen Bundesländern zugute kommt.
Bei der Erstellung des Landesentwicklungsplans werden zu der umfangreichen Ausarbeitung verschiedene fachliche Abstimmungen erforderlich.
Der Planungsträger ist hierbei die Landesplanungsbehörde, die Beirat, Spitzenverbände und Körperschaften anhört. Hieraus ergeben sich Überarbeitungen des dann später von der Landesregierung zu beschließenden Landesentwicklungsprogramms (Spitzer 1995, S.40ff).
Am Ende steht die Erstellung des Landesentwicklungsplans, der sich im Sachkatalog kaum von dem Programm unterscheidet, sondern Sachverhalte verbindlicher und konkreter vorgegeben sind.
Der Interministerielle Ausschuss für Raumordnung und der Landesbeirat (Vertretung durch kommunale Landesverbände, Kammern, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, teilweise Kirchen, Kreditinstitute und Hochschulen) bekommt hier die Aufgabe der noch gründlicheren Abstimmung der Beteiligten und Betroffenen. Der Landesbeirat, der auch beratend an der Erstellung der Landesentwicklungsprogramme wirkt, hat hier aber die entscheidende Funktion der Ausarbeitung der Pläne.
Die Landesregierung verabschiedet die fertigen Pläne, die 100 bis 200 Seiten und ein Kartenwerk beinhalten. Die aus ihm hervorgehenden Aussagen binden die Behörden des Landes, des Bundes, der Landkreise und die Gemeinden(Spitzer 1995, S.41f). Für Stadtstaaten gelten jeweils vereinfachte Sonderregelungen. Die Aufgabe des Landesentwicklungsplans wird häufig von dem Flächennutzungsplan, bzw. der kommunalen Bauleitplanung übernommen (Spitzer 1995, S.42).
Die erlassenen Landesplanungsgesetze gelten auch für die nächst untergeordnete regionale Ebene. Die verwaltungstechnische Organisation bleibt hierbei den einzelnen Ländern überlassen.
Die Regional- und Landesplanung bilden also eine gemeinsame rechtliche und organisatorische Einheit., die so zum ausschlaggebenden Teil der überörtlichen Gesamtplanung wird.
Schema des Zusammenwirkens der Ebenen und Instrumente der Raumordnung (am Beispiel Mecklenburg-Vorpommern)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb2.) Im Ü berblick: f ü r alle Betroffenen gilt:
- Jedes Element ist für einen Bereich zuständig und verfügt über ein spezielles Instrument
- Alle Instrumente bauen aufeinander auf
- Alle Ebenen wirken zusammen, müssen sich gegenseitig beteiligen
- Alle Instrumente sind nach ihrer gesetzmäßigen Aufstellung für alle anderen Beteiligten verbindlich
- Koordination durch Information sollte den gesamten Planungsprozess begleiten
Wie die verschiedenen Beteiligten und die unterschiedlichen Instrumente im einzelnen zusammenspielen, ist zusammenfassend in der Grafik dargestellt
Quelle: Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.)/
Landesplanungsbehörde (o.J.): Raumordnung in Mecklenburg-Vorpommern Ein Beitrag zur Gestaltung unseres Landes und unserer Zukunft, Seite 24f
Die Regionalplanung ist vom Bundesraumordnungsgesetz vorgesehen. Geregelt wird sie in den jeweiligen Bundesländern durch die Landesplanungsgesetze, durch die auch die Planungsregionen festgelegt werden. Diese Planungsregionen bilden die räumlichen Gebietseinheiten der Regionalplanung. Als Region wird hier ein Gebiet verstanden, das sich räumlich abgrenzt durch seine geographische Lage, das Regionalbewusstsein der Bevölkerung und durch die natürlichen und wirtschaftlichen Standortfaktoren. Außerdem sollte dieses Gebiet ausgewogene Lebensbedingungen bieten, so dass die Bevölkerung intraregional versorgt werden kann. Hieraus ergibt sich eine Mindestgröße und das Vorhandensein eines leistungsfähigen Oberzentrums (Spitzer 1995, S.47). Eine Planungsregion kann auch einem Regierungsbezirk oder mehreren zusammengehörigen Landkreisen entsprechen. Durch die genannte Einteilung verspricht man sich eine gezieltere, auf die Eigenart des Gebietes abgestimmte Entwicklungsförderung.
Hierbei ist es Aufgabe der Regionalplanung, die Ziele der Landesplanung zu konkretisieren und der Kommunalplanung Vorgaben zu machen. Die Regionalplanung ist also das entscheidende Bindeglied zwischen den übergeordneten Interessen der Landesentwicklung und der kommunalen Planungshoheit. In dieser Planungsebene entscheidet sich, ob örtliche und überörtliche Interessen zum Ausgleich kommen (Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg- Vorpommern, S.6f ).
Die Träger der Regionalplanung sind in den jeweiligen Bundesländern unterschiedlich organisiert. Es haben sich zwei Grundmodelle herausgebildet (Spitzer 1995, S.47):
- Das Verbandsmodell: Es wird als Träger der Regionalplanung ein eigenständiger regionaler Planungsverband ( auch Regionalverband oder regionale Planungsgemeinschaft genannt ) gebildet, der aus Vertretern von Gemeinden und Landkreisen besteht. Diese werden proportional zu den Ergebnissen der Kommunalwahl eingesetzt. Entscheidend ist, dass der Verband als Geschäftsstelle ein eigenständiges Planungsbüro mit selbstständig zu verwaltendem Etat hat. Anzumerken ist jedoch , dass auch die Regionalpläne, die im Verbandsmodell erstellt werden einer behördlichen Kontrolle unterliegen.
Das Verbandsmodell wird u.a. durch die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Baden- Württemberg vertreten.
Vorteile: Selbst ä ndigkeit, N ä he zur Kommune und gegebenenfalls hochqualifizierte und motiviertere Mitarbeiter durch h ö here Besoldung im Vergleich zu dem Beh ö rdenmodell.
- Das Behördenmodell: Bei diesem Modell ist die Regionalplanung in die
Verwaltungsstruktur der Behörden eingegliedert. Ein eigenes Planungsbüro mit selbstständig zu verwaltendem Etat gibt es bei diesem Modell nicht. Die Pläne werden meist von den Regierungspräsidien erstellt. Die Mitarbeiter sind Landesbedienstete.
Dieses Modell gilt z.B. in Schleswig- Holstein.
Vorteil: Das Zusammenspiel von Landes- und Regionalplanung verl ä uft unter Umst ä nden reibungsloser als beim Verbandsmodell und auch die Durchf ü hrung der Planung kann innerhalb der Beh ö rden effektiver sein.
Zu den wichtigsten Aufgaben der Regionalplanung gehört die Aufstellung der Regionalen Raumordnungsprogramme. Es baut auf dem Landesraumordnungsprogramm auf und wird durch die Erstellung eines Regionalplanes (auch Regionaler Raumordnungsplan genannt) konkretisiert. In diesem werden die Ziele und Vorstellungen der jeweiligen Planungsträger hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Region dargelegt und anhand von Plankarten erläutert.
Hauptinhalte sind Angaben zur Struktur von Siedlung, Wirtschaft und Freiraum sowie Infrastruktur. Hierbei sind im Wesentlichen vier Faktoren zu berücksichtigen (Regionales Raumordnungsprogramm Westmecklenburg1996, S. 11-13):
- Die überregionalen Interessen müssen berücksichtigt werden, d.h., dass die Regionalplanung folgende Vorgaben der Landesplanung einhalten muss: Die allgemeinen Ziele der Raumordnung sollen erreicht werden, die Raumstruktur soll eine Grobgliederung in Verdichtungsgebiete und ländliche Gebiete erfahren, das zentralörtliche und axiale Siedlungssystem soll gefördert werden, es soll eine Bevölkerungsprognose sowie Richtwerte für die Ausstattung der Infrastruktur erstellt werden.
- Da eine grenzüberschreitende Nutzung des Raumes gegeben sein kann, müssen auch die Regionalplanungen der Nachbarregionen berücksichtigt werden, bzw. es muss zu einer Abstimmung mit dieser Region kommen.
- Die Vorschläge für die eigene Region müssen für die Kommunalplanung konkretisiert und verbindlich gemacht werden.
- Die überregionalen Vorschläge der jeweiligen Fachplanungen müssen überprüft werden.
Bei allen hier genannten Aufgaben kommt das bereits erläuterte Gegenstromprinzip (s. S.2 u.3) zum Tragen.
Eine weitere wichtige Aufgabe der Regionalplanung besteht darin, die Vorhaben der kommunalen Bauleitplanung zu überprüfen (s. auch Schema des Zusammenwirkens der Ebenen und Instrumente der Raumordnung in Mecklenburg- Vorpommern). Hierbei führt besonders die Ausweisung von neuen Siedlungsgebieten zu Abstimmungsbedarf.
Ferner wirkt neben der Landesplanung auch die Regionalplanung bei den Raumordnungsverfahren mit (Wirtschaftsministerium des Landes MecklenburgVorpommern, S.19f).
Neben den per Gesetz festgelegten Pflichtaufgaben erfüllt die Regionalplanung in heutiger Zeit immer häufiger die Aufgabe der Wirtschaftsförderung. So wird zum Beispiel die Gewerbeansiedlung gefördert, Standortanalysen veröffentlicht und durch gezielte Werbung und Firmenberatung versucht, die Region überregional und international bekannt zu machen (Spitzer 1995,S. 49).
Regionalplanung Î Regionale Raumordnungsprogramme
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.) Ü bersicht der Regionalplanung
Quelle: Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.)/
Landesplanungsbehörde (o.J.): Raumordnung in Mecklenburg-Vorpommern Ein Beitrag zur Gestaltung unseres Landes und unserer Zukunft, Seite 19
Literaturverzeichnis/ Quellen:
- Leser, H. et.al.(1997): Dierke; Wörterbuch der Allgemeinen Geographie; Westermann Deutscher Taschenbuch Verlag, Braunschweig.
- Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.) (1999): Landesplanung in Schleswig-Holstein- Heft 26
Raumordnungsbericht - Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.) (1998): Landesraumordnungsplan Schleswig-Holstein
- Minister für Natur, Umwelt und Landesentwicklung des Landes Schleswig- Holstein (Hrsg.) (1992): Das ist Landesplanung Kiel
- Regionaler Planungsverband Westmecklenburg (Hrsg.) (1996): Regionales Raumordnungsprogramm Westmecklenburg
- Spitzer, Hartwig (1995): Einführung in die räumliche Planung Ulmer Verlag, Stuttgart
- Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.)/ Landesplanungsbehörde (o.J.): Raumordnung in Mecklenburg-Vorpommern Ein Beitrag zur Gestaltung unseres Landes und unserer Zukunft
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Raumplanung laut dem Text?
Die räumliche Planung (Raumplanung) dient dazu, die Strukturen eines Raumes zu ordnen und in ihrer Entwicklung zu fördern. Sie bildet den Ordnungsrahmen für die räumliche Ein- und Zuordnung öffentlicher Fachplanungen, kommunaler Bauleitplanung und öffentlicher und privater Investitionen.
Welche Gesetze regeln die Raumordnung in Deutschland?
Das Bundesraumordnungsgesetz (ROG) regelt gemeinsam mit dem Bundesbaugesetz die räumliche Entwicklung des gesamten Bundesgebietes. Das ROG wird durch Landesplanungsgesetze der einzelnen Bundesländer ergänzt.
Was sind die grundsätzlichen Leitvorstellungen der Raumordnung?
Zu den grundsätzlichen Leitvorstellungen der Raumordnung gehören: Schutz und Entwicklung der Lebensgrundlagen, Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilräumen (u.a. Anpassung von Sozial- und Wirtschaftsstrukturen; ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Verdichtungsräumen und ländlichen Räumen), Erhaltung und Stärkung ökologischer Funktion.
Was ist das Bundesraumordnungsprogramm (BROP)?
Das BROP stellt die Zielsetzungen der einzelnen Fachplanungen und der Landesentwicklung für das gesamte Bundesgebiet dar. Es basiert auf dem Bundesraumordnungsgesetz (ROG).
Was ist die Aufgabe der Landesplanung?
Die Landesplanung vertieft die Grundsätze und Ziele der Raumordnung im vorgegebenen Rahmen auf Landesebene und modifiziert sie auf die einzelnen Bedingungen des jeweiligen Bundeslandes. Auf dieser Basis werden Landesentwicklungspläne und -programme erarbeitet.
Welche Inhalte finden sich in Landesentwicklungsplänen und -programmen?
Inhalte sind u.a. räumliche Gliederung (Abgrenzung von Verdichtungsräumen, ländlichen Siedlungen, Förderungsgebieten; Unterscheidung in Ordnungs-, Gestaltungs- und Entwicklungsräume), regionale Siedlungsstruktur (Festlegung räumlicher Verteilungen der Siedlungen, Bestimmung Zentraler Orte), großräumige infrastrukturelle Maßnahmen und Vorsorgestandorte.
Was ist das Gegenstromprinzip in der Planung?
Das Gegenstromprinzip ist ein Mechanismus zum Interessenausgleich zwischen den einzelnen Ebenen (Gesamtplanung und Fachplanung) und innerhalb der einzelnen Ebenen (Gesamtplanung und Fachplanung, aber auch innerhalb der Fachplanungen). Es soll sicherstellen, dass unterschiedliche Planungsinteressen berücksichtigt und in Einklang gebracht werden.
Was ist die Aufgabe der Regionalplanung?
Die Regionalplanung konkretisiert die Ziele der Landesplanung und gibt der Kommunalplanung Vorgaben. Sie ist das Bindeglied zwischen den übergeordneten Interessen der Landesentwicklung und der kommunalen Planungshoheit.
Welche Organisationsmodelle gibt es für die Träger der Regionalplanung?
Es gibt zwei Grundmodelle: Das Verbandsmodell (eigenständiger regionaler Planungsverband) und das Behördenmodell (Regionalplanung in die Verwaltungsstruktur der Behörden eingegliedert).
Was sind Regionale Raumordnungsprogramme?
Regionale Raumordnungsprogramme werden durch die Erstellung eines Regionalplanes konkretisiert. In diesem werden die Ziele und Vorstellungen der jeweiligen Planungsträger hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Region dargelegt.
Was sind die Hauptinhalte regionaler Raumordnungsprogramme?
Hauptinhalte sind Angaben zur Struktur von Siedlung, Wirtschaft und Freiraum sowie Infrastruktur. Dabei müssen die überregionalen Interessen, die Regionalplanungen der Nachbarregionen, die Vorschläge für die eigene Region für die Kommunalplanung und die überregionalen Vorschläge der jeweiligen Fachplanungen berücksichtigt werden.
Was ist die Rolle der Regionalplanung bei der kommunalen Bauleitplanung?
Die Regionalplanung überprüft die Vorhaben der kommunalen Bauleitplanung, insbesondere die Ausweisung von neuen Siedlungsgebieten, um sicherzustellen, dass diese mit den übergeordneten Zielen der Raumordnung übereinstimmen.
Welche Rolle spielt die Wirtschaftsförderung in der Regionalplanung?
Neben den gesetzlich festgelegten Pflichtaufgaben erfüllt die Regionalplanung häufig die Aufgabe der Wirtschaftsförderung, z.B. durch die Förderung der Gewerbeansiedlung, die Veröffentlichung von Standortanalysen und gezielte Werbung.
- Quote paper
- Dennis Beckmann (Author), 2001, Landesplanung und Regionalplanung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107114