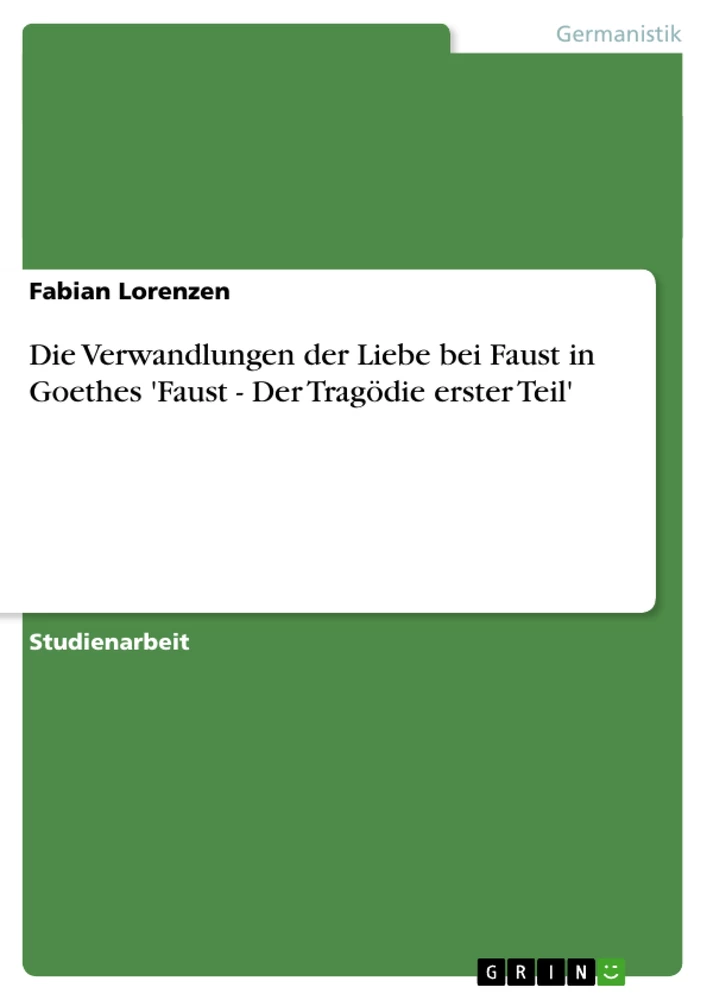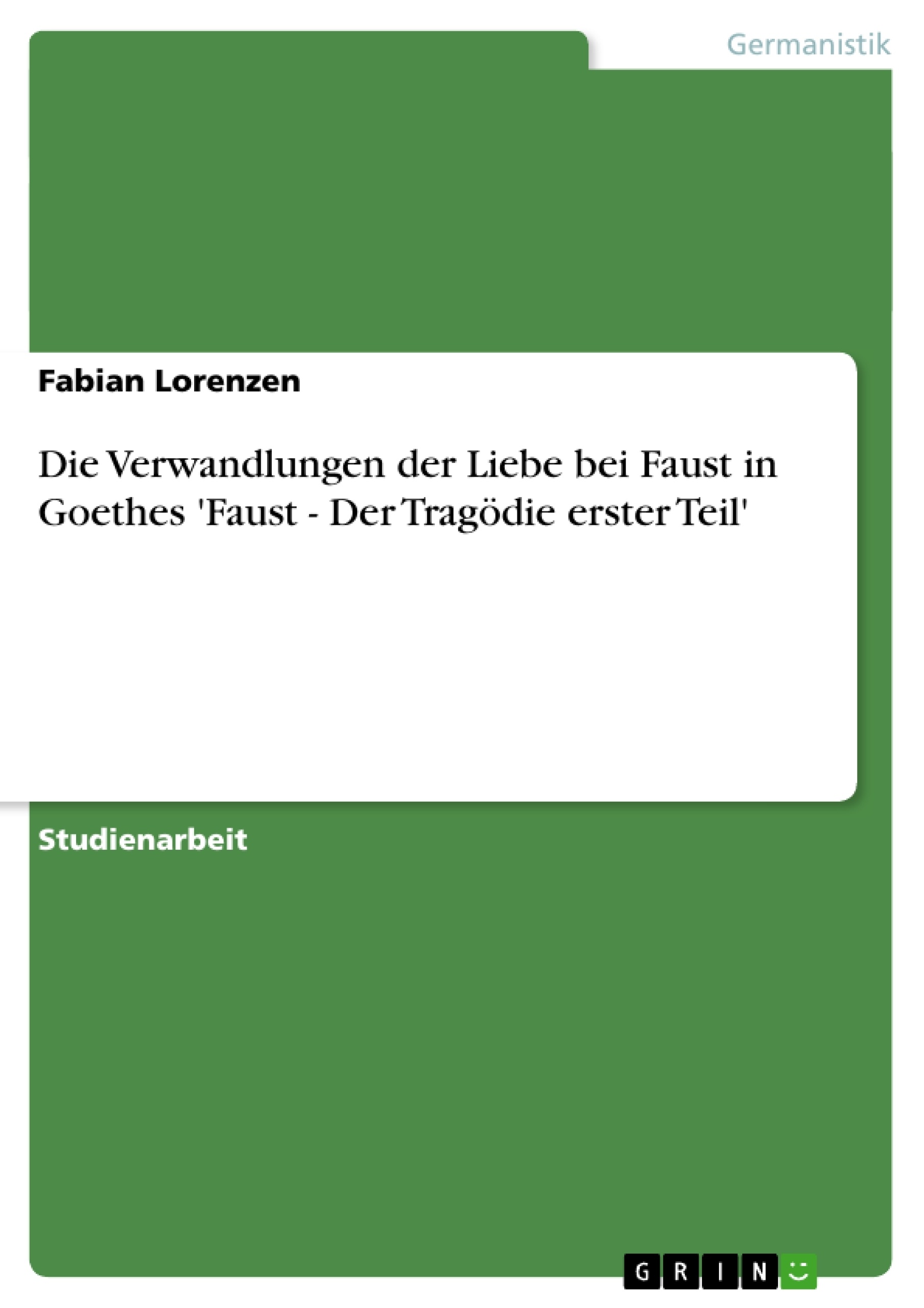Was bedeutet wahre Liebe wirklich? Tauchen Sie ein in eine fesselnde Analyse von Goethes "Faust I", die die schicksalhafte Liebesbeziehung zwischen Faust und Gretchen in den Mittelpunkt rückt. Diese tiefgründige Untersuchung enthüllt, wie Fausts Streben nach sinnlicher und transzendenter Erfahrung ihn auf einen Weg führt, der nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das unschuldige Dasein Gretchens für immer verändert. Von der ersten Begegnung, die von Verlangen und idealisierter Schönheit geprägt ist, bis hin zum tragischen Ende im Kerker, verfolgen wir die Verwandlungen der Liebe in all ihren Facetten: Begehren, Zuneigung, Schuld und Verzweiflung. Erleben Sie, wie Fausts Pakt mit Mephisto seine Wahrnehmung der Welt und der Liebe verzerrt, ihn in einen Strudel aus Leidenschaft und moralischem Verfall zieht. Entdecken Sie, wie die anfängliche Euphorie der Liebe in ein Netz aus Lügen, Betrug und tragischen Konsequenzen mündet. Wird Faust seine Schuld erkennen und Gretchen retten können, oder sind beide dazu verdammt, ihren Pakt mit dem Bösen zu erfüllen? Diese Analyse beleuchtet auf meisterhafte Weise die dunklen Seiten der menschlichen Natur, die zerstörerische Kraft der Begierde und die ewige Frage nach Erlösung. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die Abgründe der menschlichen Seele, während wir die komplexen Beziehungen zwischen Liebe, Schuld und Vergebung in einem der größten Werke der deutschen Literatur erkunden. Untersuchen Sie die Rolle Mephistos als Verführer und Manipulator und wie er die Liebesbeziehung zwischen Faust und Gretchen benutzt, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Entdecken Sie die Bedeutung der einzelnen Schauplätze, von der Hexenküche bis zum Kerker, und wie sie die innere Zerrissenheit und den moralischen Verfall der Charaktere widerspiegeln. Diese Analyse bietet neue Einblicke in die zeitlosen Themen von Goethes "Faust", wie die Suche nach Erkenntnis, die Natur des Bösen und die Möglichkeit der Erlösung. Tauchen Sie ein in die Welt von "Faust" und entdecken Sie die verborgenen Tiefen einer Geschichte, die bis heute nichts von ihrer Relevanz verloren hat. Diese Analyse ist ein Muss für alle, die sich für Literatur, Philosophie und die conditio humana interessieren. Schlüsselwörter: Goethe, Faust, Gretchen, Tragödie, Liebe, Schuld, Erlösung, Mephisto, Literaturanalyse, Interpretation, deutsche Klassik, Gretchentragödie, Verführung, Moral, Verzweiflung, Leidenschaft, Opfer, Hexenküche, Kerker, Walpurgisnacht, Erkenntnis, Interpretation, Gelehrtentragödie, Erdgeist, Sinnlichkeit, Transzendenz, Vergebung, Weiblichkeit, Schönheitsideal, Innerlichkeit, Beziehung, Drama, Seelenheil, Unschuld, Begierde, Selbstbetrug, Schicksal, Analyse, Literaturwissenschaft.
Inhalt
1. Einleitung
2. Verwandlungen der Liebe - Chronologisch geordnete Analyse
2.1. Faust vor dem Eintritt in die Welt - Hexenküche
2.2. Faust trifft auf Gretchen - Straße
2.3. Faust in Gretchens Zimmer - Abend
2.4. Faust vor der Begegnung mit Gretchen - Straße II
2.5. Das erste ausführliche Treffen zwischen Faust und Gretchen - Garten
2.6. Der vergängliche Moment tiefster Liebe - Gartenhäuschen
2.7. Die Eintrübung - Faust zwischen Sehnsucht, Schuldgefühl und Distanzierung (Wald und Höhle)
2.8. Das Vorspiel zu Fausts Fall und der Zusammenbruch - Marthens Garten und die nachfolgenden Szenen bis „Dom“
2.9. Distanz, Ausbreitung und Rückführung Fausts - Walpurgisnacht
2.10. Fausts Entrüstung ohne seine Schuld einzugestehen - Trüber Tag. Feld
2.11. Die scheiternde und gelingende Errettung Gretchens - Kerker
3. Nachbetrachtung und Zusammenfassung
4. Literatur
1. Einleitung
Die Erfahrung der Liebe ist eine der Qualitäten des Lebens, deren Erfahrung der weltfremde Akademiker Faust im Rahmen seines Bundes mit Mephistopheles machen soll. In ihrer Stofflichkeit und auf das Körperliche beschränkt, ist sie ist eine der Facetten der Existenzen menschlichen Seins, über welche Mephisto Faust zu verführen sucht. In ihrer idealisierten Form allerdings, welche Faust zunächst erfährt und deren flüchtigen Eindruck er auch später noch immer zu beschwören sucht, beinhaltet sie eine der wenigen Möglichkeiten des Menschen zu einer Erfahrung der Transzendenz und Erhöhung über seine naturgegebenen Grenzen. Doch das erstrebte Ideal ist nicht beständig, letztlich wird die eingrenzende Natur des Körperlichen das Liebesideal immer wieder verstofflichen, so wie auch die transzendierende Liebe Fausts zwangsläufig sich immer wieder zu Körperlichem, und damit hin zum Verlangen und der Begierde wandelt.
Die vorliegende Hausarbeit behandelt exemplarisch die unterschiedlichen Erfahrungen der Liebe, die Faust macht und der Wandlung ihrer Qualitäten innerhalb der verschiedenen Situationen, in welchen sich Faust befindet und wie diese sowie seine Reaktionen und Taten ihn einerseits der innersten Natur des Menschen näher bringen, ihn andererseits aber unweigerlich schuldig werden lassen. Dies geschieht in erster Linie anhand der Betrachtung seiner wechselnden Relationen zu Gretchen, aber auch anhand von Fausts Apostrophierungen und seine Eindrücke bezüglich der Natur der „wahren Liebe“. Es soll dabei chronologisch vorgegangen werden ausgehend von dem Punkt, an welchem Faust überhaupt zum ersten Mal mit der Thematik konfrontiert wird, die als ein Baustein bei der späteren Entwicklung der Handlung hin zur Gretchentragödie fungiert: die erste Begegnung Fausts mit der abstrakten Größte der weiblichen Schönheit. Davon ausgehend soll untersucht werden, wie sich diese abstrakte, ideale Gesinnung Fausts begründet aus der Vision der absoluten weiblichen Schönheit gegenüber des ihr immer widerstreitenden und zugleich omnipräsenten Sinnlichkeitsgedanken verhält, welcher auf das ureigenste Gebiet Mephistos führt. Weiterhin soll der Widerstreit dieser beiden Kräfte in Fausts Denken und Handeln gezeigt werden, die ihn von nun an beherrschen und derentwillen er Mensch wird, aber auch schuldig.
2. Verwandlungen der Liebe - Chronologisch geordnete Analyse
2.1. Faust vor dem Eintritt in die Welt - Hexenküche
Die Szene der Hexenküche stellt einen der zentralen Angelpunkte innerhalb des Faust-Dramas dar. An dieser Stelle Grundstein gelegt für die Verknüpfung der Gelehrtentragödie mit der Gretchenhandlung. Hier wird Faust den Verjüngungstrank zu sich nehmen, um in das physische Leben einzutauchen, dem der Geistesmensch Faust bisher uninteressiert, ja verständnislos gegenüber gestanden hatte. Und hier wird er beim Blick in den Zauberspiegel die schicksalsschwere Vision haben, die für seine späteren Intentionen und Handlungen von großer Bedeutung sein werden.
Der ursprüngliche Grund, warum Faust und Mephisto die Hexenküche aufsuchen erscheint banal: der Hokuspokus der ansässigen Hexe wird benötigt, um Faust einer körperlichen und wohl auch geistigen Verjüngung zu unterziehen. Insbesondere die geistige Verjüngung ist so zu verstehen, dass dies ein weiterer gewichtiger Schritt zur Hinführung Fausts an das menschliche Leben, dadurch aber auch an menschliche Verfehlungen ist, womit Mephisto kurz zuvor in „Auerbachs Keller“ gescheitert ist. Es kann bei der Hexenküchen-Szene also konstatiert werden,
„ ..., daßin ihr die Menschwerdungs F.s beginnt, der bis dahin als reines Geistwesen nur ein homunculus war, der von Schönheit, Liebe und praktisch gestaltender Tätigkeit nichts wußte und selbst zur Natur nur ein abstraktes Verhältnis hatte. “ 1
(Abkürzung im Originaltext: F. = Faust)
Ähnlich wie auch in Auerbachs Keller ist Faust abgestoßen von dem anzüglichen und niveaulosen Treiben Mephistos und sucht sich, während dieser mit den Meerkatzen der Hexe seine Späße macht ein anderes Objekt des Interesses, den Zauberspiegel. Nun jedoch geschieht etwas Eigenartiges, denn Faust erscheint darin einen Frauenkörper, der sein Ästhetikempfinden ebenso berührt wie er ihn emotional tangiert. Dies ist bemerkenswert insbesondere angesichts der Tatsache, dass Faust den verjüngend, aber wie aus einer späteren Äußerung Mephistos2 hervorgeht unzweifelhaft auch erotisierend und stimulierend wirkenden Trank noch überhaupt nicht eingenommen hat. In der Tat ist es
„ das Rätsel, daßdiese Faszination durch den im Spiegel erscheinenden Frauenkörper ihn nicht erst ergreift, nachdem er den Trank zu sich genommen hat, sondern schon vorher. “ 3
Trotzdem geschieht es, und es ist leicht zu erkennen, dass Faust von dieser Erscheinung in höchstem Maße angezogen wird, er ihr zustrebt und mehr erfassen möchte, jedoch wieder zurückprallt, da bei einem Näherkommen das Bild verwischt und undeutlich wird:
Ach wenn ich nicht auf dieser Stelle bleibe,
Wenn ich es wage nah zu gehen,
Kann ich sie nur als wie im Nebel sehen! -
Das schönste Bild von einem Weibe! 4
Die Vision im Zauberspiegel bleibt für Faust zwar nur schemenhaft und er kann das Gesehene nicht exakt eingrenzen, jedoch ist seine Reaktion darauf gleichermaßen heftig wie sie es schon in der Szene Nacht gewesen war, als sich ihm der Erdgeist offenbarte. Dessen „überwältigende Erscheinung“5 hatte zunächst eine vergleichbare Wirkung bei Faust, eben das Gefühl, dass ihm nun etwas offenbart werde. Dies war bei der Erdgeisterscheinung der Wunsch, „die nahe Naturwirklichkeit und Menschenwelt überfliegend, das Ganze erfühlend [zu] erkennen und sich ihm hin[zu]geben“6, welcher jedoch nicht eintrat. Im Fall der Vision des Frauenkörpers im Zauberspiegel ist es eine Offenbarung ästhetischer Natur, die ihm widerfährt und sein Augenmerk auf Schönheitsideale und Vollkommenheitsempfinden in der von ihm bisher ignorierten realen, greifbaren Welt richtet. Diese Welt in ihrer Enge und mit ihren naturgegebenen Grenzen hatte Faust bisher der Erkundung noch nicht wert befunden, eben da sein in entgrenzten Dimensionen denkender Geist sich von dieser der Enge unterworfenen Welt keine wirklich transzendenten Erkenntnisse versprochen hatte. Mit dem Wahrnehmen grundlegender weiblicher Ästhetik durch den Zauberspiegel macht Faust allerdings nun den wohl wichtigsten Schritt auf diese Welt zu.
Der Umstand, dass Faust beginnt, solch reges Interesse an „irdischer Vollkommenheit und Schönheit“7 an den Tag zu legen, kann Mephisto nur entgegenkommen, bewegt sich damit Faust doch damit auch unweigerlich auf das ureigenste Gebiet Mephistos zu, nämlich der Sinnlichkeit. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass er den idealisierenden und bislang doch sehr abstrakt gehaltenen Begeisterungsausbruch Fausts sofort auf etwas Konkretes und Nennbares reduzieren möchte. Aus der unbestimmten Vision soll etwas werden, das greifbar, fassbar ist und den Wunsch oder sogar das Verlangen wecken soll, sich die gesehene Schönheit zu eigen zu machen und zu „Besitzen“:
„ Für diesmal sieh dich immer satt;
Ich weißdir so ein Schätzchen aufzuspüren,
Und selig wer das gute Schicksal hat,
Als Bräutigam sie heimzuführen! “ 8
Noch berührt Faust diese plumpe Reduzierung seines Erlebnisses auf das unmittelbar Sinnliche nicht, zu sehr ist er von der neuen Erfahrung, der Wahrnehmung körperlich bedingter Schönheit eingenommen, da dies das erste Mal ist, dass diese als solch gewichtige Größe in sein Bewusstsein dringt. Es wird ihm „das bloße Spiegelbild eines nackten Frauenkörpers Inbegriff der Seligkeit“9 und damit der Aspekt des Schönheitsempfindens zum ersten Mal vor Augen geführt.
Bei reiner Kontemplation, die notgedrungen passiv bleiben muss kann Faust allerdings nicht verweilen, die „Umwälzung“,10 die sich in ihm vollzieht drückt sich dabei aus in dem Ausruf „Weh mir! Ich werde schier verrückt.“11 Er gewahrt der Veränderung seines Empfindens und möchte sich dem wie es scheint entziehen:
„ Mein Busen fängt mir an zu brennen!
Entfernen wir uns nur geschwind! “ 12
Allerdings leistet er seiner eigenen Aufforderung zum Aufbruch ebenso wenig Folge wie sich Mephisto um seine aufgewühlten Ausrufe kümmert. Dieser „weiß F. entflammt und kümmert sich nicht weiter um ihn“.13 Außerdem ist Mephisto davon überzeugt, dass Faust, sobald er den Verjüngungstrank zu sich genommen hat, unzweifelhaft in die wirkliche Welt eintreten und damit dem Sinnlichen verfallen wird.
Damit ist er sicherlich im Recht wenngleich Faust nach der Einnahme des Trankes und der erfolgten Verjüngung noch immer großes Interesse an der Frauenvision im Spiegel zeigt und nicht unmittelbar sinnlichem Verlangen verfallen ist:
„ Lass mich nur schnell noch in den Spiegel schauen!
Das Frauenbild war gar zu schön! “ 14
Mephisto tut diesen Wunsch Fausts aber als belanglos und unnötig ab und drängt zum Aufbruch. Das zuvor erblicke Ideal soll Faust nun, da er den Trank zu sich genommen hat nicht länger von der endgültigen Öffnung zur Welt hin fernhalten. Vielmehr soll nun nach Mephistos Ermessen „die Wirklichkeit an seine Stelle treten“.15 Hierbei ist auch zu beachten, wie Mephisto den von seinem Schönheitserlebnis in der Hexenküche immer noch tief bewegten Faust zufrieden zu stellen gedenkt. Sein nur leise gemurmelter Ausspruch macht es klar:
„ Du siehst mit diesem Trank im Leibe,
Bald Helenen in jedem Weibe. “ 16
Damit wird klar, dass Faust das „Idealbild“17 der Weiblichkeit, welches ihm im Zauberspiegel erschien auch in dem „Schätzchen“ sehen wird, welches „aufzuspüren“ sich Mephisto bereits in V. 2444 ff angeboten hat, also Faust aufgrund der Wirkung des Trankes „in der erstbesten Frau den Inbegriff weiblicher Schönheit erblicken und begehren wird, denn mit Begierde ist er infiziert“.18
2.2. Faust trifft auf Gretchen - Straße
Auf seinem Weg als rein abstrakt denkendes und von der Welt entfremdetes Wesen in selbige hinein markiert die erste kurze Begegnung Fausts mit Gretchen einen weiteren wichtigen Abschnitt in Fausts Entwicklung. In dem Augenblick, in welchem er Gretchen erstmals gewahrt, erkennt er in ihr zum einen etwas von dem im Zauberspiegel erblickten Schönheitsideal, zum anderen wird er aber auch von dem unzweifelhaft sinnlichen Verlangen getrieben, welches bereits in der Hexenküche teils unterschwellig, spätestens jedoch mit der Einnahme des Trankes offen zum Vorschein kam. Es kann damit konstatiert werden, dass in der Szene „Straße“
„ die beiden getrennten und voneinander so verschiedenen Einwirkungen auf F. in der HK, die geistig-seelische im Schönheitserlebnis und die physische im aphrodisischen Verjüngungstrank deutlich nebeneinander in Erscheinung treten in der Betroffenheit von der Leibes- und Seelenschönheit einerseits und dem reinen Geschlechtstrieb andererseits, der gleich in seinen ersten Worten und Taten hervorbricht. “ 19
(Abkürzungen im Originaltext: HK = Hexenküche)
Eben diese Taten und die Worte, die Faust dazu wählt, sind angesichts geltender gesellschaftlicher Konventionen, aber auch vom Standpunkt der Höflichkeit aus betrachtet vollkommen unangebracht und kompromittieren Gretchen eher, als dass sie erhoffte gewinnende Wirkung haben:
„ Mein schönes Fräulein, darf ich wagen,
Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen? “ 20
Wenn Faust das ahnungslos passierende Gretchen „überfallartig“21 mit einem solchen Anliegen belangt, welches in seiner Direktheit geradezu peinlich anmutet und sich dann ohne die Reaktion überhaupt abzuwarten gleich bei ihr einhakt, verlangt es alleine schon ihre gute Erziehung von Gretchen, auf Distanz zu gehen.
Genau dies ist auch der Fall, wie die Szenenanweisung „ (Sie macht sich los und ab) “22 belegt. Fausts erster, noch recht unbeholfener und plumper Versuch eine Atmosphäre zwischenmenschlicher Nähe aufzubauen ist damit zunächst einmal abrupt beendet. Sein ungelenker Annäherungsversuch ebenso wie sein unschlüssiges Stehenbleiben nach der erteilten Abfuhr ist ein unverkennbares Indiz, dass Faust sich noch nicht so recht im Klaren darüber ist, was denn nun die richtige Vorgehensweise ist, denn „ weder Verjüngung noch hormonales Stimulans können ihm geben, was er nie besessen hat: Erfahrung. “ 23
Statt ihr also zu folgen bleibt er einfach zurück, nimmt die knappen und kurzen Eindrücke zusammen, die er von Gretchen gewinnen konnte und verknüpft sie zu einer teils verblüfften, teils heiteren Laudatio. In dieser ereifert er sowohl über die Schönheit des Mädchens als auch über dessen Charakterstärke und Geistesgegenwart.24 Zwar kann davon ausgegangen werden, dass die von Faust so überschwänglich apostrophierten Attribute Gretchens nicht notwendigerweise „ außergewöhnliche Eigenschaften, sondern solche, die Gr. zweifellos mit vielen Mädchen ihres Alters teilt “ 25
(Abkürzung im Originaltext: Gr. = Gretchen)
sind oder sein können. Jedoch ist es auch hier wieder die absolute Neuheit der Erfahrung, die Faust zu diesem euphorischen und natürlich sehr subjektiven Schluss kommen lassen. In jedem Fall aber hat Faust, indem er sich dieser Erfahrung und seinen aus der Begegnung resultierenden Emotionen hingibt nun den Eintritt in die physische Realität vollendet Er ist nun vollends der schützenden Hülle entschlüpft, die ihn als „Geistwesen“26 der Physis gegenüber abgegrenzt hatte.
Mit dem Erscheinen Mephistos erlangt in Faust mit einem Mal der sinnlich fordernde Charakterzug der Begierde auf geradezu dramatische Art und Weise die Oberhand. Noch nie im bisherigen Verlauf seiner Menschwerdung waren seine Intention so direkt, so unumwunden sexueller Natur als wenn er Mephisto gegenüber postuliert: „Hör, du musst mir die Dirne schaffen!“27 Dieser ist verständlicherweise hocherfreut über die rohe sexuelle Begierde, die Faust nun zeigt und ihn damit in Mephistos ureigenstes Gebiet führt. Dieser gedenkt, seine Arbeit gut zu machen und hat nicht von ungefähr das moralisch und gesellschaftlich integre Gretchen gewählt,
„ denn eine völlig Unschuldige will er F. zuführen, s i e soll das Opfer sein. Um so größer wird F.s Schuld und M.s Triumph sein. “ 28
(Abkürzung im Originaltext: M. = Mephisto)
Faust soll als der Verführer französischer Manier29 auftreten. Es kommt Mephistos Interessen entgegen und es sollte, wie er Faust in V. 2648 ff klarmacht auch nicht in dessen Interesse liegen, „nur gerade zu genießen“.30 Faust lässt sich schließlich von Mephisto davon überzeugen, sich noch ein wenig zu gedulden, bedingt sich aber einen intimen Gegenstand aus Gretchens Besitz gewissermaßen als „Vorgeschmack“31 aus. Daraufhin „rückt M. mit schon geplanter kleiner Gewährung heraus“,32 eben das Zugeständnis, dass Faust sich schon einmal im Zimmer der Angebeteten umsehen kann. Dies soll dem Verlangen Fausts weiteren Vorschub leisten und ihn in seiner Begierde nochmals anstacheln. Dieser zeigt weiterhin große Ungeduld (Vgl. V. 2667 „Und soll sie sehen? Sie haben?“ und V. 2672 „Können wir hin?“), akzeptiert dann aber doch die Wartezeit, die er noch hinter sich zu bringen hat. Er heißt Mephisto noch ein Geschenk für Gretchen zu beschaffen und geht dann ohne weiteren Kommentar ab.
2.3. Faust in Gretchens Zimmer - Abend
Kurz bevor Faust und Mephisto erscheinen, befindet sich Gretchen noch in ihrem Zimmer. Sie macht sich bereit zum Aufbruch und es wird dabei offensichtlich, dass auch an ihr die seltsame Begegnung mit Faust nicht spurlos verübergegangen ist, ja sie vielmehr nachhaltig von seinem - wenn auch ungehörig dreisten33 - Auftreten beeindruckt worden ist. Damit ist ihre Reaktion „weit entfernt von Entrüstung“34, sondern „vielmehr geschmeichelt und interessiert“.35 Ihre innere Ruhe hat also schon jetzt eine empfindliche Störung erlitten.
Sie verlässt den Raum, wenig später erscheinen Faust und Mephisto. Dabei vollzieht sich mit dem Betreten des Zimmers einhergehend eine bemerkenswerte Wandlung in dem eben noch von sinnlicher Begierde erfüllten, wenn nicht sogar durch unverhohlen Lüsternheit getriebenen Faust. Das eben noch klar dominante und fordernde sinnliche Eros in seinem Wesen tritt deutlich zurück gegenüber dem philosophischen Eros. Das zeigt sich auch anhand der Tatsache, dass er bereits nach kurzem Innehalten Mephisto als den Herr über alles Sinnliche nicht mehr neben sich haben möchte, so lange er sich im intimsten Bereich von Gretchens Häuslichkeit befindet. Er befielt ihm zu gehen, da er ohne jedwede Ablenkung „die Ausstrahlung dieses Raumes“36 auf sich wirken lassen möchte.
Aufgrund der Tatsache, dass der Raum leer, die Bewohnerin nicht zu Hause ist, sieht sich Faust lediglich der Atmosphäre, die sie zurückließ und den Gegenständen, die als ihr Hab und Gut auf sie schließen lassen gegenüber. Gretchen selbst ist an dieser Stelle nicht fassbar, nicht physisch vorhanden, aber Faust gibt das die Gelegenheit, ihr alle positiven Eigenschaften in seiner Imagination anzutragen, die er aus dem kleinen schlichten Gemach herauszulesen glaubt. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass diese Welt des kleinen reinlichen Zimmers, der Enge, sozusagen eine genaue Gegenströmung zu der umfassenden, entgrenzen Ausbreitungsströmung darstellt, mit der Faust sich bislang über die Weltzusammenhänge klar werden wollte.37 Alles was er bisher als nur in der Entgrenzung erreichbar vermutet hatte, glaubt er jetzt in der Beschränkung zu finden, für die Gretchens Kämmerchen steht. Diese beiden eigentlich gegenläufigen Strömungen kommen auch zum Ausdruck, wenn Faust beschreibt:
„ In dieser Armut, welche Fülle!
In diesem Kerker, welche Seligkeit!
[...]
O liebe Hand! so göttergleich!
Die Hütte wird durch dich ein Himmelreich. “ 38
Diese eigentlich antithetisch gegeneinander gerichteten Begriffe in den jeweiligen Versen sieht Faust in Gretchens Zimmer in harmonische Verbindung gebracht: „Alles ist für Faust im Gleichgewicht.“39
Dabei verkennt er freilich die Beschaffenheit der der Enge innewohnenden Beschränktheit völlig. Er erhöht sie in einer Art und Weise, wie nur er als eigentlich Außenstehender es tun kann, der mit den tatsächlichen Lebensumständen der kleinbürgerlichen Existenz nie in Berührung gekommen ist. Natürlich stellt sich für Gretchen das einfache Leben nicht in der vortrefflichen Form dar, als wie er es idealisiert. Aber ihm erscheint die spärliche Möblierung, der schlichte Lebensraum als wundervoll, seine „sehnsuchtsvolle Bewunderung dieser Kleinstwelt ist nicht geringer als zuvor sein Drang, im Kosmos aufzugehen“.40
Als sein Blick schließlich an Gretchens Bettstatt haften bleibt, blitzt wieder die Erinnerung an die Intentionen auf, die ihn hergeführt haben. Seine Empfindungen fasst er mittels des Oxymorons „Wonnegraus“41 zusammen, denn „Darin verbindet sich die Ahnung sinnlichen Genusses mit dem Gefühl der Entweihung eines Heiligen.“42 Entsprechend orientierungslos stellt sich nun auch seine Gefühlslage dar:
„ Und du! Was hat dich hergeführt?
Wie innig fühl ’ ich mich gerührt!
Was willst du hier, Was wird das Herz dir schwer?
Armsel ’ ger Faust! ich kenne dich nicht mehr. “ 43
Der Grund seines Hierseins ist ihm wohl bekannt, aber er weiß nun nicht mehr, wie er damit umgehen oder ihn gar rechtfertigen soll. Der Eindruck, den die Atmosphäre des Zimmers auf ihn gemacht hat lässt ihn deutlich fühlen, dass er mit seinem ungestümen Eindringen und
„ seiner ungeduldigen Gier einen Frevel beging, als er hier eintrat, und daßer vor dem „ Geschöpfchen “ , dessen er sich bemächtigen wollte, träte es jetzt ein zuschanden werden m üß te. Der „ große Hans “ würde zerknirscht ihr zu F üß en stürzen, um Vergebung stammelnd für das, was er aus Liebe tat. “ 44
Von Fausts fordernder, einnehmender und verlangender Art ist in diesem Moment wenig übrig geblieben, vielmehr scheint es so, als schäme er sich ihrer. Er erwägt bereits, von seinem Vorhaben abzulassen, als Mephisto mit dem für Gretchen bestimmten Schmuckkästchen zurückkehrt und von ihrer kurz bevorstehenden Rückkehr berichtet. Faust ist über die Maßen unsicher. In dem impulsiven Ausruf „Fort! Fort! Ich kehre nimmermehr!“45 ist das ebenso zu spüren wie bei seinem Zögern („Ich weiß nicht, soll ich?“46 ), als ihn Mephisto dazu auffordert, das Schmuckkästchen im Raum zu platzieren. In Anbetracht der gebotenen Eile fehlt dem zaudernden Faust die notwendige Zeit, seine weitere Vorgehensweise zu überdenken, was Mephisto nur recht sein kann. Er drängt drauf zu gehen und verlässt schließlich mit Faust das Zimmer, nicht ohne das Kästchen vorher noch an geeigneter Stelle (in einer Truhe) zurückzulassen.
Kurz darauf kehrt Gretchen zurück. Sie gewahrt sofort die eigentümliche und ungewohnte Atmosphäre, dieser „Mischung von Anbetung und Begehren“47, die nach dem Aufenthalt Fausts in ihrem intimsten Wohnbereich immer noch im Raume steht („Es ist so schwül, so dumpfig hie“48 ). Da es jedoch keine äußeren Anzeichen gibt, die darauf schließen lassen, dass etwas Ungewöhnliches vorgefallen ist verdrängt sie zunächst den Gedanken daran und beginnt sich auszukleiden. Erst, als sie auf die Schmuckschatulle stößt, kehrt das Gefühl der Unsicherheit und mit ihr das Gefühl des Unbehaustseins umso stärker zurück. Der Schmuck, an diesem Ort ganz offensichtlich fehl am Platze weckt Fantasien und Sehnsüchte. Es ist der Beginn eines Prozesses, der nun auch Gretchen langsam aus ihrer gewohnten und umsorgten Welt heben wird. In ihrem Fall ist dies das Entgleiten aus der wohlbehüteten und integren Welt der Kleinfamilie, es entwickelt sich im Angesicht des Schmuckes eine „Sehnsucht nach Ausbreitung, nach Teilhabe an der Welt“.49 Genau wie bei Faust wird diese Öffnung zur Welt hin die Voraussetzung sein, die menschliche Natur in ihrer Ganzheit zu erleben und als Konsequenz der davon der Unschuld verlustig zu gehen.
2.4. Faust vor der Begegnung mit Gretchen - Straße II
In den vorangegangenen Szenen ist es vor allem Mephisto, der agiert um nach dem Besuch in Gretchens Zimmer nun eine Gelegenheit zu schaffen, bei der sich Faust endlich dem realen Gretchen nähern kann. Dies soll nun auch der Fall sein, denn mit der Hilfe der Nachbarin hat Mephisto eine solche Möglichkeit arrangiert.
Dies teilt er dem weiter ungeduldigen Faust in der Szene „Straße II“ mit. Faust ist damit einverstanden, wenngleich er sich etwas über die Tatsache echauffiert, dass er, um Gretchen sehen zu können, gegenüber der Nachbarin bezüglich ihres verschwundenen Mannes ein falsches Sterbezeugnis ablegen soll50. Mephisto verspottet ihn daraufhin ob seiner scheinbar hochstehenden Moral, genau wissend, dass eben diese Moral angesichts dessen, was er mit Gretchen vorhabe ohnehin nicht haltbar sei. Denn im Gegensatz zu Faust weiß er über wahre Natur zwischenmenschlicher Gefühle, dass diese immer endlich sind und das Individuum, von ihnen berauscht und betört lediglich in selbsttäuscherischer Form ihre vermeintliche Ewigkeit beschwört. Mephisto nimmt also an dieser Stelle schon die unweigerliche Entwicklung vorweg, und er führt Faust „sein unentrinnbares Verhaltensmuster vor Augen, ohne Furcht, er könnte sich befreien.“51 Denn Faust ist weder in der Lage noch willens, diesen vorgezeichneten Weg in die Schuld, die Mephisto ihm aufzeigt zu erkennen, sondern er „ wehrt sogleich ab, weil die nicht eingestandene Einsicht, die M. in ihm erweckt hat, die Unbedingtheit seines Fühlens und Wollens (und damit seine subjektive Unschuld) stört. “ 52
Faust sieht seine Gefühle als nicht zeitgebunden an, also als etwas absolutes, er nennt die „Glut, von der ich brenne“53 „Unendlich, ewig“54 und zweifellos genau dieser Überzeugung ist er wohl auch. Allein in diesen Worten äußert sich exakt seine Selbsttäuschung, denn der „ dominierende, alles andere zeitweilig verdrängende Trieb ist echt, aber die Ewigkeit der Gefühle ist Trug und Selbstbetrug, jahrtausendealte Erfahrung beweist es. “ 55
Faust sollte es besser wissen, aber er möchte sich die Wahrheit nicht eingestehen, er kann dies gar nicht tun, wenn er sein Ziel erreichen will. Und genau danach steht ihm auch weiterhin unübersehbar der Sinn.
2.5. Das erste ausführliche Treffen zwischen Faust und Gretchen - Garten
Die erste Gartenszene zeigt „wie mit einem Zeitraffer die ganze Entwicklung vom Kennenlernen bis zum Liebesgeständnis und dem ersten Kuß“.56 Gleich zu Beginn wird deutlich, wie Gretchen Faust und ihre eigene Position ihm gegenüber einschätzt:
„ Ich fühl es wohl, dass mich der Herr nur schont,
Herab sich lässt, mich zu beschämen.
Ein Reisender ist so gewohnt
Aus Gütigkeit fürlieb zu nehmen;
Ich weißzu gut, dass solch erfahrnen Mann
Mein arm Gespräch nicht unterhalten kann. “ 57
Diese Aussage gibt zum einen wieder, dass Gretchen sich nur allzu bewusst darüber ist, wie groß der Unterschied zwischen ihr, dem Bürgermädchen und dem weltmännischen Faust ist, dass sie wohl schwerlich seinen Ansprüchen genügen könnte, geschweige denn seinem Niveau entsprechen. Auch die Tatsache, dass er als ein Reisender erscheint beunruhigt sie zutiefst, beinhaltet doch die Natur des Reisens die lokative Unstetigkeit - was könnte jemanden wie Faust dazu zu bringen, sich auf Dauer an sie zu binden? Denn genau darin liegt definitiv ihr Interesse, nämlich „dass sie weder an eine momentane Bekanntschaft noch an ein Abenteuer denkt, sondern von einem Immer träumt“.58 Indes ist sie natürlich nur zu gerne gewillt, ihre Zweifel und Befürchtungen durch den wortgewandten Faust zerstreuen zu lassen, sie will glauben, dass es der Wahrheit entspricht, wenn Faust schließlich sagt, was dem flüchtigen Augenblicke gerecht werden mag, niemals aber der benannten Ewigkeit:
„ Sich hinzugeben ganz und eine Wonne
Zu fühlen, die ewig sein muss!
Ewig! - Ihr Ende würde Verzweiflung sein.
Nein, kein Ende! Kein Ende! “ 59
Dabei ist abzusehen, dass es so nicht kommen kann, zu unterschiedlich und unvereinbar sind die Charaktere des im bürgerlichen Leben verwurzelten Gretchens und des entgrenzten, unsteten Fausts. Der überschwänglichen Liebe, die Gretchen durch das Blumenorakel zum ersten Mal beim Namen nennt und gesteht wird sie am Ende genauso zerstört zurücklassen, wie es die zerpflückte Blume am Ende ist. Jedoch, der Ausspruch ist getan, die Erwiderung Fausts erfolgt, obgleich auch er, wie zuvor Gretchen die Offenbarung des Empfundenen nicht direkt an sie wendet, sondern sich ebenfalls des Blumenmotivs bedient, indem er direkten Bezug darauf nimmt.60 Damit ist der letzte Schritt getan, Gretchen erschauert unter dem Eindruck seiner Berührung, doch kann sie sich ihm nun nicht mehr entziehen, sie ist das „Wagnis und Glück der äußersten Selbstpreisgabe“61 eingegangen.
2.6. Der vergängliche Moment tiefster Liebe - Gartenhäuschen
Obwohl nicht klar festzumachen ist, ob diese Szene sich direkt an die Szene „Garten“ anschließt oder nicht, so gibt es doch einige Indizien, die darauf hinweisen, dass dies nicht der Fall ist. In erster Linie anzuführen ist die Tatsache, „ daßF. und Margarete in dieser Szene in einer ganz anderen seelischen Verfassung sind: sie treibt hier ein neckisches Spiel [...] und er ist ganz darauf eingestellt. Sie duzt ihn jetzt, und die Küsse, die sie tauschen sind nicht die ersten. “ 62
Es spricht also einiges dafür, dass sie sich an dieser Stelle schon sehr viel vertrauter sind als noch während der Szene „Garten“. Weder Faust noch Gretchen zeigen hier mehr eine Spur von Zögern oder Unsicherheit ob der Gewissheit ihrer Liebesbeziehung. Tatsächlich sind die „wenigen Worte und Küsse, die hier gewechselt werden [...] die einzige reine und unbeschwerte Liebesszene des ganzen Dramas.“63 Die Dauer dieses Glücksmomentes ist denkbar kurz, denn bereits nach wenigen Augenblickes tritt Mephisto wieder auf und zerstört ihn durch seine Gegenwart.
2.7. Die Eintrübung - Faust zwischen Sehnsucht, Schuldgefühl und Distanzierung
Die Szene „Wald und Höhle“ ist nach den beiden vorhergegangenen die dritte, in welcher Faust sich der abrupten Beendigung eines als angenehm empfundenen Zustandes durch das Auftauchen von Mephisto gegenübersieht. Beinhaltete sein Erscheinen in „Garten“ und „Ein Gartenhäuschen“ insbesondere die Beendigung von Fausts Zweisamkeit mit Gretchen, ist es hier das Naturerlebnis, das mit Mephistos Auftreten zerstört wird. Denn zuvor hatte sich Faust während einer nicht messbaren Zeitspanne selbiger geöffnet (er personifiziert sie durch den Erdgeist) und schließlich auch über das Geschehene und Gesehene reflektiert. Das Erscheinen Mephistos beendet einmal mehr die geistige Ausbreitungsphase Fausts, somit ist seine Verärgerung darüber verständlich.
Der Dialog beginnt mit recht geringschätzigen Ausführungen Mephistos über Fausts langes Verweilen in der Wildnis, welcher er im Gegensatz zu Faust nichts besonderes abgewinnen kann. Das hohe Ideal der geistigen Verzückung ist und bleibt ihm fremd, ob nun ausgehend vom Standpunkt der Ästhetik oder dem „übermenschlicher Naturhingabe“.64 Er reduziert dies immer auf das rein Stoffliche, wirft auch Faust zum wiederholten Male den eigenen Selbstbetrug vor: „am Ende steht doch der Beischlaf und sonst nichts.“65
Faust verwahrt sich zwar energisch gegen diese Entweihung seiner hochstehenden Ideale, doch er stellt Mephisto keine argumentativ begründete Verteidigung entgegen, genau genommen kann er dies auch gar nicht tun, denn trotz aller Transzendenzbemühungen ist und bleibt der Mensch seiner ihm eigenen Natur treu, die aus dem Körperlichen erwächst.
Dies ist eine gute Überleitung, um das Gespräch auf Gretchen zu bringen. Mit seinem Bericht darüber, dass diese völlig von Sehnsucht eingenommen und über die Trennung verzweifelt ist und der sich anschließenden Mahnung, Faust solle „Das arme affenjunge Blut/ Für seine Liebe [...] belohnen“66 bezweckt er zweierlei. Zum einem ist es ein scheinheiliger Appell an Fausts Verantwortung, die er gegenüber Gretchen zu tragen hat, nachdem er die Beziehung nun eingegangen ist. Zum anderen steckt darin auch die unverhohlene Aufforderung, das Ganze endlich zu dem von Anfang an geplanten Ende zu bringen. Zunächst scheint sich Faust noch gegen diese vorherbestimmte Entwicklung zu wehren, aber es ist offensichtlich, dass nun auch die Begierde wieder von ihm Besitz ergriffen hat. Wenn er Mephisto auffordert, den Namen Gretchens nicht zu nennen
„ Und nenne nicht das schöne Weib!
Bring die Begier zu ihrem s üß en Leib
Nicht wieder vor die halb verrückten Sinnen! “ 67
so ist doch allein schon der letzte dieser Verse Indiz genug dafür, dass er schon längst wieder von der „Begier“ entflammt worden ist. Somit werden seine Abwehrversuche zum Ende des Dialogs hin immer schwächer und durchsichtiger, und endlich gibt er dann auch seine Abwehrhaltung auf und spricht „sich steigernd, positiv von seiner Beziehung zu Gr.“68 Es zeigt sich, dass Faust sich über die Konsequenzen, die aus seiner Rückkehr zu Gretchen erwachsen werden im Klaren ist. Das Schicksal ist vorgezeichnet, er weiß, dass er schuldig werden wird und erhebt bereits vor dem Vollzug der Tat eine „Selbstanklage“69:
„ Sie, ihren Frieden musst ich untergraben!
Du, Hölle, musstest dieses Opfer haben!
Hilf, Teufel, mir die Zeit der Angst verkürzen!
Was muss geschehn, mag ’ s gleich geschehn!
Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen Und sie mit mir zugrunde gehen. “ 70
2.8. Das Vorspiel zu Fausts Fall und der Zusammenbruch - Marthens Garten und die nachfolgenden Szenen bis „Dom“
Chronologisch besehen ist diese Szene die letzte vor der sinnlichen Vereinigung zwischen Faust und Gretchen. Hier wird durch den Schlaftrunk für Gretchens Mutter der Weg zur Vereinigung geebnet, hier verrät Faust auch zum ersten Mal in eklatanter Form wissentlich seine hohen Ideale und schlägt so ganz von selbst und ohne Mephistos Zutun den Weg ein, der ihn in die Schuld führen wird. Man kann konstatieren, dass er jetzt daran geht, das wahr zu machen, was er zuvor in „Wald und Höhle“ als sein unausweichliches Schicksal in Gedanken vorweggenommen hat.
Tatsächlich zeigt sich Faust in dieser Unterhaltung mit Gretchen spürbar entflammt, doch was ihn antreibt ist der rasche Wunsch nach der Vereinigung. Dieser Wunsch lässt ihn tun, was er, wenn er noch immer von seinem so hehren Ideal der allumfassenden Liebe eingenommen wäre, niemals tun dürfte: er belügt, betrügt Gretchen aus dem reinen Wissen und der Berechnung heraus, dass er sie verlieren würde, wäre er aufrichtig. Im Naturell der wahren Liebe, besser noch der wahrhaftigen Liebe ist Unaufrichtigkeit jedoch undenkbar. Faust hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Menschwerdung hinter sich gebracht, eine weitere Stufe herab in die Schuld genommen. Denn nicht nur, dass er Gretchen auf deren Fragen, wie es denn um seine Religion steht keine befriedigenden Antworten gibt. Er lässt sie auch gänzlich über die wahre Natur seines Begleiters Mephisto im Unklaren, als sie das Gespräch darauf bringt, wohl wissend, dass dies das Ende ihrer Beziehung bedeuten würde: „Er kann ihr die Wahrheit nicht sagen, weil er sie dann unwiederbringlich verlöre.“71 Allerdings - und das ist unzweifelhaft - hat der Verlust in gewisser Weise schon stattgefunden, eben indem er verschweigt und sie damit hintergeht. Er korrumpiert damit nicht nur, was er selbst vor kurzem noch als das höchste Ideal der Liebe angesehen hat, sondern er entlarvt sich selbst beim Ausführen von genau der Handlungsweise, für deren Beschreibung er Mephisto in „Wald und Höhle“ noch gescholten hatte, nämlich dass unter all den überschwänglichen und pathetischen Verklärungen am Ende doch nur die Begierde als einzige Größe von Bestand zurückbleibt.72 Das beste Beispiel hierfür liefert Faust nun selber, als er auf den Hinweis Gretchens, sie müsse nun fort entgegnet:
„ Ach kann ich nie
Ein Stündchen ruhig dir am Busen hängen,
Und Brust an Brust und Seel in Seele drängen? “ 73
Was in schöne Worte gekleidet recht poetisch wirkt, ist bei Licht besehen nichts weiter als eine „Maskerade des sexuellen Verlangens für „keusche Ohren““,74 hervorgebracht allein aus der Sorge, die angestrebte sinnliche Vereinigung wieder nicht vollziehen zu können. Diese Furcht wird indes durch Gretchen entkräftet, strebt sie dieser Vereinigung schließlich ebenso zu, wenngleich unter völlig anderen Vorstellungen. Für Faust ist sie bereit, alles auf sich zu nehmen:
„ Ich habe schon so viel für dich getan,
Dass mir zu tun fast nichts mehrübrig bleibt. “ 75
Sie wird ihrer Mutter auch den Trank verabreichen, den sie vom Faust erhalten hat um die Voraussetzung für seinen nächtlichen Besuch zu schaffen, um dessentwillen schließlich alles zerbrechen wird, ihre Familie, ihre Liebe und ihre Unschuld.
Diesen Zusammenbruch bis hin zur endgültigen Katastrophe Gretchens vergegenwärtigen die nachfolgenden Szenen bis hin zur Szene „Dom“. Faust selbst tritt dabei nur noch in der Szene „Nacht. Straße vor Gretchens Türe“ auf. Indem dort Gretchens Bruder Valentin, der die bekannt gewordene die Schande seiner Schwester rächen will durch Fausts Hand fällt, ist die völlige Zerstörung von Gretchens Familie durch das Eindringen von Faust in ihre Welt vollkommen. Darüber hinaus wird es ihm nun unmöglich den regelmäßigen Umgang mit Gretchen aufrecht zu erhalten. Faust stellt sich der Verantwortung nicht und lässt das gefallene Gretchen im Stich, indem er zusammen mit Mephisto die Flucht ergreift. Gravierende Änderungen in seiner Position zu Gretchen sind an dieser Stelle nicht mehr zu entdecken. Hatte er seinen einstigen Anspruch auf die Liebe in ihrer Absolutheit bereits vor der Vereinigung verraten, so ist die Preisgabe der Geliebten nur die logische Konsequenz aus dem kontinuierlichen Erkalten seiner Liebe, die sich ausgehend von Vergötterung, inniger Zuneigung und schließlich hin zur bloßen Gewöhnung immer mehr verringert. Am Ende wenn er Gretchen im Kerker wieder begegnen wird, wird von alledem nur noch das Mitleid übrig geblieben sein.
2.9. Distanz, Ausbreitung und Rückführung Fausts - Walpurgisnacht
Der lange Zeitraum seit Fausts Scheiden von der Seite Gretchens und ebenso die Eindrücke auf dem Brocken haben die Prämissen, unter welchen er seine Umwelt vergegenwärtigt deutlich von den Positionen divergieren lassen, die sie noch während seiner gemeinsamen Zeit mit Gretchen innehatten. Das exaltierte Treiben der Hexen und der anderen Protagonisten führt ihn einer gänzlich anderen, vom Übersinnlichen durchdrungenen Wahrnehmung zu. Diese sich immer schneller drehende Spirale der Eindrücke beschert Faust einerseits ein durch magische Kraft erweitertes „Naturbild“76, verwirrt ihn aber auch nachhaltig.
Viel später in der Szene ereignet sich Fausts Gretchenvision, sie setzt den Schlusspunkt hinter das wild-aktionistische Treiben der Walpurgisnacht:
„ Ich muss bekennen, dass mir deucht,
Dass sie dem guten Gretchen gleicht. “ 77
Faust erlebt durch die Vision hierbei einen „Vorgang beginnender Befreiung aus der Befangenheit seelischer Entrückung zum Bewußtsein.“78 Allein, es fehlt ihm in dieser Situation die nötige geistige Nähe, um die Vision richtig zu deuten, er bleibt in allem zunächst vage unsicher, dann kühl und distanziert. Einhergehend mit der nur schleppend vorangehenden Rückkehr aus der zuvor durch äußere Stimulans geweiteten Wahrnehmung „vergegenwärtigt Faust diese Erscheinung nur in einem langsamen Prozeß.“79 Zu keinem Augenblick erfasst er jedoch die Tragweite oder aber bezieht die Bedeutung der Vision auf sich. Er bleibt teilnahmslos, seine Aussagen sind in diesem Moment nur der flüchtige Schatten früherer hochemotionaler Ausbrüche. Er vermag sich nicht wirklich geistig rückzubesinnen, so dass es Mephisto relativ leicht fällt, ihn zurück zum Theater zu zerren und weitere Reflektionen über das Gesehene zu unterbinden.80
2.10. Fausts Entrüstung ohne seine Schuld einzugestehen - Trüber Tag. Feld
Nach dem übersteigerten ausufernden Wüten, den „ausschweifenden Zerstreuungen“81 während der Szenen „Walpurgisnacht“ und dem daran anschließenden „Walpurgisnachtstraum“ stellt sich die trostlose Szenerie in „Trüber Tag. Feld“ wie das schmerzerfüllte Erwachen nach dem durchlebten Rausch dar. Dieser Kontrast ist schon beinahe übertrieben deutlich skizziert. Ebenso unvereinbar im Vergleich zur vorherigen Entrücktheit erscheint der nun wieder in der Realität angelangte Fausts innerhalb dieser trostlosen Szenerie. Endlich hat er bewusst von Gretchens Schicksal Kenntnis erlangt und gibt sich entrüstet, ist geradezu außer sich. Allerdings ist es nicht Verzweiflung, die ihn befällt, oder Schuldgefühle, die ihn heimsuchen, er zeigt sich nur in ohnmächtiger Wut, und diese Wut entlädt sich ausnahmslos auf Mephisto, dem er für die Katastrophe die alleinige Schuld gibt: „Verräterischer, nichtswürdiger Geist, und das hast du mir verheimlicht!“82 Seine Emotionen sind auch nicht der Schmerz des Liebenden, sondern einfach nur Anteilnahme an dem grausamen Schicksal Gretchens. Was fehlt ist das Eingeständnis, dass es eigentlich er gewesen ist, der dieses Ende Gretchens durch sein Tun überhaupt erst heraufbeschworen hat. Dadurch, „daß er Gretchens Unglück nicht selbst mit verantwortet“83 negiert er den elementaren Faktor für Gretchens Fall und kann von Mephisto mühelos widerlegt werden: „Wer war’s, der sie ins Verderben stürzte? Ich oder du?“84
Faust kann darauf nichts entgegnen, er weiß, dass Mephisto im Recht ist, aber er ist unfähig oder nicht willens, diese Tatsache anzuerkennen. Statt dessen versteift er sich nun auf die Forderung, Mephisto solle Gretchen retten85, was dieser natürlich nur ablehnen kann, schließlich liegt es weder in seinem Interesse noch in seiner Natur. Es ist auch nicht ganz klar, was Faust sich unter der Errettung genau vorstellt, jedoch kann nur von einer physischen Befreiung ausgegangen werden. Das eigentlich wichtige, die geistige Befreiung Gretchens - man könnte auch sagen ihre „Erlösung“ - bleibt für Faust ganz unzweifelhaft im selben Maße unmöglich wie sie für Mephisto unbedeutend ist.
2.11. Die scheiternde und gelingende Errettung Gretchens - Kerker
Mit Mephistos Hilfe erlangt Faust Zutritt zu Gretchens Verließ. Was glaubt er dort zu erreichen? Wenn er von sich selbst als „der Geliebte“86 spricht, so kann dies nur eine die Realität der Gegenwart verkennende Rückbesinnung auf glücklichere Tage sein, an denen diese Aussage noch einen Wahrheitsgehalt besaß. Gewiss ist Gretchens Liebe zu ihm nie erloschen, doch kann er eigentlich nicht das Wort mit voller Berechtigung aussprechen, ist seine Empfindung doch schon längst nicht mehr dieselbe. Sein ganzes Tun begründet sich nunmehr lediglich auf pures Mitleidsempfinden gepaart mit uneingestandener Schuld. So aber kann er nicht der Erretter sein, tatsächlich kann man Gretchen nicht einmal eine echte Fehleinschätzung vorwerfen, wenn sie bei Fausts Herantreten ausruft:
„ Wer hat dir Henker diese Macht
Über mich gegeben! “ 87
Immerhin war es Faust, der ihr ganzes Leben, ihr Sein und ihre Existenz in den Abgrund gerissen hat um sie am Ende ihrem Schicksal zu überlassen, womit er sie der gesellschaftlichen Verdammnis preisgegeben hat.
Wie sehr er sich ihr entfremdet hat zeigt sich zunächst in der Tatsache, dass sie ihn lange Zeit überhaupt nicht zu erkennen imstande ist. Zwar kann dies auch zu einem gewissen Grade auf ihre Verwirrung, bzw. „Bewusstseinsverdunkelung“88 zurückgeführt werden, die sich nach all der erlittenen Pein naheliegenderweise eingestellt hat. Dennoch ist es auffällig, dass bis zur Wiedererkennung des einstigen - und einzigen - Geliebten so viel Zeit vergeht. Als sie ihn dann endlich erkennt, ist die verzweifelte Freude darüber freilich nur sehr kurz. Denn die Hoffnung auf Freiheit und Rettung basiert allein darauf, dass in Faust derjenige zu ihr zurückgekehrt ist, den sie einst liebte. Zwar besinnt sie sich jetzt der glücklichen gemeinsamen Vergangenheit und hofft, mit der Rückkehr Fausts könnte eben diese Vergangenheit ohne schmerzhafte Zäsur wieder zu einer Gegenwart werden. Aber die völlig veränderte Grundhaltung Fausts ihr gegenüber macht diese Hoffnung rasch zunichte:
„ Sehr bald indes wird sie dessen inne, daßes nicht alles ist, Faust als Retter zu erkennen, sondern daßes zuletzt darauf ankommt, ob er als der gleiche, als der Geliebte einst, zurückkehrt. “ 89
Faust ist nicht mehr derselbe, der Umstand, dass er auf ihre Liebkosungen nicht eingeht, ihre Küsse nicht erwidern will zeigt es ihr. Natürlich denkt Faust in diesem Moment ausschließlich an die Flucht und wehrt vornehmlich aus diesem Grund alle körperlichen Erwiderungen der Zuneigung ab. Gretchen aber, die von der verzweifelten Hoffnung beseelt ihre entsetzliche Situation schon zugunsten des verklärenden Vergangenheit verdrängt hat, erlangt dadurch die erschreckende Erkenntnis, wie sehr Faust sich verändert hat:
„ O weh! Deine Lippen sind kalt,
Sind stumm.
Wo ist dein Lieben
Geblieben? “ 90
Es kommt ihr nun schlagartig zu Bewusstsein, wie viel Zeit vergangen ist und vor allem was geschehen ist. Die Erinnerungen an den Tod der Familie, die gesellschaftliche Verstoßung gipfelnd in ihrer Verzweiflungstat der Ertränkung des Neugeborenen - das alles gepaart mit der Erkenntnis, dass der Faust, den sie liebte verschwunden ist lässt jeglichen Hoffnungsschimmer ersterben. Sie kann Faust nicht begleiten, denn die Rettung, die er verheißt ist nicht die Rettung, derer sie bedürfte. Er kann Gretchen nur vor der unmittelbaren Bedrohung der Hinrichtung bewahren, aber ihr nicht ihr verlorenes Seelenheil wiedergeben, ohne das ihr jedwedes Weiterleben nur „eine Fortsetzung des Irrens im Elend“91 wäre. So wehrt sie sich denn auch dagegen, als Faust als letztes Mittel der Verzweiflung versucht, sie gegen ihren Willen aus dem Kerker zu bringen. Es würde für sie nichts weiter als die unerträgliche Fortsetzung und das Fortbestehen ihrer Schuld bedeuten und entspräche somit einem „Mord an ihrer Seele, die nach Sühne und Frieden verlangt.“92 Diesen Frieden aber kann sie diesseits des Lebens nicht mehr finden, der einzige wirkliche Ausweg, die Aussicht auf Befreiung von der Schuld besteht im Tod und darin, dass sie sich dem Gericht Gottes, also einer hören Instanz überantwortet. Faust muss unverrichteter Dinge abziehen, seine geplante Rettung ist es nicht, die Gretchen wahrhaftig „erretten“ kann. Diese Errettung und ihren Seelenfrieden kann Gretchen nur jenseits der Lebensschwelle wiederfinden.
3. Zusammenfassung und Nachbetrachtung
Wie es sich gezeigt hat, sind Fausts unterschiedliche Liebeszustände sowie deren Ineinandergreifen aber auch deren Wandel eng mit seinem Übergang vom abstrakten, außerhalb der Welt positionierten Geisteswesen hin zum realen Menschen verbunden. Als Geistwesen war er zunächst zu überhaupt keinem Liebesempfinden fähig, weder das erhöhende, absolute Liebesempfinden noch die sinnliche Liebe war ihm geläufig. Mit seiner Öffnung zum Menschlichen hin beginnt er allerdings, diese gewaltigste aller menschlichen Leidenschaften zu erfahren und erlebt in ihr die höchste Glückserfüllung, aber schließlich auch den katastrophalen Abfall hin zur Schuld. Exemplarisch erlebt Faust den Verlauf des Liebesempfindens durch seine Bindung mit Gretchen, einer frommen Bürgerstochter. Fausts Eindringen in ihre eng begrenzte Welt führt Gretchen zum ersten Mal aus dieser heraus, doch dem Hochgefühl der Liebe folgt alsbald der Abschwung, als zum einen Fausts hohes Empfinden durch seine Unaufrichtigkeit Gretchen gegenüber und damit die Negierung des Eigenanspruchs der wahrhaftigen Liebe erfolgt. Statt dessen kühlt Fausts vormals so lodernd entflammte allumgreifende Hingabe zu Gretchen mehr und mehr ab, dem mehrfach beschworenen Wunschdenken von der „ewigen Liebe“ zum Trotz. Das zunächst als Außergewöhnliche und Unvergleichliche empfundene wird bekannter, die anfängliche vergötternde Überhöhung weicht der sinnliche Routine, die Neuheit des Gefühls verfliegt und lässt das vormals brodelnde Innere erkalten. Alsbald zieht die Vereinigung mit Gretchen eine gesellschaftliche Katastrophe nach sich, ihre Familie und ihre Existenzgrundlage wird zerstört, eine unmittelbare Folge von Fausts Eintritt in ihr Leben. Faust zieht sich zurück und überlässt sie ihrem Schicksal, erst ganz zuletzt kehrt er wieder. Doch ist sein Handeln nun nicht mehr durch sein Lieben motiviert, sondern nur durch sein Mitgefühl dem gefallenen Mädchen gegenüber, einen Fall, den er auf den Gewissen hat, dies aber nicht einzugestehen bereit ist. Seine Liebe ist erloschen, aber Bedauern und Mitleid treiben ihn zu einem verzweifelten Versuch der Rettung Gretchens, eine Errettung die ihm nicht zusteht. Allein durch die außerweltliche Gerichtsbarkeit kann Gretchen, das durch ihn schuldig geworden ist die seelische Befreiung erlangen. Faust bleibt zurück und ist durch sein Unvermögen, Gretchen beistehen zu können endlich an einem Punkt angelangt, der ihm seine Ohnmacht gegenüber dem Schicksal vor Augen führt, das ihn und Gretchen ereilte und das trotz aller Hilfestellung des Teufels letzten Endes nur aus vom Mensch vollbrachten Taten erwächst. Faust hat die Liebe erfahren, aber auch ihre Unberechenbarkeit, sowohl die schaffende als auch die zerstörende Kraft die in ihr innewohnt. Er hat erkennen müssen wie der Mensch durch sie das Spektrum der von überhöhter Transzendenzerfahrung bis hin zur dumpfen Verzweiflung durchschreitet, wie er durch sie überhaupt erst Mensch sein kann.
4. Literatur
Arens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I. Beiträge zur neueren Literaturgeschichte Dritte Folge, Band 57. Carl Winter Universitätsverlag. Heidelberg, 1982.
Goethe, Johann Wolfgang: Faust - der Tragödie erster Teil. Reclams Universal-Bibliothek Nr. 1. Phillip Reclam Verlag. Stuttgart, 2000.
Requadt, Paul: Goethes „ Faust 1 “. Leitmotivik und Architektur. Wilhelm Fink Verlag. München, 1972.
Schmidt-Möbius, Friederike: Who is Who in Goethes Faust? Edition Leipzig in der Dornier Medienholding GmbH. Berlin, 1999
[...]
1 Vgl. dazu Arens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I. Beiträge zur neueren Literaturgeschichte Dritte Folge, Band 57. Carl Winter Universitätsverlag. Heidelberg 1982, Seite 226. Im folgenden zitiert: Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I.
2 „Du siehst mit diesem Trank im Leibe,/ Bald Helenen in jedem Weibe“. Vgl. Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Der Tragödie erster Teil. Vers 2603f. Im folgenden zitiert: Faust I
3 Vgl. dazu Requadt, Paul: Goethes „ Faust 1 “. Leitmotivik und Architektur. Wilhelm Fink Verlag. München, 1972, Seite 210. Im folgenden zitiert: Requadt, Paul: Goethes „ Faust 1 “
4 Faust I, Vers 2431ff
5 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 238.
6 Ebd.
7 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 239.
8 Faust I, Vers 2444 ff
9 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 239.
10 Ebd.
11 Faust I, Vers 2456
12 Ebd., Vers 2461 f
13 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 240. 6
14 Faust I, Vers 2599 f
15 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 255.
16 Faust I, Vers 2603 f
17 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 255.
18 Ebd.
19 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 258 f
20 Faust I, Vers 2605 f
21 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 259
22 Faust I, Vers 2608 f
23 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 259
24 Vgl. dazu Faust I, Vers 2609 ff
25 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 259
26 Ebd., Seite 258
27 Faust I, Vers 2618
28 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 261 9
29 Vgl. Requadt, Paul: Goethes „ Faust 1 “, Seite 220
30 Faust I, Vers 2647
31 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 264
32 Ebd.
33 Vgl. dazu Faust I, Vers 2683
34 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 265
35 Ebd.
36 Ebd.
37 Vgl. dazu: Requadt, Paul: Goethes „ Faust 1 “, Seite 225
38 Faust I, Vers 2693 f und 2707 f
39 Vgl. Requadt, Paul: Goethes „ Faust 1 “, Seite 225
40 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 266 11
41 Vgl. Faust I, Vers 2709
42 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 269
43 Faust I, Vers 2716-20
44 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 269
45 Faust I, Vers 2730
46 Ebd., Vers 2738
47 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 270
48 Faust I, Vers 2753
49 Vgl. Requadt, Paul: Goethes „ Faust 1 “, Seite 231 f
50 Vgl. dazu Faust I, Vers 3033 ff
51 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 286
52 Ebd., Seite 287
53 Faust I, Vers 3064
54 Ebd., Vers 3065
55 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 287
56 Ebd., Seite 290
57 Faust I, Vers 3073 ff
58 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 292
59 Faust I, Vers 3191 ff
60 Vgl. dazu Ebd., Vers 3184 ff
61 Vgl. Requadt, Paul: Goethes „ Faust 1 “, Seite 241
62 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 299
63 Ebd., Seite 300
64 Ebd., Seite 315
65 Ebd.
66 Faust I, Vers 3313 f
67 Ebd., Vers 3326 ff
68 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 316 und Faust I, Vers 3332 ff
69 Vgl. Requadt, Paul: Goethes „ Faust 1 “, Seite 267
70 Faust I, Vers 3360 ff
71 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 333
72 Vgl. Fußnote 64 und Faust I, Vers 3291 ff
73 Faust I, Vers 3502 ff
74 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 335
75 Faust I, Vers 3519 f
76 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 380
77 Faust I, Vers 4187 f
78 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 407
79 Vgl. Requadt, Paul: Goethes „ Faust 1 “, Seite 303
80 Vgl. dazu Faust I, Vers 4213 ff
81 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 434
82 Vgl. Faust I, Trüber Tag. Feld
83 Vgl. Requadt, Paul: Goethes „ Faust 1 “, Seite 327
84 Vgl. Faust I, Trüber Tag. Feld
85 Vgl. Ebd.: „Rette sie! oder weh dir!“
86 Faust I, Vers 4421
87 Ebd., 4427 f
88 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 455 22
89 Vgl. Requadt, Paul: Goethes „ Faust 1 “, Seite 330
90 Faust I, Vers 4493 ff
91 Vgl. Ahrens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I, Seite 461
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse von Goethes Faust I?
Die vorliegende Analyse untersucht die verschiedenen Erfahrungen der Liebe, die Faust macht, und die Wandlung ihrer Qualitäten in unterschiedlichen Situationen. Dabei wird betrachtet, wie Fausts Reaktionen und Taten ihn der innersten Natur des Menschen näherbringen, ihn aber auch schuldig werden lassen. Im Fokus steht seine wechselnde Beziehung zu Gretchen, aber auch seine Betrachtungen über die Natur der "wahren Liebe". Die Analyse erfolgt chronologisch, beginnend mit der ersten Konfrontation Fausts mit der Thematik weiblicher Schönheit.
Welche Szenen werden im Detail analysiert?
Die Analyse umfasst unter anderem folgende Szenen:
- Hexenküche (Faust vor dem Eintritt in die Welt)
- Straße (Faust trifft auf Gretchen)
- Abend (Faust in Gretchens Zimmer)
- Garten (Das erste ausführliche Treffen zwischen Faust und Gretchen)
- Gartenhäuschen (Der vergängliche Moment tiefster Liebe)
- Wald und Höhle (Faust zwischen Sehnsucht, Schuldgefühl und Distanzierung)
- Marthens Garten und die nachfolgenden Szenen bis „Dom“ (Das Vorspiel zu Fausts Fall und der Zusammenbruch)
- Walpurgisnacht (Distanz, Ausbreitung und Rückführung Fausts)
- Trüber Tag. Feld (Fausts Entrüstung ohne seine Schuld einzugestehen)
- Kerker (Die scheiternde und gelingende Errettung Gretchens)
Welche Rolle spielt die Hexenküchen-Szene?
Die Hexenküchen-Szene ist ein zentraler Angelpunkt, da hier der Grundstein für die Verknüpfung der Gelehrtentragödie mit der Gretchenhandlung gelegt wird. Faust nimmt hier den Verjüngungstrank zu sich und hat eine Vision, die für seine späteren Intentionen und Handlungen von großer Bedeutung ist. Es ist der Beginn seiner Menschwerdung, in dem er Schönheit, Liebe und praktische Tätigkeit entdeckt.
Wie verändert sich Fausts Einstellung zur Liebe im Laufe der Handlung?
Zunächst ist Faust als Geisteswesen zu keinem Liebesempfinden fähig. Durch seine Erfahrungen mit Gretchen lernt er die verschiedenen Facetten der Liebe kennen, von der idealisierten Form bis hin zur sinnlichen Begierde. Seine Liebe zu Gretchen durchläuft verschiedene Phasen, von Vergötterung über innige Zuneigung bis hin zur Gewöhnung und schließlich zum Mitleid. Am Ende muss er erkennen, dass seine Handlungen zu Gretchens Unglück geführt haben und er sie nicht retten kann.
Welche Bedeutung hat Mephisto in Fausts Liebesbeziehung zu Gretchen?
Mephisto spielt eine entscheidende Rolle, da er Faust zum sinnlichen Leben verführt und die Begegnung mit Gretchen arrangiert. Er versucht, Fausts idealistische Vorstellungen von Liebe auf das rein Körperliche zu reduzieren und ihn in die Schuld zu treiben. Er ist sich bewusst, dass zwischenmenschliche Gefühle endlich sind und instrumentalisiert Fausts Begierde.
Warum scheitert Fausts Versuch, Gretchen zu retten?
Faust scheitert, weil seine Liebe zu Gretchen erloschen ist und er nur noch von Mitleid und Schuldgefühlen getrieben wird. Er kann Gretchen nicht ihr verlorenes Seelenheil wiedergeben, ohne das ihr Weiterleben nur eine Fortsetzung des Elends wäre. Gretchen erkennt, dass Faust sich verändert hat und kann ihm nicht in eine ungewisse Zukunft folgen. Sie entscheidet sich für die Sühne ihrer Schuld durch das göttliche Gericht.
Welche Literatur wird in der Analyse verwendet?
Die Analyse bezieht sich unter anderem auf folgende Werke:
- Arens, Hans: Kommentar zu Goethes Faust I
- Goethe, Johann Wolfgang: Faust - der Tragödie erster Teil
- Requadt, Paul: Goethes „ Faust 1 “
- Schmidt-Möbius, Friederike: Who is Who in Goethes Faust?
- Quote paper
- Fabian Lorenzen (Author), 2001, Die Verwandlungen der Liebe bei Faust in Goethes 'Faust - Der Tragödie erster Teil', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107066