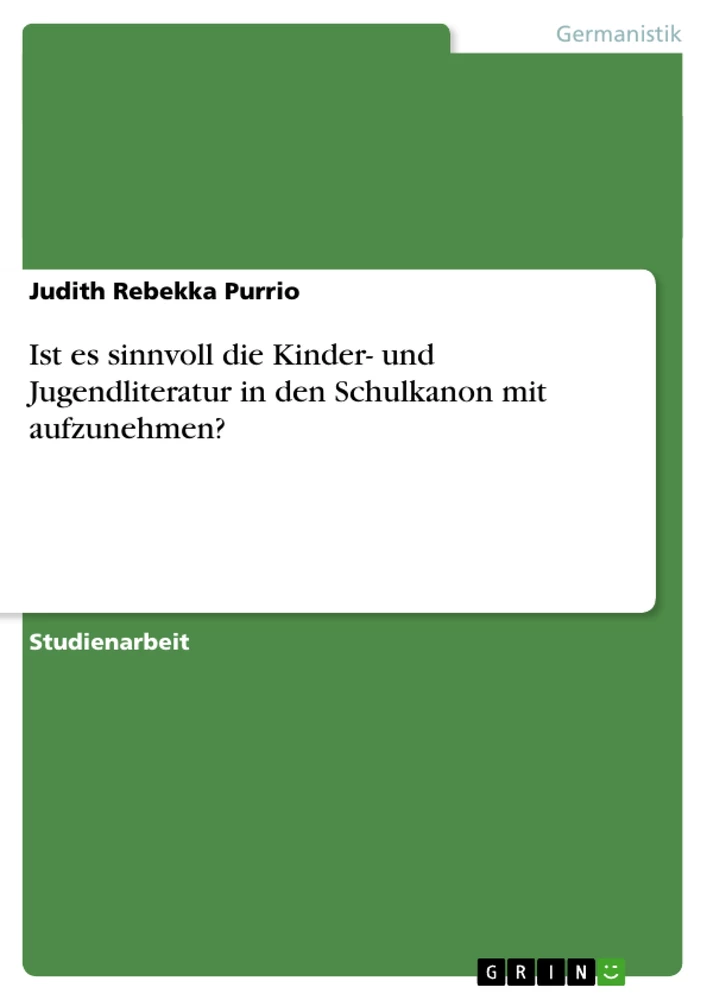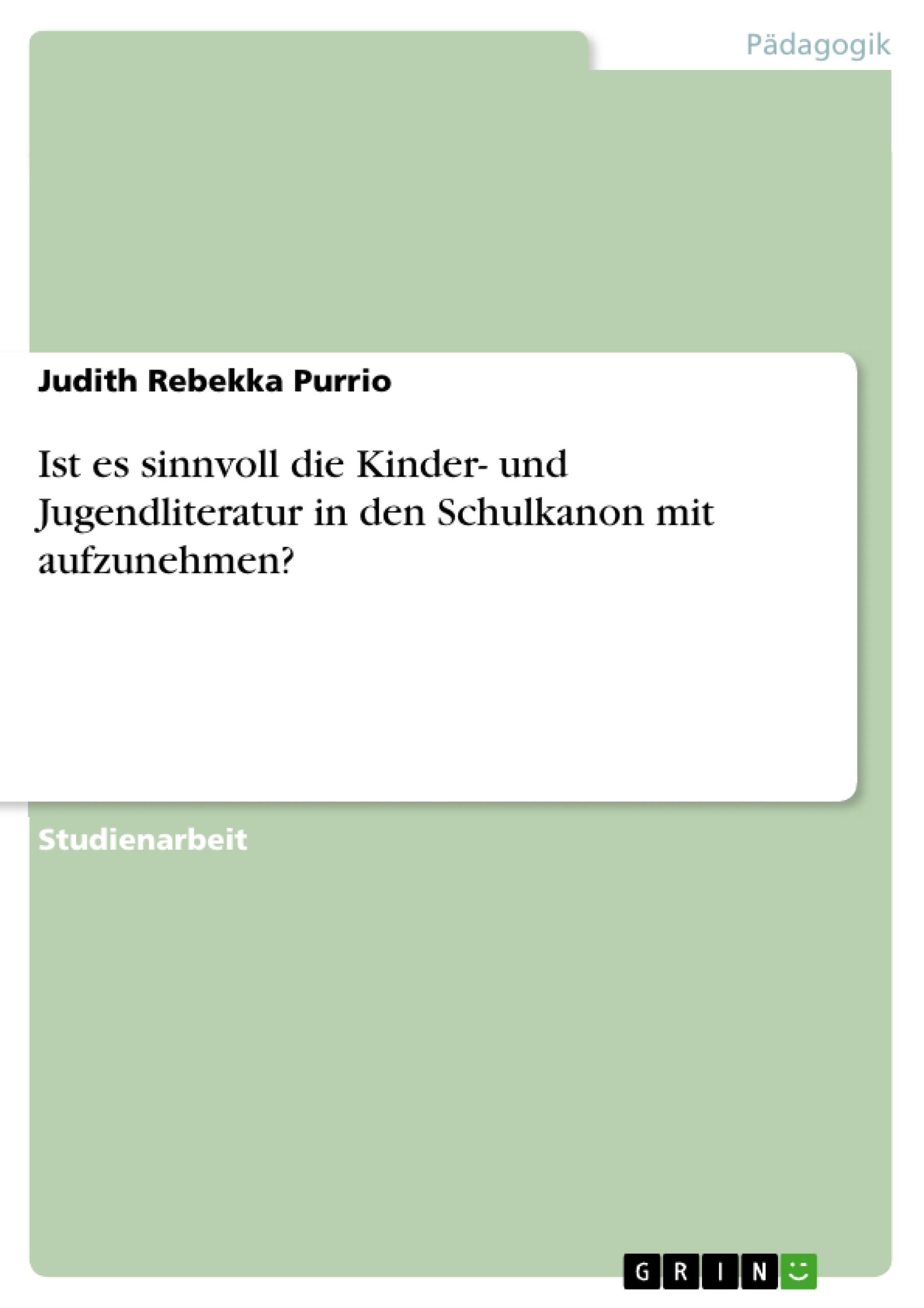Was macht ein Buch zum Klassiker, und wer entscheidet das eigentlich? Diese brisante Frage steht im Zentrum einer tiefgreifenden Auseinandersetzung mit der Kinder- und Jugendliteratur und ihrer Rolle im Schulkanon. Jenseits von nostalgischen Erinnerungen an "Struwwelpeter" und "Emil und die Detektive" beleuchtet diese Analyse, wie sich der Umgang mit Kinderbüchern im Laufe der Geschichte gewandelt hat – von Instrumenten der Erziehung und ideologischen Beeinflussung bis hin zu Spiegeln gesellschaftlicher Realitäten und Wegbereitern für literarisches Verständnis. Entdecken Sie, wie Aufklärung, Industrialisierung, die Weimarer Republik und die NS-Zeit die Inhalte und Funktionen von Kinder- und Jugendliteratur prägten und wie die DDR einen eigenen, ideologisch geprägten Kanon etablierte. Die Debatte um die Kanonisierung von Kinder- und Jugendliteratur ist vielschichtig: Sollten wir den Fokus auf pädagogische Werte legen oder auf ästhetische Qualität? Dient Kinderliteratur lediglich als "Anfängerliteratur" für höhere Weihen, oder besitzt sie einen eigenständigen Wert, der im Unterricht gewürdigt werden muss? Kritische Stimmen warnen vor einer "Lesekonsumhaltung", während andere die Bedeutung der Identifikation mit Figuren und die altersgerechte Vermittlung von Werten betonen. Diese Untersuchung bietet einen umfassenden Überblick über die Pro- und Contra-Argumente, analysiert die Kriterien für die Auswahl von Schullektüren und wirft ein Licht auf die Herausforderungen und Chancen, die mit der Integration von Kinder- und Jugendliteratur in den Kanon verbunden sind. Ein Muss für alle, die sich für Literaturdidaktik, Bildungsgeschichte und die Bedeutung des Lesens für junge Menschen interessieren – und die sich fragen, welche Geschichten wir unseren Kindern erzählen und warum. Ist die Aufnahme von Kinder- und Jugendliteratur in den Schulkanon ein notwendiger Schritt zur Förderung der Lesekompetenz und zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Werten, oder droht eine Nivellierung des literarischen Geschmacks? Diese Arbeit liefert fundierte Antworten und regt zur Diskussion an.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Mit dieser schriftlichen Ausarbeitung möchte ich mich mit der Kanonfrage beschäftigen, und zwar damit, ob es sinnvoll ist auch die Kinder- und Jugendliteratur zu kanonisieren.
Noch bis in die siebziger Jahre hinein trat man der Frage, ob man die Kinderund Jugendliteratur in den literarischen Kanon aufnehmen sollte, skeptisch und mit weniger Ernst entgegen. Man ordnete sie eher der Trivialliteratur zu und befand sie für genauere literarische und literaturdidaktische Analysen unwürdig. Erst Mitte der Siebziger rückte die Diskussion der Kanonfrage auch für diese Art von Literatur immer mehr in den Mittelpunkt.
Ich werde nun genauer auf die Definition, Eigenschaften und Aufgaben im schulischen Bereich der Kinder- und Jugendliteratur, deren historische Rolle in der Gesellschaft und der Schule und die befürwortenden und ablehnenden Meinungen für die Aufnahme in den Schulkanon eingehen.
2. Definition, Eigenschaften und Aufgaben der Kinder- und Jugendliteratur
Zuerst möchte ich mich mit der Definition und den Eigenschaften der Kinderund Jugendliteratur beschäftigen.
In der Kinder- und Jugendliteratur unterscheidet man zwischen sanktionierter, spezifischer und intentionaler Kinder- und Jugendliteratur.
Unter sanktionierter Kinder- und Jugendliteratur versteht man Schriftgut, das die vermittelnden Instanzen als für Kinder und Jugendliche geeignet ansehen.
Unter spezifischer Kinder- und Jugendliteratur fasst man „all das Schrifttum das eigens für Kinder und Jugendliche“ geschrieben wurde zusammen (vgl. Metzler Literatur Lexikon, 2. Auflage, 1990, 236).
Dahrendorf bezeichnet Kinder- und Jugendliteratur als Zielgruppenliteratur, das heißt entweder wurde diese Literatur speziell für Kinder und Jugendliche geschrieben oder sie ist durch die Bearbeitung anderer Literatur entstanden. Aufgrund dieser Adressatenspezifik spricht man bei Kinder- und Jugendliteratur von intentionaler Literatur (vgl. Malte Dahrendorf, 1996, 11).
Nun stellt sich natürlich die Frage, ob die Kinder- und Jugendliteratur aufgrund ihrer Adressatenspezifik noch untrennbar von der anderen Literatur gesehen werden kann oder ob sie aus diesem Grunde zu einem Sonderfall mit eigenen Kriterien wird.
Rutschky definiert die Kinder und Jugendliteratur als ein Produkt der verstärkten Zuwendung zu Kindheit und Jugend, die für Literatur und Pädagogik durchaus zweischneidig gewesen wäre und sei, denn Zuwendung bedeute nicht nur Rücksicht auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, sondern auch Kontrolle, da die Pädagogik und mit ihr Kinder- und Jugendliteratur leicht in eine >Schwarze< Pädagogik (im Sinne von Unterdrückung und Zwang) abgleiten könne (vgl. Rutschky 1977. Zit. nach Malte Dahrendorf: Vom Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur. Berlin. 1996, 12).
Immer wieder wird auch die Kinder- und Jugendliteratur als Anfängerliteratur beschrieben, da sie besonders geeignet für den Einstieg in den Umgang mit schwerer und höherer Literatur sei oder auch elementar gesehen zum Aneignen von Texten helfen würde. Sie solle im Literaturunterricht zudem den Schülern den Zugang zu Erscheinungsformen und Darstellungsformen der Literatur im gesellschaftlichen Feld öffnen, dass heißt das Ziel sei es die Schüler in die Lage zu versetzen sich zum Beispiel in der Bibliothek zurecht zu finden, Autorenlesungen folgen zu können, Bücher zu besprechen und eigene Buchrezensionen zu schreiben.
Es sollten also nicht nur kognitive Fähigkeiten, sondern auch elementare, emotionale und affektive erlernt werden. Dies könne am besten durch produktionsorientierten- und handlungsorientierten Unterricht erfolgen, zum Beispiel indem der lesende Schüler sich mit der Figur identifiziere, seine Handlungen durch das Schreiben von Briefen an eine Figur aus einer Kinderoder Jugendlektüre, das Erfinden von Parallelgeschichten und Umändern oder Ergänzen der Geschichte begleiten könne.
Natürlich spiele auch die Förderung des Leseinteresses eine Rolle im Literaturunterricht (vgl. Gerhard Haas, 1998).
3. Historischer Abriss des gesellschaftlichen und schulischen Umgangs mit Kinder- und Jugendliteratur
Die Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur setzte praktisch mit der Erfindung des Buchdrucks ein.
Im 18 Jahrhundert waren die Erkenntnisse der Aufklärung für die Entwicklung der Kinder und Jugendliteratur von großer Bedeutung.
Die Intentionalität in der Erwaschenen- und in der Kinder- und Jugendliteratur waren im Verlauf des 18. Jahrhunderts geprägt von den propagierten Werten, die die neue Art des Wirtschaftens als Folge der Industrialisierung, Nächstenliebe, Arbeitstugenden, wie z.B. Fleiß und Pünktlichkeit, Gehorsam, Treue, Verzichten können vermittelten. Diese Literatur richtete sich vor allem an das mächtiger werdende Bürgertum.
Durch die Zunahme der Kleinfamilien kam es zu einer stärker werdenden Zuwendung, Liebe und erzieherischen Maßnahmen auf das einzelne Kind und dadurch auch zu einer Zunahme der Beschäftigung mit dem Thema Erziehung und den darauf folgenden pädagogischen Reformbewegungen. Zu dieser Zeit dient die Kinder- und Jugendliteratur als Instrument der Erziehung
Auch im 19. Jahrhundert nahm die Kinder- und Jugendliteratur eine aufklärende Position ein doch mit neueren Inhalten und verstärkter Unterhaltungsabsicht.
Ende des 19. Jahrhunderts kam es dann zu den ersten Prüfungsausschüssen zusammengesetzt aus Lehrern, die Bewertungskriterien für die Kinder- und Jugendliteratur erarbeiteten.
Zur Zeit der Weimarer Republik rang die Arbeiterbewegung vermehrt um sozialistische Inhalte in der Kinder- und Jugendliteratur. Daran knüpfte die Literatur der ehemaligen DDR an. Doch es wurden auch neue reformpädagogische Bewegungen gestartet, die dann letztendlich die Kinderund Jugendliteratur beeinflussten.
In der NS-Zeit sollte die Kinder- und Jugendliteratur regimestützend wirken und deren propagierten Werte vermitteln.
Jüdische Literatur und nicht systemkonforme Literatur wurde aus der Gesellschaft verbannt.
Nach der NS-Zeit wurde im westlichen Teil Deutschlands an die jugendliterarische und literarisch-politische Literatur vor der Hitlerdiktatur wieder angeknüpft. Und es kam zu einer psychischen Verdrängung der Ereignisse im Nationalsozialismus.
Erst in den sechziger / siebziger Jahren begann man sich langsam wieder mit der Vergangenheit auseinander zu setzen und es kam zu Wellen von mitgeschichtlicher, antiautoritärer, problemorientierter, gesellschaftskritischer, emanzipatorischer und enttabuisierender Kinder- und Jugendliteratur.
Doch auf der literaturdidaktischen Diskussions-Ebene spielte die Kinderund Jugendliteratur in den sechziger Jahren nur eine geringe Rolle und auch die Schulen und die Gymnasien enthielten sich. Statt dessen kam es zu einer eigenen Diskussion zum Thema Kinder- und Jugendliteraturdidaktik.
Erst Ende der sechziger Jahre gewann die Kinder- und Jugendliteratur eine vermehrte Berücksichtigung im Literaturunterricht.
Literaturdidaktiker, wie Alfred Clemens Baumgarten oder Anna Krüger trugen durch ihre Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendliteraturdidaktik zur erheblichen Akzeptanz dieser Literatur bei. So kam es 1996, rückblickend auf Anna Krügers literaturdidaktische Arbeit, zu folgender literaturanalytischer Begründung eines neuen, erweiterten Literaturkanons:
Anna Krüger hat, indem sie eine kleine Anzahl von Kinderbüchern wieder und wieder analysiert, einen Kanon vorbildlicher Werke aufgestellt, die sie für prototypisch erklärt, an denen sie Maßstäbe demonstriert und die sie für den Unterricht literaturdidaktisch organisiert. Es scheint ihr notwendig, der Flut der immer rascher zunehmenden Neuerscheinungen einen solchen Kanon gegenüberzustellen, um dem Gegenstand ihrer Forschung ein Profil zu geben, das sonst ständig zu zerfließen droht. [...] Welchen Charakter hatte der Kanon von Anna Krüger? Er brachte Autoren und Werke zur Ansicht, für deren Rezeption erst die Bahn gebrochen werden musste, da sie von den maßgeblichen Kreisen >abgelehnt [...] < wurden. [...] Ihr Kanon war ein Gegenkanon [...] (Lypp, 1996, 186, Hervorh. E.K.P. zitiert nach: Elisabeth Paefgen: Einführung in die Literaturdidaktik. Stuttgart u.a. 1999, 67).
Anna Krüger hielt vor allem die Werke, wie Astrid Lindgrens Karlsson vom Dach, Carlo Collodis Pinocchios Abenteuer, Erich Kästners Emil und die Detektive, Mark Twains Tom Sawyers Abenteuer und Kurt Helds Rote Zora für kanonwürdig.
Die Kinder- und Jugendliteratur reagierte auf die jeweiligen Trends und Bedürfnisse der Jugendlichen in den siebziger Jahren und erfüllte den Wunsch nach gesellschaftlicher, sozialer und politischer Aktualität. Sie wurde phasenweise zu dem Medium eines aufklärerisch-kritischen Literaturunterrichts und rückte die gesellschaftlichen und politischen Interessen in den Mittelpunkt. Gleichzeitig wurde die Kinder- und Jugendliteratur zum Element wissenschaftlicher Darstellung an Hochschulen und Universitäten. Es entstanden neue Forschungsgemeinschaften, die der Diskussion der Kinder- und Jugendliteratur mehr Gehör zu verschaffen versuchten. In den achtziger Jahren gab es durch die Zunahme der Massenmedien und der Entwicklung einer Konsumgesellschaft eine neue Herausforderung für das Lesen. Viele Schulen kehrten sich von der Kinder- und Jugendliteratur ab oder begannen an ihrer Bedeutsamkeit zu zweifeln.
In der DDR nahm die Kinder- und Jugendliteratur, im Gegensatz zu der in der BRD, schon seit den sechziger Jahren einen festen Platz im Schulunterricht ein. Dabei wurde zwischen den allgemeinen Empfehlungen für die Privatlektüre und denen für die verbindliche Lektüre unterschieden. Da die Texte aber dem Leitbild der sozialistischen Gesellschaft folgten, wurden die Interpretationen weitgehend vorgegeben, wobei nicht nachweisbar ist, inwieweit sich die Lehrer in der Praxis an dieses Leitbild hielten. Die ästhetische Bildung blieb zu Zeiten der DDR aufgrund der gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen weitgehend im Hintergrund.
Ab den siebziger Jahren war eine zunehmende Phantastik, Gesellschaftskritik und Emanzipierung von der staatlichen Bevormundung in der Erwachsenen- als auch in der Kinder- und Jugendliteratur zu beobachten, wenn auch nur in dosierter Form. Nach der Wende kam es zum Zusammenbruch der DDR-Literatur.
Die jüngsten Entwicklungen der Kinder- und Jugendliteratur zeigen einen Trend nach oben hin zur Literarisierung und zur Öffnung zur allgemeinen Literatur und umgekehrter Weise aber auch den Trend nach unten zur Bezeichnung als Anfängerliteratur.
4. Pro und Kontra für die Aufnahme der Kinder- und Jugendliteratur in den Schulkanon
Wie wir wissen beinhaltet der Kanon eine „Auswahl der für eine bestimmte Zeit jeweils als wesentlich, normsetzend, zeitüberdauernd, d.h. >klassisch< erachteten künstlerischen Werke, deren Kenntnisse für eine gewisse Bildungsstufe vorrausgesetzt wird (z.B. in Lehrplänen)“ (Metzler Literaturlexikon, 2. Auflage, 1990, 232).
Diese Definition können wir weitgehend auch auf die Kinder- und Jungendliteratur übertragen, denn auch sie weist Traditionen und Merkmale für unsere Gesellschaft auf, wie z.B. die in Struwelpeter deklarierten Werte von Ordnung, Fleiß und Hygiene.
Und auch die Universalität in der Kinder- und Jungendliteratur ist wieder zu finden. Denn z.B. können die Geschichten von Erich Kästner (wie zum Beispiel Das doppelte Lottchen) aus ihrem historischen Kontext entrissen werden und auf unsere Zeit und vor allem auf die aktuelle Lebenssituation der Schüler bezogen werden.
Cornelia Rosebrock, die sich mit dem Thema der Kanonisierung des Kinder- und Jungendliteratur beschäftigt, vertritt eine etwas andere Meinung nämlich, dass ein natürlich gewachsener Kanon „allen möglichen Gesetzmäßigkeiten [...], nicht aber [den] literaturdidaktischen oder wissenschaftlichen Überlegungen“ folge (Cornelia RosebrocK, 1998, 102. Zit. nach: Elisabeth Paefgen: Einführung in die Literaturdidaktik. Stuttgart u.a. 1999, 73).
Schon aus diesem Grunde sei es angebracht, eine Überlegung über den Kanon in Hinblick der Kinder- und Jungendliteratur anzustellen. Denn diese Literatur habe, laut Rosebrock außerhalb des klassischen Kanonisierungsprozesses gestanden, da sie „auf andere Traditionen im Mischungsverhältnis von Gebrauchsorientierung und Autonomieästhetik zurückblicken“ könne. Deshalb könne die Kinder- und Jungendliteratur nicht einfach in den Kanon integriert werden, sondern es handele sich hier um einen „Subkanon“ (vgl. ebd., 104. Zit. nach: Elisabeth Paefgen: Einführung in die Literaturdidaktik. Stuttgart u.a. 1999, 73).
Auch die schon im Zitat erwähnte Ästhetik spielt im Kanonisierungsprozess der Literatur eine große Rolle, dessen Qualität in der Kinder- und Jungendliteratur vor allem Anna Krüger hervorheben möchte. Kaspar Spinner beschäftigt sich mit diesem Thema in seinem Aufsatze zur Dialektik des pädagogischen in der Geschichte der Kinder- und Jungendliteratur (Spinner 1994) und demonstriert an Beispielen der Aufklärung bis zur Gegenwart, dass die pädagogische Funktion und der ästhetische Wert in einem dialektischen Wechselverhältnis zueinander stehen würden.
Immer wieder entpuppt sich ästhetischer Anspruch als eine nur noch subtilere pädagogische Vereinnahmung, aber ebenso wird die pädagogische Intention immer wieder im Lesevergnügen der Rezipienten aufgehoben (Spinner 1994, 14. Zit. nach: Bernhard Rank: Schwerpunkt: Kinder- und Jugendliteratur und Pädagogik. Heidelberg. 2000).
Für einige Pädagogen, Literaturwissenschaftler und Literaturdidaktiker ist der ästhetische Wert der Kinder- und Jungendliteratur eher Nebensache. Für sie spielt der pädagogische Wert eine weitaus wichtigere Rolle. Dahrendorf ist zum Beispiel ein Vertreter dieser Position. Für ihn sind die wichtigsten Aufnahmekriterien der Kinder- und Jungendliteratur in den Schulunterricht einmal der erleichterte Einstieg in den Umgang mit Texten und vor allem die Förderung des Leseinteresses der Schüler, also das Kriterium des Lesebedürfnisses.
Dieses Kriterium ist ein neuer Aspekt für die Kanondebatte, da vorher nur das Werk und nicht der Leser befragt wurde (vgl. Elisabeth Paeffgen, 1999, 70). Doch auch hier ist wiederum mit einem Problem zu rechnen, denn um das Lesebedürfnis als Kriterium fest zulegen, muss auch eine genaue Definition vorhanden sein. Doch es ist schwierig die Lesebedürfnisse der Schüler zu generalisieren.
Als nächstes möchte ich auf den Bildungsauftrag der Schule eingehen, vor dessen Hintergrund die Auswahl der Werke für den Schulkanon stehen. Die Schule soll dem Schüler dazu verhelfen, sich in seiner Umwelt zurecht zu finden, sich einzugliedern und für ihn Neues in diese Umwelt einordnen zu können. Durch die Kinder- und Jungendliteratur kann dem jungen Schüler in altersangemessener Weise die Werte und Normen unserer Gesellschaft erklärt und ihm Probleme und Lebenssituationen verständlich vor Augen gebracht werden. Vor allem dadurch, dass sich der Schüler mit den Figuren aus der Kinder- und Jungendliteratur identifiziert, kann er einfacher die Handlungen und dargestellten Situationen auf sein eigenes Verhalten, sein Umfeld und seine Gegenwart beziehen. Zudem bildet die Kinder- und Jungendliteratur, wie schon erwähnt, einen guten Einstieg in den Umgang mit anspruchsvollen Texten bis hin zum Umgang mit hoher Literatur. Die Schüler können anhand einfacher Kinder- und Jungendlektüre lernen sich den Texten zu öffnen, sich mit ihnen auseinander zu setzen, sie zu analysieren und zu interpretieren, um sich dann Schritt für Schritt auf schwierigere Texte einzulassen.
Rolf Geißler würde jedoch direkt gegen dieses Argument angehen. Er strebt gegen die Aufnahme der einfachen Kinder- und Jungendliteratur im Unterricht, da „diese Texte eine Lesekonsumhaltung zementieren“ und deshalb schlägt er vor „dem jungem Leser [ruhig] etwas zu beißen“ zu geben, und sich nicht zu scheuen, „schwierige Bücher oder gar harte Brocken zu empfehlen“ (Rolf Geißler, 1962, 796. Zit. nach: Elisabeth Paefgen: Einführung in die Literaturdidaktik. Stuttgart u.a. 1999, 68).
Das Ergebnis einer 1995 durchgeführten Lehrerbefragung von Grund- und weiterführenden Schulen über die in ihrer Schule ausgewählte Kinder- und Jugendlektüre innerhalb der letzten zwei Jahre, zeigte, dass sich die Lehrer bei ihrer Auswahl größtenteils an den Klassikern der Moderne und der Gegenwart orientierten. Unter die am häufigsten genannten Autoren fielen zum Beispiel Peter Härtling, Erich Kästner, Astrid Lindgren und Christine Nöstlinger. Das Ergebnis bewies, dass trotz der gegebenen Freiheit in der Lektüreauswahl eine Tendenz hin zu den älteren, bewährteren Kinder- und Jugendliteratur zu beobachten war. Man könnte auch sagen der Trend bewegte sich hin zu einer kanonischen Orientierung (vgl. Elisabeth Paefgen, 1999, 72).
5. Fazit zum Thema Ist es sinnvoll die Kinder- und Jugendliteratur in den Schulkanon mit aufzunehmen?
Wie man anhand der genannten Punkte erkennen kann, war und ist die Aufnahme der Kinder- und Jugendliteratur ein schon immer umstrittengewesenes Kanondiskussionsthema.
Ich kann die Aufnahme Kinder- und Jugendliteratur in den Schulkanon für die Klassen der Primarstufe und Unterstufe aufgrund ihrer vielen positiven Auswirkungen im Schulunterricht nur befürworten.
Wie mehrfach erwähnt wurde, eignet sich die Kinder- und Jugendliteratur hervorragend als Einstiegsliteratur zum Umgang mit Texten und dient zusätzlich noch der Förderung des Leseinteresses, denn vor allem diese Förderung ist wichtig, um den jungen Schüler zum Umgang mit Texten zu motivieren. Zudem wird dem Schüler durch das Lesen zu einem besseren Abstraktions- und Ausdrucksvermögen verholfen, denn diese sind wichtige Vorrausetzungen für das Verständnis von schwierigeren Texten bis hin zum Umgang mit hoher Literatur. Hinzu kommt, dass ein gutes Ausdrucksvermögen den Schülern Vorteile beim zurecht finden in der Gesellschaft verschafft, um Interessen zu vertreten und sich ihr zu integrieren. Dazu kann die Kinder- und Jugendliteratur eine erhebliche Grundlage liefern, wobei auch für mich der pädagogische Wert der Literatur gegenüber dem ästhetischen Wert im Vordergrund steht.
Wenn man die Ästhetik als wichtiges Merkmal des Kanonisierungsprozesses aus der Kinder- und Jugendliteratur heraushält, stellt sich nun jedoch die Frage: „Kann die Kinder- und Jugendliteratur dann überhaupt noch in den literarischen Kanon mit aufgenommen werden?“
Literaturverzeichnis:
Lexika:
Schweikle, Günter; Irmgard: Kinder- und Jugendliteratur. In: Metzler Literatur Lexikon. 2. überarbeitete Auflage (1990). S.336-238
Schweikle, Günter; Irmgard: Kanon. In: Metzler Literatur Lexikon. 2. überarbeitete Auflage (1990). S.232
Zeitschriften:
Haas, Gerhard: Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht. In: PRAXIS DEUTSCH. Sonderheft (1998), S1-3
Primärliteratur:
Dahrendorf, Malte: Vom Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur. Berlin: Volk und Wissen. 1996
Paefgen, Elisabeth: Einführung in die Literaturdidaktik. Stuttgart; Weimar: J.B.Metzler. 1999
Rank, Bernhard: Kinder- und Jugendliteratur im Spannungsfeld zwischen pädagogischen und literarischen Autoritäten. In: Kinder- und Jugendliteraturforschung 1999/2000. Ewers, Hans Heino/ Nassen, Ulrich/ Richter, Karin/ Steinlein, Rüdiger. Stuttgart: J.B.Metzler. 2000. S. 79-82
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Ausarbeitung "Ist es sinnvoll die Kinder- und Jugendliteratur in den Schulkanon mit aufzunehmen?"?
Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Frage, ob es sinnvoll ist, Kinder- und Jugendliteratur in den schulischen Kanon aufzunehmen. Es werden Definitionen, Eigenschaften, historische Entwicklungen, Argumente dafür und dagegen sowie ein Fazit präsentiert.
Wie wird Kinder- und Jugendliteratur definiert?
Es gibt verschiedene Definitionen, darunter sanktionierte, spezifische und intentionale Kinder- und Jugendliteratur. Sanktionierte Literatur wird von vermittelnden Instanzen als geeignet angesehen, spezifische Literatur wurde eigens für Kinder und Jugendliche geschrieben, und intentionale Literatur ist Zielgruppenliteratur, entweder speziell für Kinder/Jugendliche geschrieben oder durch Bearbeitung entstanden.
Welche Rolle spielte Kinder- und Jugendliteratur historisch?
Die Kinder- und Jugendliteratur entwickelte sich mit dem Buchdruck. Im 18. Jahrhundert diente sie als Erziehungsinstrument, geprägt von Werten wie Fleiß und Gehorsam. Im 19. Jahrhundert nahm sie eine aufklärende Position ein. In der NS-Zeit diente sie der Vermittlung regimetreuer Werte. Nach dem Krieg gab es eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und eine Entwicklung hin zu gesellschaftskritischer und emanzipatorischer Literatur.
Welche Argumente sprechen für die Aufnahme von Kinder- und Jugendliteratur in den Schulkanon?
Sie erleichtert den Einstieg in den Umgang mit Texten, fördert das Leseinteresse, vermittelt Werte und Normen der Gesellschaft in altersgerechter Weise und kann zur Entwicklung von Abstraktions- und Ausdrucksvermögen beitragen.
Welche Argumente sprechen gegen die Aufnahme von Kinder- und Jugendliteratur in den Schulkanon?
Einige Kritiker bemängeln den oft geringen ästhetischen Wert und befürchten, dass einfache Kinder- und Jugendliteratur eine "Lesekonsumhaltung" fördert. Es wird argumentiert, dass Schüler auch mit schwierigeren Texten konfrontiert werden sollten.
Was ist der Subkanon im Kontext der Kinder- und Jugendliteratur?
Cornelia Rosebrock argumentiert, dass Kinder- und Jugendliteratur einen "Subkanon" bildet, da sie nicht einfach in den klassischen Kanon integriert werden kann. Sie habe andere Traditionen im Mischungsverhältnis von Gebrauchsorientierung und Autonomieästhetik.
Welche Autoren werden als kanonwürdig im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur angesehen?
Anna Krüger hielt vor allem die Werke von Astrid Lindgren (Karlsson vom Dach), Carlo Collodi (Pinocchios Abenteuer), Erich Kästner (Emil und die Detektive), Mark Twain (Tom Sawyers Abenteuer) und Kurt Held (Rote Zora) für kanonwürdig.
Was ist das Fazit der Ausarbeitung zur Aufnahme von Kinder- und Jugendliteratur in den Schulkanon?
Die Ausarbeitung befürwortet die Aufnahme von Kinder- und Jugendliteratur in den Schulkanon für die Klassen der Primarstufe und Unterstufe, da sie viele positive Auswirkungen im Schulunterricht hat, insbesondere hinsichtlich des Einstiegs in den Umgang mit Texten und der Förderung des Leseinteresses.
- Quote paper
- Judith Rebekka Purrio (Author), 2001, Ist es sinnvoll die Kinder- und Jugendliteratur in den Schulkanon mit aufzunehmen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107065