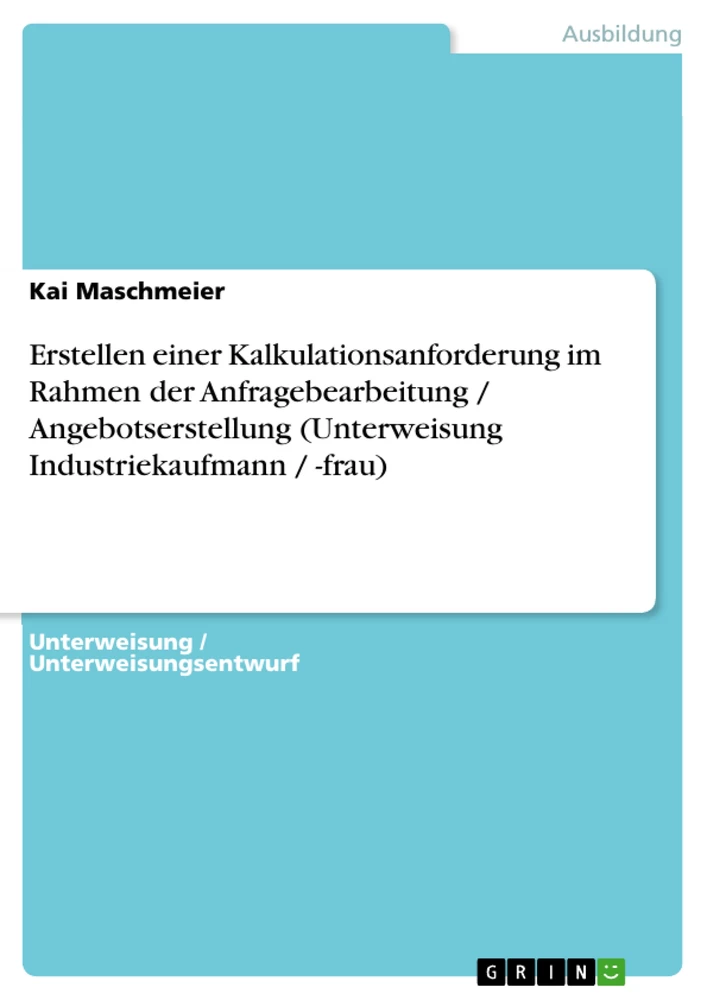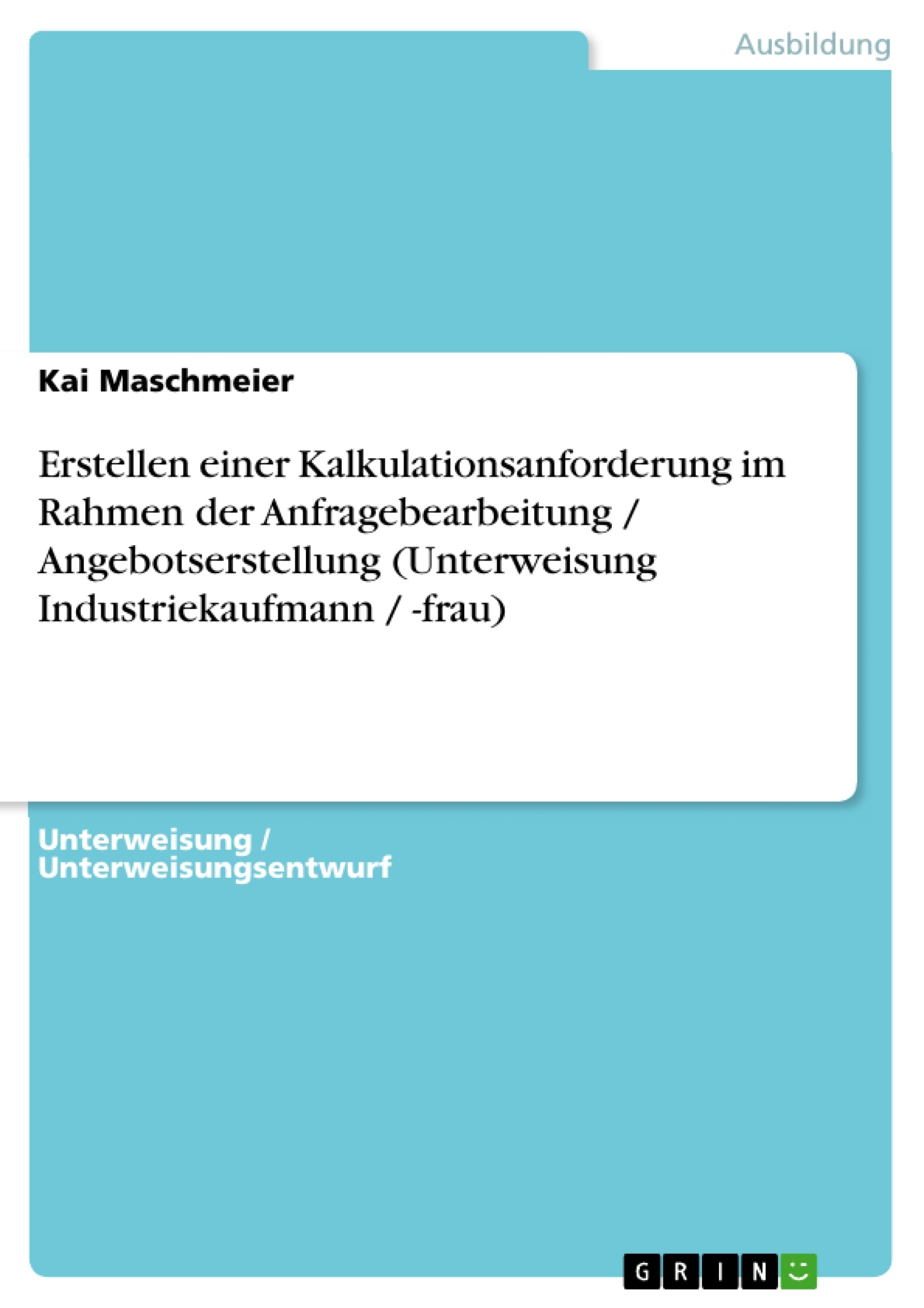Entdecken Sie die Schlüssel zum Erfolg in der Ausbildung von Industriekaufleuten! Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Ausbilder und Auszubildende, der einen klaren und strukturierten Weg durch die komplexen Anforderungen der kaufmännischen Ausbildung aufzeigt. Von der präzisen Zielgruppenanalyse über die detaillierte didaktische Analyse bis hin zur praktischen Umsetzung der 4-Stufen-Methode bietet dieses Werkzeug eine umfassende Grundlage für eine erfolgreiche und nachhaltige Ausbildung. Lernen Sie, wie Sie Lernziele effektiv definieren und kontrollieren, die verschiedenen Lernbereiche optimal nutzen und eine motivierende Lernumgebung schaffen. Der Fokus liegt dabei auf der Vermittlung von Kern- und Schlüsselqualifikationen, die für den späteren Berufserfolg unerlässlich sind. Praxisnahe Beispiele und konkrete Anleitungen, wie die Erstellung einer Kalkulationsanforderung im Vertrieb, veranschaulichen die theoretischen Konzepte und ermöglichen eine direkte Anwendung im betrieblichen Alltag. Dieses Buch unterstützt Sie dabei, Auszubildende optimal auf die Herausforderungen des Berufslebens vorzubereiten und ihre individuellen Stärken zu fördern. Es behandelt Themen wie Ausbildungsrahmenlehrplan, betrieblicher Ausbildungsplan, Lernzieltaxonomie (kognitive, affektive, psychomotorische Lernziele), Lernzielkontrolle, kognitiver Lernbereich, affektiver Lernbereich, psychomotorischer Lernbereich, Organisation der Ausbildung, Ausbildungsmittel, Medien, Arbeitssicherheit, Unfallverhütungsvorschriften und die Kontrolle des Ausbildungserfolgs. Ob Berufsschullehrer, Ausbilder im Betrieb oder ambitionierter Auszubildender – dieses Buch bietet wertvolle Einblicke und praktische Hilfestellungen, um das volle Potenzial der kaufmännischen Ausbildung auszuschöpfen. Werden Sie zum Architekten erfolgreicher Karrieren und gestalten Sie die Zukunft der Industrie aktiv mit! Tauchen Sie ein in die Welt der modernen Ausbildungsmethoden und entdecken Sie, wie Sie Ihre Auszubildenden zu kompetenten und engagierten Fachkräften entwickeln können. Dieses Buch ist Ihr Kompass im Ausbildungsdschungel und führt Sie sicher zum Ziel: der erfolgreichen Ausbildung von Industriekaufleuten.
Inhaltsverzeichnis
1. Zielgruppe Blatt
1.1 Schulische Vorbildung
1.2 Alter
1.3 Ausbildungsstand
2. Didaktische Analyse
2.1 Ausbildungsrahmenlehrplan
2.2 Betrieblicher Ausbildungsplan
2.3 Fachlicher Inhalt
2.4 Bedeutung für die Auszubildende
2.5 Thema der vorausgegangenen Unterweisung
2.6 Thema der nachfolgenden Unterweisung
2.7 Zusammenhang mit dem Berufsschulunterricht
3. Lernziele
3.1 Leitlernziel
3.2 Richtlernziel
3.3 Groblernziel
3.4 Feinlernziel
3.4.1 Kognitive Feinlernziele
3.4.2 Affektive Feinlernziele
3.4.3 Psychomotorische Feinlernziele
3.5 Qualifikation
3.5.1 Kernqualifikation
3.5.2 Schlüsselqualifikation
3.6 Lernzielkontrolle
4. Lernbereiche Blatt
4.1 Der kognitive Lernbereich
4.2 Der affektive Lernbereich
4.3 Der psychomotorische Lernbereich
5. Lernziele nach der Lernzielebenen
6. Organisation
6.1 Ort der Unterweisung
6.2 Ausbildungsmittel
6.3 Medien
6.4 Arbeitssicherheit / Unfallverhütungsvorschriften
7. Unterweisungsverlauf
7.1 1. Stufe:Vorbereiten
7.2 2. Stufe:Vormachen
7.3 3. Stufe:Nachmachen
7.4 4. Stufe:Üben und Transfer
8. Kontrolle des Ausbildungserfolges
8.1 Selbstkontrolle durch die Auszubildende
8.2 Fremdkontrolle durch den Ausbilder
9. Literatur- und Quellenangaben
1. Zielgruppe
1.1 Schulische Vorbildung
Die Auszubildende hat die Sekundarstufe II am Gymnasium mit der Allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen.
1.2 Alter
Die Auszubildende ist 20 Jahre alt und befindet sich in der Adoleszens ( Nachpubertät). Es sind keine Hinweise auf retardiertes oder akzeleriertes Verhalten erkennbar.
1.3 Ausbildungsstand
Die Auszubildende befindet sich im 2. Halbjahr des 2. Ausbildungsjahres zum Industriekaufmann. Bevor sie gemäß Ausbildungsplan dem Vertrieb zugewiesen wurde, war sie bereits in der Produktionswirtschaft, Materialwirtschaft und im Rechnungswesen eingesetzt. Die Auszubildende verfügt somit schon über einen relativ guten Überblick über die Arbeitsabläufe im Unternehmen und verfügt über gute Kenntnisse der eingesetzten Standardsoftware (SAP). Aus der in unserem Unternehmen zusätzlich zu dem Berichtsheft geführten Ausbildungsfibel ist ersichtlich, dass die Auszubildende in den vorangegangenen Fachabteilungen die gesetzten Lernziele ohne größere Schwierigkeiten erreicht hat.
2. Didaktische Analyse
2.1 Ausbildungsrahmenlehrplan
Der Ausbildungsrahmenlehrplan sieht für eine Auszubildende im 2. Halbjahr des 2. Ausbildungsjahres die Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen des Berufsbildteils Verkauf vor.
2.2 Betrieblicher Ausbildungsplan
Der betriebliche Ausbildungsplan wurde nach den sachlichen und zeitlichen Vorgaben des Ausbildungsrahmenlehrplanes erstellt. Um eine größere Anzahl von Auszubildenden in den einzelnen Fachabteilungen auszubilden, wird zuweilen aus betrieblichen Gründen von der zeitlichen Vorgabe abgewichen. Der Ausbildungsplan wird individuell auf den Auszubildenden zugeschnitten. Die Auszubildende wird zur Vermittlung der unter Punkt 2.1 beschriebenen Fertigkeiten und Kenntnisse für den Zeitraum von 10 Wochen in der Ausbildungsabteilung Verkauf V43 eingesetzt.
2.3 Fachlicher Inhalt
Im Rahmen der o.g. Teile des Ausbildungsberufsbildes (Ausbildungsrahmenlehrplan § 3 Nr. 4.3 b / e) wurde die Bearbeitung einer Kalkulationsanforderung herausgegriffen, um der Auszubildenden die vorbereitenden Arbeiten bei der Erstellung eines Angebotes zu erläutern.
2.4 Bedeutung für die Auszubildende
Die Auszubildende soll befähigt werden, selbständig eine Kalkulationsanforderung zu erstellen. Nach Abschluß der Unterweisung kann die Auszubildende neben der manuellen Erstellung der Anforderung auch die Einordnung dieser Teilhandlung in den Gesamtprozess der Angebotserstellung vornehmen. Die Kalkulationsanforderung stellt zudem eine gute Übung dar, um die technischen Details aus den nicht standardisierten Anfragen herauszufiltern und in eine allgemein verständliche Form zu bringen. Eine schnelle Erfassung dieser Daten ist angesichts der hohen Anzahl der Anfragen, die täglich eingehen, von großer Bedeutung. Durch die eigenständige Arbeit und das umgehende Feedback der Abteilung Controlling erhält die Auszubildende genügend Informationen, um nachfolgend ein (einfaches) Angebot zu erstellen.
2.5 Thema der vorausgegangenen Unterweisung
Im Vorfeld dieser Unterweisung hat die Auszubildende zunächst die eingegangenen Anfragen entgegengenommen und, mit Hilfestellung, analysiert. Bei dieser Unterscheidung ging es hauptsächlich darum, anhand der Kundeninformationen eine Entscheidung zu treffen, ob eine Kostenkalkulation vorgenommen werden muss oder ob der sogenannte Standardkostenkatalog ausreicht. Es wurde zudem darauf verwiesen, dass dieser Arbeitsprozess durch die ISO - Zertifizierung 9001 ff genau vorgegeben ist. Die Auszubildende hatte die Möglichkeit, unter Aufsicht, eine eigene Entscheidung für oder gegen die manuelle Kalkulation zu treffen. Anhand diverser Fallbeispiele wurde dieser Prozess weiter geübt. Die heutige Unterweisung schließt nahtlos an eine positive Entscheidung an.
2.6 Thema der nachfolgenden Unterweisung
Nach der Rückmeldung der Kosten aus der Fachabteilung Controlling, soll die Auszubildende anhand der ermittelten Kosten und der von mir vorgegebenen Erlöserwartungen einen Preis für das angefragte Produkt berechnen und in ein Angebotsformular einsetzen. Nach weiteren vorbereitenden Arbeiten soll die Auszubildende in der Lage sein, selbständig und eigenverantwortlich (soweit gesetzlich zulässig) ein Angebot zu erstellen.
2.7 Zusammenhang mit dem Berufsschulunterricht
Die Bedeutung der in der Berufsschule erworbenen Kenntnisse in der Kosten - und Leistungsrechnung kann an diesem Beispiel verdeutlicht werden. Eine engere Kooperation zwischen der Schule und dem Betrieb ist wegen der unterschiedlichen Struktur der ausbildenden Betriebe, deren Auszubildende die Klasse besuchen, oft schwierig. Die didaktische Parallelität und die Vor- und Nachbearbeitung der Lerninhalte ist aus diesem Grund nicht optimal realisiert. Der Themenbereich Absatzwirtschaft wird aber im Berufsschulunterricht zeitnah behandelt, sodass ein Bezug zur Praxis in unserem Unternehmen gewährleistet ist.
3. Lernziele
3.1 Leitlernziel
Die Auszubildende soll am Ende ihrer Ausbildung über alle Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, die es ihr ermöglichen den Beruf des Industriekaufmanns selbständig und sicher auszuüben. Zusätzlich soll sich die Auszubildende als ein integrierter Bestandteil eines Teams ansehen und mit den Mitgliedern nach außen und innen harmonisch zusammenarbeiten.
3.2 Richtlernziel
Die Auszubildende kennt und beherrscht die wesentlichen Abläufe der Absatzwirtschaft bzw. des Verkaufs und kennt und beherrscht die zur Verfügung stehenden Arbeitsmittel.
3.3 Groblernziel
Die Auszubildende soll befähigt sein, Anfragen und Angebote im Rahmen der Ablauforganisation im Verkauf zu bearbeiten.
3.4 Feinlernziel
- Die Auszubildende ist in der Lage, unwichtige von wichtigen Informationen einer Anfrage zu unterscheiden und diese Daten in eine normierte Form zu bringen.
- Die Auszubildende kann die Informationen aus der Kundenanfrage anhand von Tabellen in Schlüsselnummern bzw. Fachbegriffe übersetzen und formal richtig in das Formular übertragen.
- Die Auszubildende kann auf Anforderung fehlende Daten vom Kunden einholen.
- Sie kann die erworbenen Kenntnisse aus der Fachabteilung Produktionswirtschaft anwenden und ggf. ausbauen.
3.4.1 Kognitive Feinlernziele
In dieser Unterweisung stehen die kognitiven Feinlernziele eindeutig im Vordergrund (siehe Punkt 3.4).
3.4.2 Affektive Feinlernziele
Im Bereich der Informationsbeschaffung vom Kunden werden zum Teil auch affektive Feinlernziele gesetzt, setzt doch der Umgang mit Kunden eine positive Grundeinstellung, Aufgeschlossenheit und Organisationstalent voraus. Allerdings stehen die affektiven Feinlernziele bei dieser Unterweisung nicht im Vordergrund und werden hier nicht ausformuliert.
3.4.3 Psychomotorische Feinlernziele
Bei dieser Unterweisung werden psychomotorische Fähigkeiten nicht explizit geschult. Die psychomotorischen Feinlernziele werden nicht ausformuliert. Die handschriftliche Umsetzung wird bei Auszubildenden mit diesem Bildungsstand vorausgesetzt.
3.5 Qualifikation
3.5.1. Kernqualifikation
Im Erreichen der kognitiven Feinlernziele liegt die Kernqualifikation der Auszubildenden.
3.5.2 Schlüsselqualifikation
Die Schlüsselqualifikationen sind eng mit den affektiven Feinlernzielen verbunden, wobei die Förderung der beruflichen und sozialen Handlungskompetenz der Auszubildenden im Vordergrund steht.
3.6 Lernzielkontrolle
Die Lernzielkontrolle dient der Reflexion der gerade vollzogenen Übung und gibt sowohl dem Ausbilder als auch der Auszubildenden eine Rückmeldung über den Erfolg der Unterweisung. Die Lernzielkontrolle findet an geeigneter Stelle der Unterweisung statt.
4. Lernbereiche
4.1 Der kognitive Lernbereich
Der kognitive Lernbereich bezieht sich auf den Bereich des Erinnerns (Kennen, Reproduzieren) von Wissen und auf die Erweiterung intellektueller Fähigkeiten und Fertigkeiten. Er beschreibt ein Verhalten, das den Wahrnehmungs-, Gedächtnis- und Denkbereich des Menschen betrifft. Der kognitive Lernbereich reicht vom einfachen Aufsagen eines Stoffes bis zu sehr originellen und kreativen Wegen, neue Ideen und Materialien zu kombinieren und zusammenzusetzen.
4.2 Der affektive Lernbereich
Der affektive Lernbereich bezieht sich auf Veränderungen von Interessenlagen, auf die Bereitschaft, etwas zu tun oder zu denken, auf Einstellungen und Werte und auf die Entwicklung von Werthaltungen. Er beschreibt ein Verhalten, das den Bereich der Triebe, Interessen, Einstellungen, Gefühle und Wertungen betrifft.
4.3 Der psychomotorische Lernbereich
Der psychomotorische Lernbereich (d.h. Lernen im Bereich von erwerbbaren Fertigkeiten, die zum Teil auch sichtbar sind) beschreibt psychische Fähigkeiten und Fertigkeiten der Auszubildenden, z. B. handwerkliche und technische Fähigkeiten, Handschrift, Sprache.
5 Lernziele nach der Lernzielebene (Lernziele nach dem Schwierigkeitsgrad)
Nach dem Ordnungssystem des DIHT sind in dieser Unterweisung folgende Lernzielstufen angesprochen:
- Reproduktion
Die Auszubildende hat die Bedeutung der Informationen einer Anfrage verstanden und kann diese richtig wiedergeben.
- Reorganisation
Die Auszubildende ist in der Lage, die Informationen in verarbeitbare Schlüsselnummern umzusetzen und diese richtig in das Formular zu übertragen.
- Transfer
Die Auszubildende kann bei neuen Anfragen anhand der Ihr vorliegenden Informationen entscheiden und den Inhalt der heutigen Unterweisung anwenden.
- Problemlösendes Denken / Kreativität
Diese Stufe wird in der vorliegenden Unterweisung nicht erreicht. Erst bei der freien Angebotserstellung in der nachfolgenden Unterweisung ist dies möglich.
6. Organisation
6.1 Ort der Unterweisung
Als Lernort wird der Ausbildungsplatz im Büro Verkauf V43 gewählt, da dieser auch unter den Aspekten der ergonomischen Vorschriften und der Arbeitsstättenrichtlinien für die Durchführung der Unterweisung geeignet ist.
6.2 Ausbildungsmittel
Die Auszubildende hat an ihrem Arbeitsplatz einen eigenen Schreibtisch mit der notwendigen bürotechnischen Ausrüstung.
Es werden eingesetzt:
- Kundenanfragen / Anfragemuster
- Lieferprogramm in Auszügen
- Kundendatenbank in Auszügen
- Schreibutensilien
- Übungsformulare
- Muster für das Ausbildungsnachweisheft
6.3 Medien
Da die Möglichkeiten am Lernort sehr eingeschränkt sind, ist die Auswahl der Medien auf die Übungsformulare und das Musterformular beschränkt.
6.4 Arbeitssicherheit / Unfallverhütungsvorschriften
Im Vorfeld dieser Unterweisung wird auf eine eigene Belehrung verzichtet, da die Auszubildenden in unserem Unternehmen im Vorfeld ihrer Einsätze in den Fachabteilungen eine entsprechende Unterweisung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit erhalten.
7. Unterweisungsverlauf
Die Unterweisung wird nach der 4-Stufen-Methode der Arbeitsunterweisung durchgeführt.
7.1 1. Stufe: Vorbereiten
Da die Auszubildende schon einige Zeit im Verkauf eingesetzt ist, entfällt eine Vorstellung. Die Auszubildende ist generell neuen Aufgaben gegenüber aufgeschlossen und neugierig. Durch die von ihr gefällte Entscheidung für eine Kostenkalkulation, gestaltet sich die Motivation sehr einfach. Die Auszubildende wird zunächst in einer kurzen Zusammenfassung der letzten Unterweisung an die wesentlichen Details der bereits eingegangenen Anfragen erinnert und ihr wird die Bedeutung der Kalkulation für die spätere Preisfindung innerhalb des Angebotes dargestellt. Im Anschluss daran werden der Auszubildenden die eingesetzten Lehrmittel vorgestellt und ausgehändigt.
7.2 2. Stufe: Vormachen
Zunächst erläutere ich der Auszubildenden, welche Daten in den Formularkopf einzutragen sind. Anhand des Musterbogens und meiner Ausführungen ist ersichtlich, dass in die Felder 1 -5 der Kalkulationsanforderung der Name des Verkäufers, Abteilungsname, Telefon- und Faxnummer und das Eingangsdatum der Anfrage eingetragen werden muss.
Im nächsten Schritt gehe ich anhand der Musteranfrage auf die wichtigen Merkmale der Anfrage ein und erläutere deren Umsetzung in Schlüsselnummern anhand des Lieferprogramms.
6. Kunde
Anhand des Absenders auf der Anfrage ist der Kundenname klar ersichtlich. Anhand der Kundenkartei wird die entsprechende Kundenummer herausgesucht und in das Formular übertragen. Eine Adressangabe ist nicht notwendig.
7. Produkt
Aus der Anfrage ist die Information über Warmband oder Kaltband zu entnehmen und zu übertragen.
8. Werkstoff
Der gewünschte Werkstoff wird ermittelt und die Werkstoffnummer eingetragen.
9. Herstellverfahren
Das Herstellungsverfahren, das der Kunde wünscht, muss anhand des Lieferprogramms in eine Schlüsselnummer übersetzt werden.
Diese wird eingetragen.
10. - 12. Produkt-Abmessungen
Die gewünschten Abmessungen werden von der Anfrage in das Formular übertragen. An dem Merkmal Länge ist ersichtlich, ob es sich um Bleche oder Bänder handelt.
13. Gewicht VPE
Hier wird das vom Kunden gewünschte Gewicht / je Liefereinheit eingetragen.
14. Lieferzeitraum
In dieses Feld wird der vom Kunden gewünschte Lieferzeitraum eingetragen. Ein Kundenwunschdatum muss zu der entsprechenden Geschäftsjahresperiode zugeordnet werden. Beispiel: 01.10.2002 entspricht dem I. Quartal 2003.
15. -16. Folie
Sollte der Kunde eine Folie wünschen, wird diese hier vermerkt. Ich erkläre, dass die Standardausführung immer einseitig foliert wird, es sei denn, der Kunde wünscht explizit eine beidseitige Folierung. Der Folientyp wird aus dem Lieferprogramm entnommen und die Typnummer übertragen.
17. Verwendungszweck
Sollte der Verwendungszweck in der Anfrage ein anderer sein als die Informationen aus der Kundenkartei, so wird dieser extra vermerkt. Ansonsten braucht dieses Feld nicht ausgefüllt zu werden. Die benötigte Information ergibt sich aus dem Kundenstamm.
18. Geplante Liefermenge
In dieses Feld wird die Gesamtmenge, die der Kunde benötigt, eingetragen. An dieser Stelle erkläre ich den Unterschied zwischen Losgröße (Punkt 13) und Liefermenge.
Die Auszubildende erhält nun die Gelegenheit, offene Fragen zu klären und Missverständnisse auszuräumen.
7.3 3. Stufe: Nachmachen
Die Auszubildende hat nun die Aufgabe, die vorgeführte Kalkulationsanforderung anhand einer Anfrage der Phantasia GmbH, nachzumachen. Sie soll zunächst die vorgemachten Schritte langsam ausführen und dann immer flüssiger nachvollziehen. Bei der Ausführung soll die Auszubildende die ausgeführten Schritte erklären, um sie für sich selbst und für mich nachvollziehbar zu machen. Ich beobachte die Ausführung und korrigiere evtl. auftretende Fehler. Sollten größere Verständnisprobleme auftreten, gebe ich Hilfestellung und ermutige die Auszubildende bei unsicheren Handlungen. Richtige Handlungen werden ausdrücklich gelobt.
7.4 4. Stufe: Üben und Transfer
Die Auszubildende bekommt nun eine Anfragen, die z.T. von der ursprünglichen Aufgabe abweicht. Die Unterschiede liegen im strukturellen Aufbau der Anfrage und der unterschiedlichen Materialbezeichnung. Anhand dieser Angaben sollen nun eine eigene Kalkulationsanforderung selbständig und zügig bearbeitet werden. Bei kleineren Fehlern schreite ich auch hier noch ein und gebe Hilfestellungen, ziehe mich aber nach und nach immer weiter zurück. Die Ergebnisse werden im Anschluß an die Übungen kontrolliert (vgl. Punkt 8) und ich bespreche die weitere Bearbeitung der Kalkulationsanforderung bzw. deren Verlauf in den prozessbeteiligten Fachabteilungen. Da die Auszubildende noch im Vertriebscontrolling eingesetzt wird, ist eine Fortsetzung des Prozesses durch sie selbst denkbar. Abschließend stelle ich den Bezug zu der nachfolgenden Unterweisung her, indem ich die Bedeutung der kalkulierten Kosten für die anschließende Preisfindung innerhalb des Angebotes herausstelle.
Zudem erkläre ich, dass für diese Vorgänge keine Unterschriftenregelung existiert und sie die Formulare formlos an das Controlling senden kann. Die Auszubildende erfährt in abschließenden Sätzen, wo ich Ihre Stärken und ggf. Schwächen sehe und stelle dabei besonders die positiven Eigenschaften in den Vordergrund.
8. Kontrolle des Ausbildungserfolges
8.1 Selbstkontrolle durch die Auszubildende
Die Selbstkontrolle erfolgt, um die eigene Selbsteinschätzung zu fördern und eventuell aufgetretene Fehler selbständig zu erkennen und zu korrigieren. Auf diese Weise erhält die Auszubildende die Bestätigung, eigenständig und verantwortlich arbeiten zu können.
8.2 Fremdkontrolle durch den Ausbilder
Die Fremdkontrolle wird kontinuierlich, d. h. während der ganzen Unterweisung durchgeführt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei sicherlich in Stufe 3. Die Fremdkontrolle dient primär nicht der Bewertung der Auszubildenden, sondern der Verbesserung des Lernerfolges. Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine konstruktive Kritik, die die Auszubildende nicht erschreckt, sondern sie motiviert. Alle positiven Ergebnisse werden ausdrücklich hervorgehoben.
9. Literatur- und Quellenangaben
Müller u.a. (Hrsg.); Der Weg zur Ausbilderprüfung, 1997
Marion Pausch, Jan Beher und Ralph Buse; Lernzieldimensionierung und - taxonomisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele, wichtige Themen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es scheint sich um einen Ausbildungsleitfaden oder ein Skript für eine Unterweisung zu handeln.
An wen richtet sich dieses Dokument?
Die Zielgruppe ist eine Auszubildende, konkret eine Industriekauffrau im 2. Halbjahr des 2. Ausbildungsjahres, die die Sekundarstufe II am Gymnasium mit der Allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen hat und 20 Jahre alt ist.
Welche schulische Vorbildung wird vorausgesetzt?
Die Auszubildende soll die Sekundarstufe II am Gymnasium mit der Allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen haben.
In welchem Ausbildungsstand befindet sich die Auszubildende?
Die Auszubildende befindet sich im 2. Halbjahr des 2. Ausbildungsjahres zur Industriekauffrau.
Was sind die didaktischen Grundlagen dieser Unterweisung?
Die Unterweisung orientiert sich am Ausbildungsrahmenlehrplan, dem betrieblichen Ausbildungsplan und dem fachlichen Inhalt. Sie berücksichtigt die Bedeutung des Themas für die Auszubildende, das Thema der vorausgegangenen und nachfolgenden Unterweisung sowie den Zusammenhang mit dem Berufsschulunterricht.
Was ist das übergeordnete Ziel der Ausbildung?
Das Leitlernziel ist, dass die Auszubildende am Ende ihrer Ausbildung über alle Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt, um den Beruf des Industriekaufmanns selbständig und sicher auszuüben und sich als integrierter Bestandteil eines Teams zu sehen.
Welche Lernbereiche werden angesprochen?
Die Unterweisung berücksichtigt den kognitiven, affektiven und psychomotorischen Lernbereich.
Wie ist die Unterweisung aufgebaut?
Die Unterweisung folgt der 4-Stufen-Methode der Arbeitsunterweisung: Vorbereiten, Vormachen, Nachmachen, Üben und Transfer.
Wie erfolgt die Kontrolle des Ausbildungserfolges?
Die Kontrolle des Ausbildungserfolges erfolgt durch Selbstkontrolle der Auszubildenden und Fremdkontrolle durch den Ausbilder.
Welche Literatur und Quellen wurden verwendet?
Die Literatur- und Quellenangaben umfassen unter anderem "Der Weg zur Ausbilderprüfung", "Lernzieldimensionierung und -taxonomisierung" und Mitschriften aus dem Vorbereitungslehrgang.
Was ist das Thema der aktuellen Unterweisung?
Die aktuelle Unterweisung befasst sich mit der Bearbeitung einer Kalkulationsanforderung als vorbereitende Arbeit bei der Erstellung eines Angebotes im Vertrieb.
Welche Feinlernziele werden angestrebt?
Die Auszubildende soll in der Lage sein, unwichtige von wichtigen Informationen einer Anfrage zu unterscheiden, diese Daten in eine normierte Form zu bringen, die Informationen aus der Kundenanfrage anhand von Tabellen in Schlüsselnummern bzw. Fachbegriffe zu übersetzen und formal richtig in das Formular zu übertragen, auf Anforderung fehlende Daten vom Kunden einzuholen und die erworbenen Kenntnisse aus der Fachabteilung Produktionswirtschaft anzuwenden und ggf. auszubauen.
Welche Medien werden während der Unterweisung eingesetzt?
Es werden Kundenanfragen/Anfragemuster, ein Lieferprogramm in Auszügen, eine Kundendatenbank in Auszügen, Schreibutensilien, Übungsformulare und Muster für das Ausbildungsnachweisheft eingesetzt.
- Quote paper
- Kai Maschmeier (Author), 2002, Erstellen einer Kalkulationsanforderung im Rahmen der Anfragebearbeitung / Angebotserstellung (Unterweisung Industriekaufmann / -frau), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107040