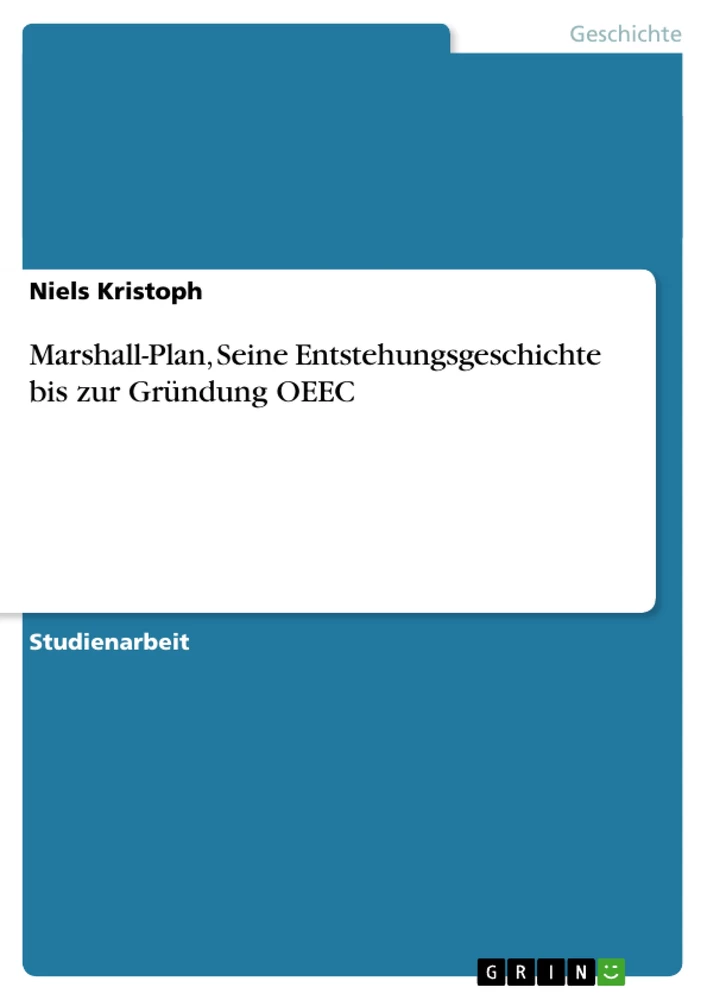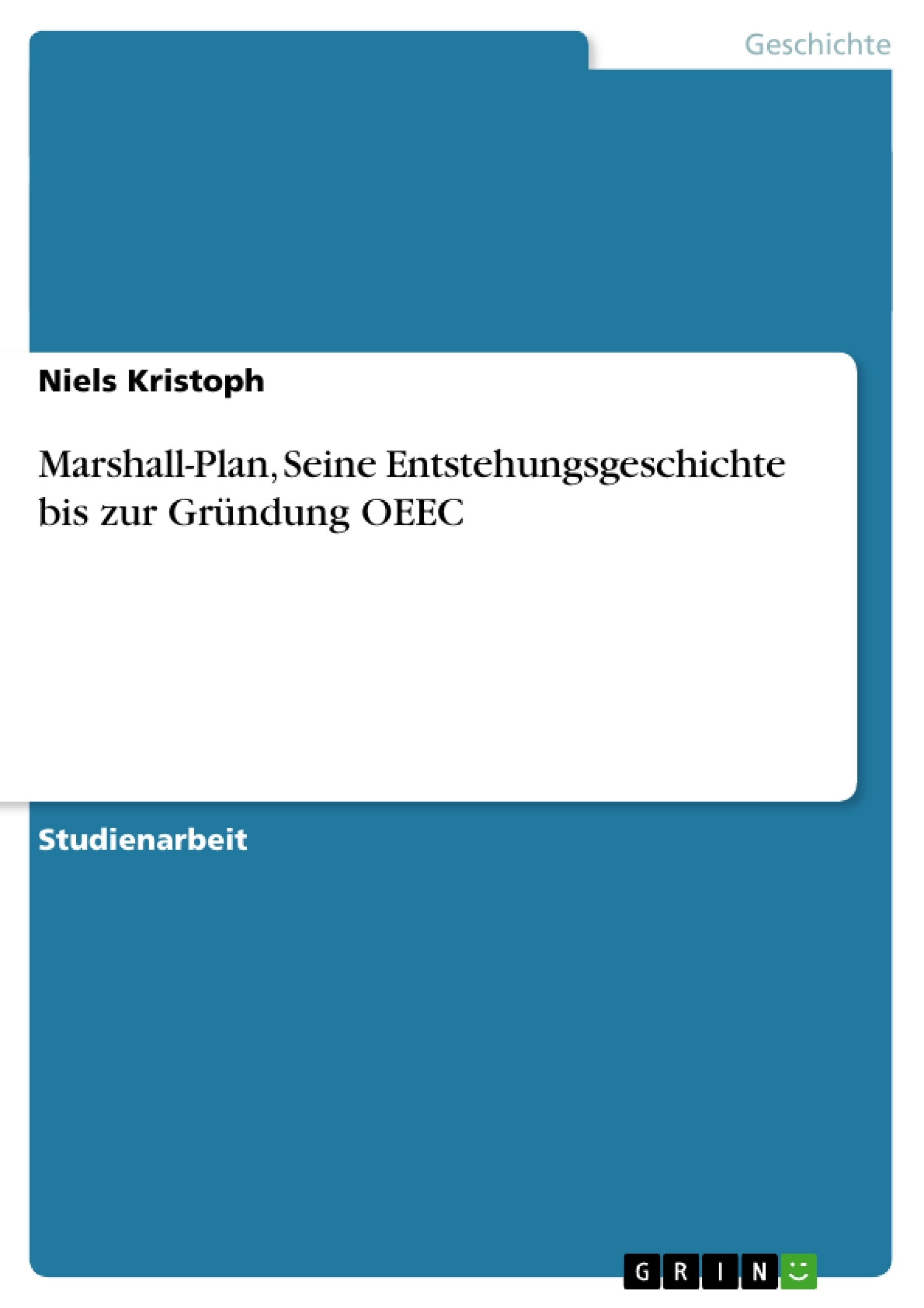Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die amerikanische Außenwirtschaftspolitik 1944-1947
3. Die Entstehung des Marshall-Plan
3. 1. Auf dem Weg zum Europ ä ischen Wiederaufbauprogramm
3. 2. Marshalls Rede an der Harvard Universit ä t
4. Gründung der OEEC
4. 1. Der Entstehungsprozess der CEEC
4. 2. Die Institutionalisierung der CEEC in Form der OEEC
5. Hintergrund der amerikanischen Investitionen
5. 1. Europa als amerikanischer Absatzmarkt
5. 2. Deutschland als Zentrum US-Amerikanischer Europapolitik
5. 3. Das ERP im Kontext des Kalten Krieges
6. Ergebnisse
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
John Gimbel schreibt in einem Artikel über die Entstehung des Marshallplans, sein Namensgeber hätte wiederholt bestritten, er hätte jemals einen Plan gehabt, als die berühmte Rede an der Harvard- Universität gehalten wurde.1 Es war vielmehr ein grobes Grundgerüst einer Konstruktion, die Europa aus der wirtschaftlichen Misere herausführen sollte. Dabei ist es vielleicht wichtiger zu fragen, welchem eigentlichen Ziel folgte die amerikanische Strategie und aus welchem Kontext heraus entstand sie?
Der Soziologe Franz Schumann beschuldigte den Marshallplan in seiner zentralen Zielausrichtung, den Kapitalismus in Europa verteidigen zu wollen, um das Weltmarktsystem zu beschützen und die exponierte Stellung der USA in diesem zu sichern. Von Seiten der Sowjetunion war gar zu hören, die Vereinigten Staaten versuchten die nationale Souveränität in Europa zu zerstören, um politische und ökonomische Kontrolle zu erlangen.2
Was aber waren die Tatsächlichen Beweggründe für die Ausarbeitung eines zielgerichteten Programms, welches nicht nur finanzielle Hilfe beinhaltete, sondern auch den Europäern ein Stück Selbstverantwortung in Form der CEEC und OEEC in die Hände legte? Charles Bohlen, ein Architekt des Marshallplans, beschrieb die amerikanischen, zweckdienlichen Absichten vor Publikum, indem er konstatierte: “The countries of Western and Central Europe represent...[together] the only single [unit] of industriel and technical Skill capable of equalling that of this country and of far outshadowing-thanks be to God-that of the Soviet Union […] If we fail to seize this chance to keep the area out of their hands, we will suffer the single greatest deterioration in our international position that our history has ever known. ” 3 Er erkannte also, dass in der Bündelung der europäischen, wirtschaftlichen Kräfte, das Geheimnis des Erfolgs lag. Gleichzeitig bestätigte er die Zielsetzung, die internationale Machtposition der USA sichern zu müssen.
Dabei ist es wichtig zu beleuchten, unter welchen Vorraussetzungen ein Programm zur Rekonstruktion Europas entstand, welche Rahmenbedingen geschaffen wurden und welche Zielsetzungen, bzw. Hintergründe den Verlauf bestimmten. Aufgrund des Umfangs dieser Arbeit, muss bei Betrachtung des ERP und OEEC ein Zeitlicher Rahmen von 1944 bis 1947 gesetzt werden.
2. Die amerikanische Außenwirtschaftspolitik 1944-1947
Die europäische Wirtschaft, die ein Viertel der globalen Industrieproduktion und 40 % des Welthandels ausmachte, lag nach 1945 danieder.4 Die europäische Handelsflotte war zerstört und die Auslandsinvestitionen liquidiert.5 So wurde das bereits vor dem Zweiten Weltkrieg existierende Übergewicht der amerikanischen Wirtschaftsmacht voluminöser und es setzte ein “Verantwortungsgefühl” ein, die Weltwirtschaft in kontrollierte, stabile Bahnen zu bringen. Der Schwerpunkt der amerikanischen Außenwirtschaftspolitik in der Nachkriegszeit wurde auf eine Beseitigung des Elends in Europa und den Aufbau einer sicheren, konsolidierten Weltwirtschaft gesetzt.6 Dabei stand das Leitbild dem diese Politik folgte, der Liberalismus der Vorkriegsjahre bzw. die Open-Door Policy7 , im direkten Gegensatz zum Merkantilismus, der national bestimmten maximalen Akkumulation, um einseitige Handelsvorteile zu erzielen.8 Konkret bedeutete eine Umsetzung der liberalen wirtschaftspolitischen Theorie, den freien Verkehr und Austausch von Waren unter den leistungsfähigen Industriestaaten, losgelöst von Diskriminierung und Handelsbeschränkungen, sowie die Abnahme von Rohstoffen aus den Haupterzeugerländern.9 Das Ganze musste in ein wiederhergestelltes, multilaterales Welthandelssystem eingebettet werden, dem auch die Feindstaaten zugehörig sein sollten.10 Dies beförderte einen Wandel der amerikanischen Außenwirtschaftspolitik, der mit der Ratifizierung der Atlantik-Charta11 durch Franklin Roosevelt sowie Winston Churchill begann und mit dem im Februar 1942 abgeschlossenen Lend-Lease-Abkommen seine Fortsetzung fand. In Artikel VII wurden die Vertragspartner verpflichtet, jegliche Form von Handelsdiskriminierung zu beseitigen und alle Formen von Handelsbarrieren zu beseitigen.12 In der sogenannten “Bretton-Woods-Periode” ersuchten die Vereinigten Staaten nun endgültig ihre Marktpolitischen Vorstellungen zu verwirklichen.13
Im Sommer 1944 luden die USA zu der Konferenz, die eine Neuordnung der kriegsgeplagten Weltwirtschaft herbeiführen sollte. Dieses Zusammenkommen, welches neue wirtschaftliche Strukturen unter bewusster Abkehr vom ökonomischen Nationalismus der 1930er Jahre14 entwickeln sollte, brachte internationale Währungs- und
Wirtschaftsabkommen hervor, die als Basis für alle kommenden westlichen Außenwirtschaftsbeziehungen dienten. Die internationalen Wirtschaftsbeziehungen der Nachkriegszeit wurden so durch die Ergebnisse der Konferenz maßgeblich beeinflusst.15
Ein bedeutsames Ziel, das in Bretton Woods erreicht werden sollte, war die Klärung der Währungs-, Handels-, und Zahlungsfragen, die im Ergebnis in einer offenen Welthandelsordnung münden sollten. Anhand dieser Aufgabe gelangten die Teilnehmerstaaten zu Ergebnissen, die sich in zwei neu gegründeten, sich ergänzenden Institutionen, manifestierten. Mit dem Auftrag ausgestattet, die internationalen Währungsverhältnisse zu ordnen, bzw. als Kodex guten wirtschaftlichen Verhaltens zu dienen, wurde zum einen die Internationale Bank f ü r Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank) ins Leben gerufen, um den Wiederaufbau Europas und der Entwicklungsländer (Afrika, Asien und Lateinamerika) möglich zu machen. Explizit sollte das wirtschaftliche Wachstum gefördert und Kapital bereitgestellt werden, um eine sozialistische Wirtschaftslenkung für die betroffenen Staaten unnötig zu machen. Das finanzielle Volumen der Weltbank, welches sich auf 7, 6 Milliarden US-Dollar beziffern ließ, wurde hier ausschließlich von den Vereinigten Staaten bereitgestellt.16
Die zweite auf den Weg gebrachte Institution war, der mit einem Grundkapital von 7, 3 Milliarden US-Dollar ausgestattete, Internationale W ä hrungsfonds. Seine Aufgabe war und ist es, die mit Handelsdefiziten belasteten Nationen zu stützen, kurzfristige Schwankungen in den Währungsrelationen auszugleichen, bzw. Währungen, die unter dem Druck interner wirtschaftlicher Probleme stehen, zu stabilisieren. Hierdurch sollte eine Handels- und Währungskrise vermieden werden.
Mit dem Hintergrund, über zwei Drittel der Welt-Goldreserven zu verfügen, bestanden die amerikanischen Vertreter weiterhin vehement darauf, das Weltwirtschaftssystem auf Gold, die Leitwährung auf dem US-Dollar17 aufzubauen, sowie eine Goldeinlösungsgarantie zu gewährleisten.18 Der IWF sollte die zentrale Einrichtung für dieses Währungssystem sein. Somit standen im Endeffekt IBRD und IWF unter Kontrolle der USA, die nun ihre bereits schon existierende finanzielle und wirtschaftliche Führungsmacht, vertraglich festsetzen konnten. Ein Verhältnis, das von den Vereinigten Staaten durchaus so angedacht war, insbesondere auch “for reasons of pure national self-interest”, wie es Außenminister Hull formulierte.19
Nachdem 28 Staaten die Beschlüsse ratifiziert hatten, konnten beide Institutionen ihre Funktion ab dem 27. Dezember 1945 wahrnehmen. Die Sowjetunion, sowie die restlichen kommunistischen Regierungen, lehnten eine Unterzeichnung des Vertrages von Bretton Woods ab und gründeten 1949 aus der wirtschaftlichen Isolation heraus mit dem Rat f ü r gegenseitige Wirtschaftshilfe (RWG oder auch COMECON), ein eigenes Finanzsystem. Eine Entscheidung, die nicht verwundert, da die liberalen Wirtschaftsvorstellungen der USA, diametral der planwirtschaftlichen Ideologie Stalins entgegenstanden.20
3. Die Entstehung des Marshall-Plan
3. 1. Auf dem Weg zum Europ ä ischen Wiederaufbauprogramm
Die USA hatten es geschafft einen großen Teil der Weltwirtschaftskonstruktion, ihrer wirtschaftspolitischen Ideologie entsprechend, neu zu ordnen. Dennoch hatte sich die europäische Wirtschaft noch nicht in dem erhofften Maße erholen können. Bis auf Deutschland konnten die restlichen europäischen Staaten zwar ihre gewerbliche Gesamtproduktion auf den Stand der Vorkriegszeit bringen (die Gesamtproduktion war auch schon vor dem Krieg nicht zufriedenstellend), aber der extrem kalte Winter des Jahres 1946/47 sowie die lange Trockenzeit sorgten 1947 für die schlechteste Ernte des Jahrhunderts. Nicht nur in Deutschland - hier konnte noch nicht einmal die Hälfte des angestrebten Ernährungsstandards von 1550 Kalorien pro Tag und Person gedeckt werden - herrschte eine Lebensmittelknappheit. Fast überall in Europa erreichten zu wenig Nahrungsmittel den Markt. Güter wie Kohle, Stahl, Dünger oder Baumwolle wurden ebenfalls knapp.21 Auch in Frankreich war die ökonomische Situation äußerst angespannt. Genauer gesagt, war die französische Wirtschaft 1947 praktisch zahlungsunfähig, was sich explizit mit einem Handelsdefizit von drei Milliarden Dollar angeben lässt. (William Clayton bezifferte das Zahlungsbilanzdefizit Frankreichs mit 1, 75 Milliarden Dollar, Großbritanniens mit 2, 25 Milliarden Dollar, sowie Italiens und der Bizone mit jeweils 500 Millionen Dollar pro Jahr.)22 Die Pariser Regierung besaß ihrerseits keine Finanzmittel um diese Lücke zu schließen.23 Insgesamt war also die wirtschaftliche Perspektive Europas, trotz amerikanischer Schenkungen, Kredite, Anleihen und Abgaben von Überschusswaren in Höhe von ungefähr 14, 7 Milliarden US-Dollar bis 1947, eher mager.24 Es war daher eindeutig, dass die bisherigen Hilfsmaßnahmen der USA nicht ausreichen würden, um Europa aus der wirtschaftlichen Krisensituation herauszuführen.25
Die offensichtliche Verpuffung der vollbrachten Hilfsleistungen, sowie ein starker Preisanstieg, rief innerhalb des amerikanischen Kongresses und der Öffentlichkeit Widerstand gegen weitere Investitionen in den “alten Kontinent” hervor.26 Ein vollständiges Versagen der Europa-Politik sowie der vorhandene miserable wirtschaftliche Zustand Europas wurden Anfang 1947 im alarmierenden Bericht des ehemaligen Präsidenten Herbert Hoover konstatiert.27 Die ökonomische Krisensituation in Europa war indes nicht der einzige Grund warum die Aufmerksamkeit der Amerikaner sich verstärkt auf die wirtschaftliche Situation des alten Kontinents richtete. Die Krise im östlichen Mittelmeerraum und deren anschließende Verkündung der “Truman-Doktrin”28, machten deutlich, dass der kommunistischen Bedrohung schnellstens ein ökonomischer Riegel vorgeschoben werden musste. Im Klartext bedeutete dies die Entschärfung eines politischen Problems mittels ökonomischer Maßnahmen.29 Der Staatssekretär für Wirtschaftsfragen, William Clayton, untermauerte dieses Prinzip durch seine äußert negative Vorhersage: “Without further prompt and substantial aid from the United States, economic, social and political desintegration will overwhelm Europe”.30
Um dieser möglichen Entwicklung entgegenzutreten, aktivierte der kürzlich aus Moskau wiederkehrende US-Außenminister George C. Marshall, den Policy Planning Staff (PPS). Marshall kehrte von der jüngsten Tagung des Außenministerrats mit der Erkenntnis wieder, dass ein europäisches Wiederaufbauprogramm in Zusammenarbeit mit der Sowjetunion nicht realisierbar sein werde. Deshalb sei es dringlichst geboten, jedes weitere Hinausschieben wirtschaftlicher Stützungsmaßnahmen zu vermeiden.31 Der Studienschwerpunkt des am 5. Mai 1947 gegründeten PPS, sollte auf der nationalen Sicherheit beruhen. Als Leiter des Planungsstabes wurde der Sowjetexperte George F. Kennan berufen, der auch sogleich eine enge europäische Kooperation anstrebte. In dem Report des Planungsstabes wurden konkrete Vorschläge unterbreitet, um die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Kraft und Gesundheit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
der europäischen Gesellschaft zu erreichen. Dabei musste die Strategie in zwei Phasen eingeteilt sein: Kurzfristig sollte ein Programm Selbstbewusstsein und Zuversicht wiederherstellen.32 Langfristig würde allerdings das Programm einer großen Finanzhilfe anlaufen. Die Planer des PPS machten weiterhin den Vorschlag, eines gemeinsamen Ausschusses der Europäer, um festzustellen wie sich Europa selbst helfen könne.33 Dementsprechend sollte die Initiative eines europäischen Hilfeprogramms zur Konsolidierung der Wirtschaft von den Europäern selbst ausgehen.34 William Clayton, Unterstaatssekretär für wirtschaftliche Angelegenheiten, konnte gegenüber Marshall unter dem Eindruck seines Europabesuchs, die Empfehlungen des PPS nur unterstreichen. Er betonte allerdings den Vorstellungen Kennans entgegenlaufend, dass die Vereinigten Staaten bei einer solch immensen Finanzhilfe, in jedem Fall die letztendliche Entscheidungskompetenz besitzen sollten: “Surely the plan should be a european plan, [...] But the United States must run the show.”.35 Dies betraf vor allem die Kontrolle über die Anwendung und Verwendung der Stabilisierungsmittel. Vorläufig entschied man sich in dieser Frage, keine direkte Führungsposition zu übernehmen. Hingegen wurde von den europäischen Ländern erwartet, multilateral -1947 dominierten die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen den europäischen Staaten. In jenem Jahr existierten etwa 200 solcher Verrechnungsabkommen36 - zusammenzuarbeiten.37
3. 2. Marshalls Rede an der Harvard Universit ä t
Aufgrund der pessimistischen Prognosen Kennans und seines PPS Berichts, sowie Claytons leidenschaftlichen Drängens, bat Marshall Dean Acheson um Rat, wie der amerikanischen Öffentlichkeit die Problematik in Europa näher gebracht werden könnte. Nachdem Acheson die Führung des Kongresses konsultiert hatte, empfahl er dem amerikanischen Außenminister in einer öffentlichen Ansprache, die europäische Krise deutlich zu machen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Marshall bereits eine Einladung in die Harvard Universität für den 5. Juli 1947 angenommen, wo ihm während der Abschlussfeier der Ehrendoktortitel verliehen werden sollte. Diese Möglichkeit wollte er sodann auch nutzen, um im Rahmen jener Festivität eine kurze Ansprache zur aktuellen politischen Situation der USA zu halten, sowie die europäische finanzielle Situation zu skizzieren. Acheson riet ihm dagegen davon ab, Erklärungen politischen Inhalts bei einer solchen Veranstaltung abzugeben, da - und hier sollte sich Acheson irren - niemand der Rede Aufmerksamkeit schenken würde.38
Die Ansprache Marshalls, hauptsächlich inspiriert durch den Bericht des PPS, skizzierte die wirtschaftlichen Probleme Europas und stellte sogleich indirekt Vorderrungen an die USA in punkto Hilfsleistungen: “The truth of the matter is that Europe ’ s requirements for the next three or four years of foreign food and other essential products-principally from america-are so much greater than her present ability to pay that she must have substantial additional help or face economic, social and political deterioration of a very grave charakter.”39 Auch wurde der psychologische Charakter eines Hilfsprogramms erwähnt: “The remedy lies in breaking the vicious circle and restoring the confidence of the european people in the economic future of their own countries and of Europe as a whole.”40 Eine solche Hilfe durch die amerikanische Regierung müsste allerdings eine absolute Gesundung der europäischen Wirtschaft hervorrufen, und dürfe keine kurzlebige, schmerzlindernde Wirkung besitzen. Zentral für einen Aufbau des europäischen Handels - dies war auch ein bedeutender Punkt im PPS Report - war die Erkenntnis, dass: “[...] to alleviate the situation and help start the European world on ist way to recovery, there must be some agreement among the countries of Europe as to requirements of the situation and the part those countries themselves will take in order to give proper effect to whatever action might be under taken by this Governnent. […] This is the business of the Europeans. The initiative, I think, must come from Europe.”41 Die Rolle der Vereinigten Staaten bestünde lediglich in der Unterstützung eines möglichen europäischen Programms, “[...] so far it may be practical for us to do so.”. So stand also die Hilfsbereitschaft der USA in direktem Zusammenhang mit ihren nationalen Interessen. Genauer gesagt, besaßen die Vereinigten Staaten bestimmte Vorstellungen, wie eine europäische Initiative aussehen sollte.
4. Gründung der OEEC
4. 1. Der Entstehungsprozess der CEEC
Die Amerikaner wählten die engeren europäischen Verbündeten als Brückenkopf, um ihre Ideen nach Europa zu transportieren.42 So konnte der britische Botschafter, Sir John Balfour, schon vor dem Entwurf der Ansprache, einen Bericht über die amerikanischen Ideen dank einer Reihe von Informationen seitens Acheson und Kennans entwickeln. Da allerdings der Bericht den britischen Außenminister Ernest Bevin zu spät erreichte, musste dieser den Redeinhalt einer Radioübertragung aus Washington entnehmen. Dennoch nahm Bevin mit seinem französischem Amtskollegen Georges Bidault sofort Kontakt auf, um über eine europäische Initiative zu diskutieren.43 Zu diesem Zwecke wurde die sowjetische Regierung kontaktiert und der Vorschlag einer Außenministerkonferenz in Paris unterbreitet. Entgegen den Erwartungen Benins und Bidault, nahm die Moskauer Regierung die Einladung positiv auf.
Auf der Pariser Konferenz, die vom 27. Juni bis zum 2. Juli 1947 andauerte, taten sich jedoch schnell Differenzen zwischen den Wirtschaftsplänen der europäischen Großmächte auf. Der Abgesandte Moskaus, Außenminister V. M. Molotov, zeigte sich zwar an der amerikanischen Wirtschaftshilfe interessiert, lehnte allerdings deren Auflagen in diesem Punkt strikt ab. Im Gegensatz zu den Vorstellungen einer gemeinsamen europäischen Planung bestand die Sowjetunion auf die nationale Souveränität der Staaten, indem jeder für sich, eigene Wiederaufbaupläne konstruieren sollten. Frankreich legte an dieser Stelle ein Aide-Mémoire vor, welches die Schaffung einer Organisation der europäischen Zusammenarbeit vorsah. Dieses Kontrollorgan sollte von jedem Land Einkünfte über die jeweiligen wirtschaftlichen oder materiellen Bedürfnisse einholen. Dies empfand man auf sowjetischer Seite als direkte Einmischung in die Angelegenheiten der betreffenden Länder.44 Außerdem warf Molotov den Briten und Franzosen vor, eine dominierende Stellung innerhalb der geplanten Organisation erlangen zu wollen.45 Ferner würden die Vereinigten Staaten jenes Instrument benutzen wollen, um die Politik der einzelnen europäischen Staaten zu beeinflussen.46 Diese Prognostizierung beschäftigte allerdings auch Frankreich und Großbritannien, welche ebenfalls Vorbehalte gegen mögliche hegemoniale Ansprüche der Amerikaner hatten. Die Vorstellung, dass die bisherige bilaterale Wirtschaftshilfe an Großbritannien in einem groß angelegten, gesamteuropäischen Hilfsprogramm aufgehen würde, entsprach nicht der angedachten Rolle Großbritanniens in der Weltwirtschaft. England sei schließlich nicht eins von vielen europäischen Ländern, sondern hätte das Recht, unter Verweis auf die Größe des Commonwealth, als Mitveranstalter und Juniorpartner der USA zu agieren.47 In Frankreich verursachte vor allen Dingen die Absicht der Amerikaner, Westdeutschland eine herausragende Rolle im ERP einzuräumen, Bauchschmerzen. Die extrem angespannte wirtschaftliche Situation machte es hingegen der Pariser Regierung leichter, amerikanischen Einfluss auf ihre Politik zu gestatten. In Paris waren aber die groben politischen Positionen der Westeuropäer und Sowjetunion unterschiedlich gesetzt. An diesen unvereinbaren Anschauungen scheiterte letztendlich die Drei-Mächte-Konferenz und machte aus dem europäischen Programm Marshalls ein westeuropäisches Aufbauprogramm, welches die Sowjetunion und ihre Satelliten-Staaten aussparen sollte.48
Trotz der ablehnenden Haltung Moskaus und des Scheitern der Konferenz, forderte Clayton die europäischen Staaten dazu auf, ihre Bemühungen bezüglich des Marshallplans in Resultaten zu verwirklichen.49 Die britische und französische Regierung luden daraufhin am
4. Juli 1947 im ganzen 22 europäische Staaten zu einer Konferenz in Paris ein. Ziel war es, ein Programm für einen Wiederaufbau zu entwickeln. Der Einladung folgten dagegen nur 16 Länder. Die restlichen sechs Staaten konnten sich aufgrund des Drucks Moskaus nicht an dem Zusammenkommen am 12. Juli beteiligen. Nachdem sich die Repräsentanten, Österreichs, Belgiens, Dänemarks, Frankreichs, Griechenlands, Islands, Irlands, Italiens, Luxemburgs, der Niederlande, Norwegens, Portugals, Schwedens, der Schweiz, der Türkei und Großbritanniens50, in Paris versammelt hatten, wurde ein “Committee of European Economic Cooperation” (CEEC) eingesetzt, dessen Vorsitz Sir Oliver Franks inne hatte. Die primäre Aufgabe der CEEC bestand nun in einer Bestandsaufnahme. Sie begann mit der Feststellung der Ressourcen und Kapazitäten der einzelnen Mitgliedsländer. Hierdurch sollte der mögliche
Beitrag der Staaten, sowie die unterschiedlichen, notwendigen Hilfsleistungen ermittelt werden.51 Das Ganze stand unter dem Eindruck William Claytons, der bei der Konferenz zugegen war und den Repräsentanten die amerikanische Position, bzw. Vorstellungen näher brachte. Er drängte auf Maßnahmen, die die Produktion steigern, und im Endeffekt Westeuropa in drei bis vier Jahren unabhängig machen würden. Dies entsprach den amerikanischen Vorstellungen, das Hilfsprogramm zeitlich zu befristen. Ein wichtiger Punkt war weiterhin der Abbau von Devisen- und Handelskontrollen, sowie die Abschaffung aller Zolltarife innerhalb von zehn Jahren.52
Claytons Vorstellung eines Wiederaufbauprogramms, wurde dagegen lediglich von den Beneluxstaaten unterstützt. Die restlichen Staaten schlossen sich den großen europäischen Staaten, Frankreich und Großbritannien an. Beide Länder hatten die Neigung, ihre bisherigen bilateralen, national orientierten Handelspraktiken beizubehalten. Deshalb stieß der Bericht des Gremiums noch vor seiner Veröffentlichung auf starke Kritik des Acting Secretary of State, Robert A. Lovett. Er bemängelte vor allem die fehlenden “essentials”, die einem Wiederaufbauprogramm amerikanischen Interessen entsprechen würden. Es ginge um gemeinschaftliche Schritte, die den größtmöglichen Handel von Waren und Dienstleitungen untereinander ermöglichen. Dies erfordere direkte Maßnahmen, die auf eine Reduzierung oder gar Eliminierung der Handelsschranken gelenkt sind und im Einklang mit der ITO - Charta stehen.53 Auf Druck des State Departement wurde der vorläufige Bericht noch einmal überarbeitet und am 22. September 1947 veröffentlicht. Der Bericht enthielt die Zusicherung einer gemeinsamen Zusammenarbeit der CEEC Mitgliedsstaaten. Dabei ging es ihnen vornehmlich um die Produktion, die Binnenwirtschaft, die Stabilisierung der Währungen und die europäische Kooperation im Allgemeinen.54 In punkto Produktion sollte bis 1951 folgende Ziele erreicht werden:
1. Die Produktion von Milch und Getreide sollte den Vorkriegslevel erreichen. Die Steigerung der Produktion von Zucker, Kartoffeln und Fett.
2. Die Produktion von Kohle nach dem Stand von 1947 um 145, 000, 000 Tonnen erhöhen.
3. Die Produktion der Elektrizität seit dem Stand von 1947, um 70 Kilowatt pro Stunde steigern.
4. Die Entwicklung der Raffinationskapazität um 17, 000, 000 Tonnen.
5. Die Stahlproduktion um 80% seit dem Level von 1947 steigern.
Die Mitgliedsstaaten erkannten weiterhin an, “[...] that the success of this program depends upon the reestablishment and maintenance of their financial and monetary stabiltiy.”55 Ergänzend zu den Punkten Produktion und Stabilisierung, wurde die “mutual assistence” der Staaten hervorgehoben. Sie sollten Maßnahmen erarbeiten, die auf den freien Handel von Waren und Leistungen innerhalb Europas abzielen. Dies würde mit den Grundsätzen der ITO Charta konform gehen.56 Des weiteren sollte das Problem des Dollar-Defizits in jedem Land durch ein wachsendes Exportvolumen behoben werden.57
4. 2. Die Institutionalisierung der CEEC in Form der OEEC
Es waren wiederum die Regierungen der Siegermächte Europas, die zu einer zweiten Sitzung der CEEC nach Paris luden. Ziel der vom 15. März bis zum 16. April 1948 stattfindenden Veranstaltung, sollten die Startvorbereitungen des Europäischen Wiederaufbauprogramms sein. Zentral war hier die geplante Gründung einer gemeinsamen Organisation, unter der sich alle europäischen Teilnehmer des Marshallplans zusammenfinden wollten.58 Schließlich war die Bedingung für den Erhalt der ERP -Hilfe von den USA, der Zusammenschluss der Empfängerländer in einer solchen Organisation.59 Die Installierung einer entsprechenden Institution entsprach den ausdrücklichen Wünschen der US- Administration, die sich weiterhin für eine starke Führungspersönlichkeiten an deren Spitze einsetzte. Dies sollte dem Zwecke dienen, das ERP gegen sogenannte borniert-nationalistische, gegenläufige Interessen durchzusetzen.60 Den amerikanischen Auffassungen entsprechend, sollte die geplante Organisation als ein eigenständiges Entscheidungszentrum, supranational Agieren. Dies wurde von den Briten kategorisch Abgelehnt, da eine supranationale Behörde sich leicht zu einem Manipulationsmoment der USA auf Europa entwickeln könne. Vielmehr hätte ein Zusammenschluss der europäischen Staaten die Funktion eines Gegengewichts gegen einem amerikanischen Hegemonialanspruch.
Auch die französische Regierung unterstützte eine zentralistische, europäische Organisation, die auf die Teilnehmerländer wirtschaftspolitisch einwirken sollte. Dabei war den Franzosen daran gelegen, mittels jenes Organs, Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands zu nehmen. Die Benelux Staaten, vertreten durch den belgischen Außenminister und Ministerpräsidenten Paul-Henri Spaak, hofften auf der anderen Seite durch eine europäische Organisation den übermächtig starken Einfluss der Länder Frankreichs und Großbritanniens zu neutralisieren.61
Am 16. April 1948 wurde die “Organisation for European Economic Co-Operation” durch die Teilnehmer der CEEC gegründet und gleichzeitig ein Abkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa verfasst. Damit war ein erster Ansatz eines europäischen Einigungsprozesses, aber auch ein amerikanischer Erfolg eingetreten, der sich in einer permanenten europäischen Organisation manifestierte, durch die es den USA möglich gemacht wurde, die Liberalisierung des Handels voranzutreiben und gleichzeitig die Kontrolle über ihn zu erlangen.62
Schon in der Präambel des Abkommens wurde klargestellt, dass eine Genesung und Wachstum der europäischen Wirtschaft, nur durch die Verflechtung der nationalen Wirtschaftssysteme und eine dauerhafte, enge Zusammenarbeit der Teilnehmerstaaten, möglich gemacht werden kann.63 Um diese Vorgabe zu gewährleisten wurde nun in Artikel 1 offiziell die Organisation für die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa begründet und sogleich mit weiteren, allgemeinen Verpflichtungen versehen:
1. Steigerung der Produktion durch eine rationelle Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen. (Dies beinhaltete auch überseeische Kolonien)
2. Erarbeitung von Programmen für die Produktion und den Austausch von Gütern durch die einzelnen Teilnehmer.
3. Die rasche Verwirklichung eines multilateralen Zahlungssystems und eine Lockerung, bzw. Abschaffung der Handelsbeschränkungen.
4. Förderung einer Zollunion oder Freihandelszone.
5. Ökonomische Kooperation, um im Endeffekt eine Unabhängigkeit von externen Hilfsleistungen zu erreichen.
6. Schaffung eines ausgeglichenen, multilateralen Handelsverkehr, der Havanna- Charta entsprechend.
7. Stabilisierung der nationalen Währung, gesunde Wechselkurse und Schaffung von Vertrauen in das eigene Geldwesen.
8. Volle Nutzung des eigenen Arbeitskräftepotentials, aber auch Verwendung von Arbeitskräften der anderen Teilnehmerstaaten.64
Als Sitz der OEEC wurde nach Art. 21 Paris bestimmt, nachdem die französische Regierung ihre Unabhängigkeit gegenüber den amerikanischen Beratern betonte. Diese hatten hingegen Brüssel als Standort befürwortet, da dieser unter geografischen Gesichtspunkten, keinem europäischem Machtzentrum nahe gestanden hätte. Die Verfassung der OEEC entsprach eher einer Interessenvertretung der Nationalstaaten, als einer eigenständigen wirtschaftspolitischen Entscheidungszentrums und kam daher den Vorstellungen des Vereinigten Königreichs entgegen. Als oberstes Beschlussgremium fungierte der Rat (council), in dem jedes Mitgliedsland der OEEC durch entsandte Delegierte vertreten war.65 Dem gegenüber setzte sich der Exekutivausschuss nur aus einem Vorsitzenden und sieben Mitgliedern, die alljährlich vom Rat bestimmt wurden, zusammen.66 Dieser Ausschuss sollte das ständige Aktions- und Machtzentrum der OEEC bilden. Für die Verrichtung der alltäglichen Arbeit waren zum einen die horizontalen Ausschüsse, zum anderen die vertikalen Ausschüsse zuständig. Im den horizontalen Gremien wurden wirtschaftpolitische Fragen, wie Produktivität, Arbeit Außenhandel und Zahlungsverkehr, bearbeitet. Die vertikalen Ausschüsse wendeten sich bestimmten Märkten und Branchen, wie Ernährung, Landwirtschaft, Kohle, Eisen und Stahl, zu. Bei der Besetzung der Führungspositionen fanden auch die kleineren Teilnehmerstaaten zu ihrem Recht. Neben dem britischen Delegierten Edmund Hall-Patch, welcher als Vorsitzender des Exekutivausschusses fungierte und dem französischem Generalsekretär Robert Marjolin, wurde der belgische Außenminister Paul- Henri Spaak als Vorsitzender des Ministerrats eingesetzt.67
Die primären Anstrengungen der OEEC lagen vor allem in der geplanten Multilateralisierung der innereuropäischen Zahlungsverkehrs, sowie der Verteilung der Marshallgelder. Einen Schritt vorwärts in diese Richtung bedeutete der 1949/50 vom Rat gebilligte Aktionsplan, welcher den Mitgliedsstaaten der OEEC auferlegte, so schnell wie möglich einen Bericht über Maßnahmen zur Ausfuhrsteigerung, bzw. Lockerung und Beseitigung der Handelschranken vorzulegen.68
5. Hintergrund der amerikanischen Investitionen
5. 1. Europa als amerikanischer Absatzmarkt
Parallel zum Entstehungsprozess der OEEC wurden auf amerikanischer Seite die gesetzlichen und administrativen Rahmenbedingungen für einen gelenkten Einsatz der ERP Finanzmittel im Kongress geschaffen. Dies geschah in Form des “Economic Cooperation Act”, welcher am 3. April 1948 beschlossen wurde. Er war ein Teil des umfassenden “Foreign Assistance Act”, der unter anderem auch Finanzhilfen für die Türkei und Griechenland beinhaltete. In der einleitenden Absichterklärung wurden die bereits oben erwähnten Erwartungen und Ziele an die Teilnehmerstaaten aufgeführt, wie die Produktivitätssteigerung, die Erweiterung des Außenhandels, die Schaffung der nationalen Währungsstabilität sowie die Etablierung einer ökonomischen Zusammenarbeit bei gleichzeitigem Abbau der Handelsschranken.69
Zu diesem Zwecke wurde eine Behörde für Ökonomische Kooperation (Economic Cooperation Administration) eingerichtet, die vom Präsidenten berufenen Administrator geleitet wurde. Präsident Truman setzte Paul G. Hoffman an jene Position und gab hiermit dem Druck des republikanisch dominierten Kngresses nach, einen wirtschaftsnahen und Nicht-Demokraten zu favorisieren. Ihm sollten verschiedene Aufgaben zufallen. Darunter fiel die Aufstellung der Programme der amerikanischen Hilfsleistungen, die Sichtung und Bewertung der möglichen Hilfsmaßnahmen und Programme für die europäischen Staaten sowie die Unterstützung für eine effiziente Ausführung eines solchen Programms.70 Dies bedeutete also für die USA eine Sicherung der relevanten Funktionen, wie Bedarfsplanung, Programmplanung und Verwendungskontrolle. Des weiteren sollte für Europa ein “Special Representative” eingesetzt werden, der im Range eines Sonderbotschafters stehen und parallel zu den US-Botschaften, ein Netz von Auslandsvertretungen in den Teilnehmerstaaten aufbauen sollte.71 Ihnen stand die Steuerung und Beratung der einzelnen Programme zu.
Trotz der stetigen Forderung an die Europäer, den Handel multilateral zu gestalten, sollten die europäischen Staaten mit den USA bilaterale Abkommen schließen, in denen die Konditionen, Auflagen und Bedingungen der Auslandshilfe festgelegt wurden. So wurde der US-Administration durch die Bindung der Europäer an das Abkommen, ein erheblicher
Einfluss auf die Wirtschaftsplanung und die Rekonstruktion der Wirtschaft gestattet. In dem verabschiedeten Gesetz für die bilateralen Beziehungen waren die Empfängerländer des ERP freilich auch an diverse Vorgaben gebunden, die besonders im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten lagen. So wurden die Mitgliedsstaaten der OEEC, bzw. CEEC dazu verpflichtet, den Export von solchen Gütern zu angemessenen Preisen in die USA zu steigern, an denen es den Amerikanern mangelte. Dementsprechend musste eine Produktionssteigerung in jenen Sektoren stattfinden. Weiterhin wurde unabhängig von den bilateralen Beziehungen, der Administrator beauftragt, sicherzustellen, dass mindestens 50% der aus den USA importierten Waren auch mittels amerikanischer Schiffe transportiert werden sollte.72 Auch wurde das amerikanische Müllereigewerbe privilegiert, indem 25% der gesamten europäischen Weizen- und Weizenmehlmenge direkt als Mehl in die USA geliefert werden sollte. Auf diese Weise sollten die als Nebenprodukt abfallenden Futtermittel für den amerikanischen Landwirtschaftsbedarf gedeckt sein.73 Weiterhin war es den Mitgliedsstaaten untersagt, landwirtschaftliche Überschussprodukte außerhalb der Vereinigten Staaten zu erwerben, wenn hierdurch ein belastender Überschuss für die USA selbst entstünde. Es war also die Verpflichtung des Administrators, den Absatz überschüssiger Produkte aus den USA zu fördern.
Ein wichtiger Bestandteil jenes staatsinterventionistischen US-Instrumentariums war die geforderte Einrichtung von Sonder-, bzw. Gegenwertkonten in den jeweiligen OEEC - Staaten.74 Auf sie sollte der Gegenwert der erhaltenden Dollarhilfe in Form der inländischen Währung eingezahlt werden. Die Funktion der Gegenwertkonten lag in der Kapitalbildung und Rekapitalisierung durch die Konzentration der inländischen Währung. Privates Kapital der Europäer und Amerikaner sollte zu Investitionen anregen und staatliche Interventionspolitik mittelfristig unnötig machen. Auf diese Konten gelangten auch Tilgungen der Investitionskredite, die aus Gegenwertmitteln gewährt worden waren sowie diverse Zinsen für eben solche Kredite. Über diese besonderen “counterpart funds” durften die Europäer aber nur im Einvernehmen der USA verfügen. Genauer gesagt sollten, nach Abzug von 5% Verwaltungskosten für die ECA, die Geldmittel der Gegenwertkonten für Projekte und Maßnahmen zur Rekonstruktion und Ankurbelung der europäischen Wirtschaft verwendet werden: a) finanzielle Stabilisierung, b) Stabilisierung der Zahlungsbilanzen, c)
Finanzierung der Transportkosten, d) Ausgaben für finanzielle Notfälle, e) Finanzierung für die Erforschung neuer Rohstoffquellen und Produktionsverfahren, f) Steigerung der Produktivität des Handels.75 Das Ganze sollte hingegen nur nach Absprache und Billigung des Administrators der ECA geschehen, bzw. umgesetzt werden. Die amerikanische Regierung hatte also nach der Verteilung der Auslandshilfe eine weiteres Instrument in der Hand um die Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten zu beeinflussen. Denn schließlich kontrollierte und organisierte die ECA die Bestellung, den Transport und die Bezahlung der Lieferungen sowie Gegenwertmittel. So war das eigentliche Ziel der USA die Sicherung der politischen und ökonomischen Einflusssphären innerhalb Europas mittels eines Wiederaufbauprogramms.76
5. 2. Deutschland als Zentrum US-Amerikanischer Europapolitik
Eine äußerst zentrale Rolle in den amerikanischen Planungen einer Rekonstruktion der europäischen Wirtschaft sollte Deutschland einnehmen. Obwohl 1947 bekanntlich noch kein konkreter Plan für Europa vorlag und somit der Platz der Westzonen innerhalb eines Hilfsprogramms nicht fest erläutert war, stellten die Wirtschaftsexperten des State Department trotzdem fest: “[...] And it is on Germany that the success of the European Recovery Plan recommended in this memorandum in large measure depends.”77 Für Kennan stellte sich die Wiederbelebung und Genesung der deutschen Produktion als ein Kernelement eines ERP -Programms da. Dabei stellte sich nun die Frage, inwiefern die wirtschaftliche Gesundung Deutschlands mit der politischen Komponente des Marshall-Plans in Einklang zu bringen war. Dies galt ganz besonders für die wahrgenommene kommunistische Bedrohung. Während der Londoner Deutschland-Konferenz teilte Marshall dem amerikanischen Botschafter in Paris seine Ansichten bezüglich eines europäischen Wiederaufbaus mit. Demnach sei dieser von einer integrierten Struktur, die Deutschland umfassen und die Sowjetunion auf Distanz halten würde, stark abhängig.78 Damit waren explizit eine dreizonale Koordination der Wirtschaft, sowie die Errichtung einer provisorischen Staatsmacht mit dem Endziel einer permanenten deutschen Regierung gemeint. So bestanden jedenfalls die
Amerikaner bei der Konferenz auf diese Punkte und setzten teilweise deren Durchführung mit dem ERP als Druckmittel gegenüber den Franzosen durch.79 Im State Department sah man eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen den Rekonstruktionsprozessen innerhalb Westdeutschlands und Westeuropas. Potentiell sei Deutschland einer der wichtigsten Lieferanten von existentiell wichtigen Waren, wie Kohle, Bergbaumaschinen und Industrieausrüstungen.
Die geplante Anhebung der deutschen Produktion, so wie es die amerikanischen Abgesandten auf der Pariser Konferenz (Deutschland wurde hier durch die Besatzungsmächte vertreten) noch einmal betonten, stieß bei den Franzosen auf Widerstand. Speziell die deutschen Kohlelieferungen an Frankreich, die Begrenzung der deutschen Stahlproduktion und die Kontrolle des Ruhrgebiets standen keinesfalls zur Diskussion. Frankreichs Außenminister Bidault schien zwar keinen total unnachgiebigen, verhärteten Kurs fahren zu wollen, konnte allerdings in diesen Fragen nicht nachgeben, da er von den inländischen Kommunisten und den Gaullisten unter Druck gesetzt wurde.80 Das Motto lautete hier: “Nous d ’ abord, l ’ Allemagne apr è s”.81 So ging es den Franzosen, aus dem historischen Kontext heraus, um die Verhinderung einer deutschen Vormachtstellung innerhalb Europas. Bevin und das Foreign Office unterstützten dagegen das amerikanische Bemühen, eine weniger restriktive Haltung in der westzonalen Wirtschaftspolitik einzunehmen. Dies bedeutete zumindest eine Lockerung der Produktionsverbote und -beschränkungen, so dass Deutschland seine Importe durch seine eigenen Exporte finanzieren sollte. Die britische Haltung in dieser Frage lässt sich wohl mit dem Interesse an einer Reduzierung der Besatzungskosten, die Haushalt stark belasteten, erklären.82 Bei den kleineren Anrainerstaaten und skandinavischen Ländern war dagegen ein großes Interesse an einer starken wirtschaftlichen Eingliederung Deutschlands innerhalb Europas vorhanden. Schließlich führten jene Länder, wie Schweden und die Niederlande, einen regen Handel mit dem Deutschen Reich. Der Ausfall dieser Märkte machte für sie eine deutsche Teilnahme an einem ERP wünschenswert.
Dies musste aber auch in letzter Konsequenz die Mitarbeit deutscher Fachleute in den gegründeten Organen, also der OEEC, bedeuten. Für die Amerikaner, besonders Militärgouverneur Clay, bedeutete die geplante Beteiligung deutscher Fachleute an dem
Hilfsprogramm, die Hoffnung an eine bessere Zusammenarbeit. Es war nicht zu übersehen, dass die Amerikaner auf eine begrenzte, aber dennoch rasche Eigenverantwortlichkeit der Deutschen drängten. Dagegen hatte die französische Regierung in dieser Beziehung große Vorbehalte, besonders gegen eine Teilnahme an der konstituierenden Sitzung der OEEC am 16. April 1948. Unter dem Druck Frankreichs gab die US-Regierung schließlich nach und ließ die Repräsentanten der Besatzungszonen die OEEC -Konvention für ihr jeweiliges Gebiet unterzeichnen.83 Diese Konvention behielt indes das Anliegen auf eine aktive Beteiligung der Westzonen an den europäischen Wiederaufbaumaßnahmen. Diesem Anliegen wurde durch ein einstimmiges, positives Votum dank der Delegierten, folge geleistet.
Das die USA auf eine aktive Beteiligung der Westzonen pochte, ist auch unter dem Bewusstsein zu verstehen, Deutschland durch gezielte Einschaltung als ein politisches Eindämmungsstück gegen die potentielle Ausbreitung des Kommunismus zu benutzen. Die geostrategische Situation innerhalb des gesamtdeutschen Raums unterstützte diese Ansicht noch.
5. 3. Das ERP im Kontext des Kalten Krieges
Würden die USA den Plan nicht durchführen, dann “w ü rde der Eiserne Vorhang mindestens bis zum Ä rmelkanal vorr ü cken. Stellen sie sich vor, was das f ü r uns allein wirtschaftlich bedeuten w ü rde.”.84 So beschrieb William Clayton das Bedrohungsszenario eines nicht durchgeführten, bzw. gescheiterten Rekonstruktionsplans der europäischen Wirtschaft. Dies zeigt deutlich, dass das ERP zwei Komponenten beinhaltete. Zum einen den wirtschaftlichen Aspekt, der die Sicherung der amerikanischen Absatzmärkte betraf. Dieser Gesichtspunkt war indes an einen zweiten, politischen Hintergrund gekoppelt. Der Vormarsch des Sozialismus, bzw. Kommunismus in der östlichen Welt. Auch wenn Marshall stets bemüht war, eine anti- sowjetische Haltung im Zusammenhang mit dem ERP zu vermeiden, so musste doch das Wiederaufbauprogramm, zwar nicht als offensives, jedoch als defensives Absicherungsmittel gegenüber dem Sozialismus verstanden werden. Genauer gesagt war das ERP, sowie die
CEEC und OEEC ein Konzept zum Aufbau einer einheitlich organisierten, kommunismusresistenten geopolitischen Region Westeuropa.85 Dabei war in den ursprünglichen amerikanischen Planungen freilich die Sowjetunion nicht ausgespart geblieben, denn schließlich wollten die Vereinigten Staaten nicht als Provokateure des Kalten Krieges dastehen. So vermied es Marshall in seiner Rede die Moskauer Regierung direkt anzusprechen. Er prophezeite allerdings: “[...] governments, political parties, or groups which seek to perpetuate human misery in order to profit therefrom politically or otherwise will encounter the opposition of the United States.”86 Dies war nicht nur ohne weiteres auf die Ostblockstaaten, sondern besonders auch auf die sozialistischen, bzw. kommunistischen Parteien und Strömungen innerhalb der westeuropäischen Länder gemünzt, die einer Liberalisierung des Handelsverkehrs hätten entgegen stehen können. Dennoch zog Marshall es insgesamt vor, die Betonung nicht auf einen Anti-Kommunismus zu legen. Auch Kennan betonte, dass die amerikanischen Anstrengungen, Europa zu helfen nicht geleitet werden sollten von dem Ziel den Kommunismus zu bekämpfen, sondern die wirtschaftliche Gesundheit und Stärke der europäischen Gesellschaft wieder herzustellen.87 Diese Aussage verneinte allerdings nicht die angedachte Schutzfunktion, die ein wirtschaftlich gesundes und nach amerikanischen Vorstellungen kapitalisiertes Westeuropa besitzen sollte. Demnach konstatierte Kennan, dass die amerikanischen Bemühungen sich auf die Wiederherstellung des gestörten wirtschaftlichen Gleichgewichts, welches Europa anfällig für totalitäre Bewegungen, wie den russischen Kommunismus macht, richten sollten.88 Er prognostizierte weiterhin, solange Konfusion und die instabile Situation in Europa herrsche, würden die europäischen Kommunisten die Situation für sich und Moskau ausnutzen. So könne der sowjetische Einfluss expandieren.89
Die Grundkonzeption des ERP war von vornherein gegen die Sowjetunion gerichtet. Der Marshallplan musste unabwendbar als ein divergierendes Element in Erscheinung treten, da seine ideologische Botschaft eines freien, von Zwängen befreiten Handels und offenen
Märkten die Sowjetunion zwangsläufig isolieren musste. Besonders, nachdem die Moskauer Regierung ihre eigene Teilnahme und die ihrer Satelliten-Staaten am ERP verweigerte. So konnte die Einladung an die Sowjetunion, sich am Marshallplan zu beteiligen, nur symbolischen Wert haben.90
6. Ergebnisse
Die Hintergründe des Marshallplans und die mit ihm einhergehende Gründung der CEEC, bzw. OEEC, lassen sich in zwei Faktoren einteilen.
1. Der makroökonomischen Faktor. Die gesamte Konzeption sowie das European
Recovery Program an sich, sollte nicht als spontane ad-hoc Reaktion auf die europäische Krise verstanden werden, sondern als logische Fortsetzung der amerikanischen Außenwirtschaftspolitik seit den vierziger Jahren. Genauer gesagt muss der amerikanische Aktionsplan, der die europäische Wirtschaft zu rekonstruieren ersuchte und sie sodann in das neu gestaltete marktwirtschaftliche Weltsystem integrieren sollte, als ein Teil der US-Weltwirtschaftsstrategie erkannt werden. Bereits zum Teil in der Atlantik-Charta von 1941 und besonders im Kapitel VII des Lend- Lease-Abkommen von 1942 sind die amerikanischen Erwartungen an eine neu konstruierte Weltwirtschaft deklariert: Ein freier, liberaler Markt, ohne restriktive Handelsbarrieren und die Gewährleistung weltweiter kapitalistischer Prosperität. Die national dominierten Ökonomien der Staaten sollten durch ein multilaterales Handelsystem ersetzt werden. Die Sicherung eines amerikanischen Absatzmarktes in Europa entspricht auch somit der vorhergegangenen Installation des IWF und IBRD, die die makroökonomische Führungsposition der USA in Bretton Woods festsetzten.
Besonders Europa betreffend musste eine Umorientierung der amerikanischern Strategie daher, da die bisherigen Hilfsmaßnahmen im Sande verliefen, bzw. keine Wirkung zeigten. Ein sich im ökonomischen und politischen Destabilisierungsprozess befindliches Europa hätte auch schlechte Absatzmarktchancen eröffnet und den Einbindungsprozess des Kontinents in die liberale Marktwirtschaft sichtlich erschwert. Unter diesem Hintergrund ist auch die von amerikanischer Seite forcierte, bzw. erzwungene Kooperation der europäischen Nationalstaaten zu verstehen. Die verlangte Eigeninitiative der Europäer und die Einbindung in ein Kollektiv wie die OEEC, kann als erster Schritt in Richtung eines gemeinsamen west-europäischen Marktes verstanden werden.91 Die USA konnten freilich die zusätzlichen bilateralen Abkommen nutzen, um Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung auszuüben und ihre Interessen mittels der ECA durchzusetzen.
2. Der zweite Faktor war politischer Natur. Ein wirtschaftlich und politisch
destabilisiertes Europa stellte aus amerikanischer Sicht nicht nur ein Problem für den Weltmarkt dar. Ein solch schwaches Europa war auch eine offene Flanke für den vorrückenden Kommunismus. Mit Besorgnis wurde die einzelnen innenpolitischen Entwicklungen in Italien und Frankreich beobachtet. So wurde auf Seiten der Vereinigten Staaten ein Zusammenhang zwischen der wirtschaftlich instabilen Phase und den aufstrebenden Kommunisten innerhalb jener Länder gesehen. Der Marshallplan, bzw. das ERP wurde nicht nur zum wirtschaftlichen, sondern auch zum politischen Instrumentarium. Zwar waren Marshall und auch Kennan stets darauf bedacht, das Hilfeprogramm nicht als ein anti-sowjetisches Instrument zu deklarieren, doch musste das ERP sich zwangsläufig zu einem protektionistischen Werkzeug gegenüber Moskau entwickeln. John Lewis Gaddis geht von der These aus, der Marshallplan sei ein “ambitious attempt to reconstitute a political balance in Europe by economic means”.92 Der Marshallplan machte allerdings die Teilung Europas in Ost und West manifest, da die liberale, marktkapitalistische Konzeption des Marshallplans und die einhergehende Eingliederung in eine multilaterale Weltwirtschaft, unvereinbar den sowjetischen Vorstellungen entgegenstand. Gerade auch die amerikanische Forderung nach Eingliederung der deutschen Besatzungszonen in ein europäisches Rekonstruktionsprogramm konnte auf Seiten Moskaus auf wenig Gegenliebe stoßen. Mit der OEEC war nun ein ausschließlich west-europäisches Organ zu Aufbau der Staaten entstanden.
Literaturverzeichnis
Address by Secretary of State George C. Marshall on the Marshall Plan as a European
Initiative to Economic Recovery, in: Robert Dallek (Hg.), The dynamics of world power. A documentary history of United States Foreign Policy 1945-1973, Vol. 1 Western Europe, New York 1973, S. 52-54.
Pariser Europakonferenz III.. Abkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit in
Europa, sowie die dem Rat vom Ausschuss für europäische Zusammenarbeit übermittelten Resolutionen, in: Keesing’s Archiv der Gegenwart. XVIII. und XIX. Jahrgang 1948 und 1949, S. 1464-1466.
Report of the Committee of European Economic Cooperation on European Recovery, in: Robert Dallek (Hg.), The dynamics of world power. A documentary history of United States Foreign Policy 1945-1973, Vol. 1 Western Europe, New York 1973, S. 54-57.
Albrecht, Ulrich, Internationale Politik. Einführung in das System internationaler Herrschaft, München; Wien 1999.
Arkes, Hadley, Bureaucracy, the Marshall Plan, and the National Interest, Princeton 1972.
Bierling, Stephan, Geburt eines Mythos. Die Rede des US-Außenministers George G.
Marshall hat die Welt verändert, in: Der Marshall-Plan. Geschichte und Zukunft, Hans Herbert Holzamer, Marc Hoch (Hg.), Landsberg/Lech 1997, S. 14-23.
Brähler, Rainer, Der Marshallplan. Zur Strategie weltmarktorientierter Krisenvermeidung in der amerikanischen Westeuropapolitik 1933 bis 1952, Köln 1983.
Bührer, Werner, Auftakt in Paris. Der Marshallplan und die deutsche Rückkehr auf die internationale Bühne 1948/49, in: Hans-Jürgen Schröder (Hg.), Marshallplan und Westdeutscher Wiederaufstieg, Stuttgart 1990, S. 181-208.
Bührer, Werner, Erzwungene oder freiwillige Liberalisierung? Die USA, die OEEC und die westdeutsche Außenpolitik 1949-1952, in: Ludolf Herbst, Vom Marshallplan zur EWG. Die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die westliche Welt, München 1990, S. 139-162.
Bührer, Werner, Westdeutschland in der OEEC. Eingliederung, Krise, Bewährung 1947-
1961, in: Institut für Zeitgeschichte (Hg.), Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 32, München 1997.
Cameron, Rondo, Geschichte der Weltwirtschaft. Von der Industrialisierung bis zur Gegenwart, Bd. 2, Stuttgart 1992.
Daniel, Ute, Dollardiplomatie in Europa. Marshallplan, kalter Krieg und US- Außenwirtschaftspolitik 1945-52, Düsseldorf 1982.
Elliott (Hg.), William Y., Weltwirtschaft und Weltpolitik. Grundlage, Strategie und Grenzen der amerikanischen Außenwirtschaftspolitik, New York 1955, S. 155.
Gaddis, John Lewis, The long peace, Inquiries Into the History of the Cold War, New York;Oxford 1989.
Gaddis, John Lewis, We know now. Rethinking Cold War History, Oxford 1997.
Görtemaker, Manfred, Das Ende des europäischen Zeitalters, in: Informationen zur politischen Bildung. Internationale Beziehungen. Der Ost-West-Konflikt, Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), Bonn 1994.
Hardach, Gerd, Der Marshall-Plan. Auslandhilfe und Wiederaufbau in Westdeutschland 1948-1952, München 1994.
Hogan, Michael J., Europäische Integration und deutsche Reintegration: Die Marshallplaner und die Suche nach Wiederaufbau und Sicherheit in Westeuropa, in: Charles S. Maier; Günter Bischof (Hg.), Deutschland und der Marshallplan, Baden-Baden 1992, S. 139-199.
Kennan, George F., Memoiren eines Diplomaten. Memoirs 1925- 1950, Stuttgart 1968.
Knapp, Manfred, Das Deutschlandproblem und die Ursprünge des Europäischen
Wiederaufbauprogramms. Eine Auseinandersetzung mit John Gimbels Marshall-Plan-
Thesen, in: Hans-Jürgen Schröder (Hg.), Marshallplan und westdeutscher Wiederaufstieg. Positionen und Kontroversen, Stuttgart 1990, S. 22-32.
Krakau, Knud, Außenbeziehungen der USA, 1945-1975, in: Länderbericht USA. Geschichte. Politik. Geografie. Wirtschaft. Gesellschaft. Kultur, Willi Paul/Peter Lösche (Hg.), Bonn 1998.
Krieger, Wolfgang, Die Knute Moskaus als Überzeugungswaffe, in: Hans-Herbert Holzamer (Hg.);Marc Hoch(Hg.), Der Marshallplan. Geschichte und Zukunft, Landsberg am Lech 1997, S. 40-45.
Landauer, Carl, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, Stuttgart 1981.
Laqueur, Walter, Europa auf dem Weg zur Weltmacht 1945-1992, München 1992, S. 223.
Mausbach, Wilfried, Zwischen Morgenthau und Marshall. Das wirtschaftspolitische Deutschlandkonzept der USA 1944-1947, Düsseldorf 1996.
Mayers, David, George Kennan and the Dilemmas of US Foreign Policy, New York;Oxford 1988.
Pogue, Forrest C., Marshall und der Marshall-Plan, in: Charles S. Maier/Günter Bischof (Hg.), Deutschland und der Marshall-Plan, Baden-Baden 1992, S. 59-88.
Pütz, Karl Heinz, Die Außenpolitik der USA. Eine Einführung, Hamburg 1974, S. 81.
Rémond, Réné, Geschichte Frankreichs, Bd. 6, Frankreich im 20. Jahrhundert. Erster Teil 1918-1958, Paris 1994.
Schröder, Hans-Jürgen, Marshallplan, amerikanische Deutschlandpolitik und europäische Integration 1947-1950, in: Hans-Jürgen Schröder (Hg.), Marshallplan und westdeutscher Wiederaufstieg. Positionen und Kontroversen, Stuttgart 1990, S. 239-253.
[...]
1 John Gimbel, Die Entstehung des Marshallplans, in: Hans-Jürgen Schröder (Hg.), Marshallplan und westdeutscher Wiederaufstieg. Positionen und Kontroversen, Stuttgart 1990, S. 11-19, hier S. 11.
2 Mayers, David, George Kennan and the Dilemmas of US Foreign Policy, New York;Oxford 1988, S. 138.
3 Ebd., S. 143.
4 Walter Laqueur, Europa auf dem Weg zur Weltmacht 1945-1992, München 1992, S. 223.
5 Rondo Cameron, Geschichte der Weltwirtschaft. Von der Industrialisierung bis zur Gegenwart, Bd. 2, Stuttgart 1992, S. 229.
6 Carl Landauer, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, Stuttgart 1981, S. 213.
7 Die Open-Door-Policy sollte Absatzmärkte für die USA sichern, um innenpolitische Stabilität zu erlangen. Ihr liegt die Annahme zu Grunde, dass der US-Handel aufgrund seiner Produktionskraft, bei einer formalen Gleichstellung der anderen Handelsnationen, sich als überlegen erweisen würde. Es würden sich denn Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme bis hin zu einer Hegemonialstellung der USA ergeben.
8 Ulrich Albrecht, Internationale Politik. Einführung in das System internationaler Herrschaft, München; Wien 1999, S. 165.
9 Carl Landauer, wie in Anm. 6, S. 213.
10 Wilfried Mausbach, Zwischen Morgenthau und Marshall. Das wirtschaftspolitische Deutschlandkonzept der USA 1944-1947, Düsseldorf 1996, S. 26.
11 In der Atlantik-Charta von 1941 wurden die Grundlagen für die Gründung der Vereinten Nationen gelegt. Weiterhin verpflichtete sie die Länder, die ihr beitreten wollten, den multilateralen Welthandel wieder aufzubauen.
12 Werner Bührer, Erzwungene oder freiwillige Liberalisierung? Die USA, die OEEC und die westdeutsche Außenpolitik 1949-1952, in: Ludolf Herbst, Vom Marshallplan zur EWG. Die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die westliche Welt, München 1990, S. 139-162, hier S. 141.
13 William Y. Elliott (Hg.), Weltwirtschaft und Weltpolitik. Grundlage, Strategie und Grenzen der amerikanischen Außenwirtschaftspolitik, New York 1955, S. 155.
14 In dem ökonomischen Nationalismus sahen die Vereinigten Staaten die Hauptursache der Weltwirtschaftskrise.
15 Karl Heinz Pütz, Die Außenpolitik der USA. Eine Einführung, Hamburg 1974, S. 81.
16 Manfred Görtemaker, Das Ende des europäischen Zeitalters, in: Informationen zur politischen Bildung. Internationale Beziehungen. Der Ost-West-Konflikt, Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), Bonn 1994, S. 10.
17 Für alle beteiligten Währungen wurden feste Wechselkurse mit einer maximalen Schwankungsbreite von 2, 25 % zum US-Dollar vereinbart.
18 Knud Krakau, Außenbeziehungen der USA, 1945-1975, in: Länderbericht USA. Geschichte. Politik. Geografie. Wirtschaft. Gesellschaft. Kultur, Willi Paul/Peter Lösche (Hg.), Bonn 1998, S. 169.
19 Rainer Brähler, Der Marshallplan. Zur Strategie weltmarktorientierter Krisenvermeidung in der amerikanischen Westeuropapolitik 1933 bis 1952, Köln 1983, S. 105.
20 In dem RWG waren die Hierarchien klar verteilt. Das Zentrum bildete die Sowjetunion, welche ihre Rohstoffe und Maschinen zu Preisen weit über Weltmarktniveau an ihre Partner absetzen konnte, während diese ihre Produkte zu Billigpreisen an die Russen abtreten mussten.
21 Rondo Cameron, wie in Anm. 5, S. 233.
22 Hans-Jürgen Schröder, Marshallplan, amerikanische Deutschlandpolitik und europäische Integration 1947- 1950, in: Hans-Jürgen Schröder (Hg.), Marshallplan und westdeutscher Wiederaufstieg. Positionen und Kontroversen, Stuttgart 1990, S. 239-253, hier S. 241.
23 Réné Rémond, Geschichte Frankreichs, Bd. 6, Frankreich im 20. Jahrhundert. Erster Teil 1918-1958, Paris 1994, S. 480.
24 Ute Daniel, Dollardiplomatie in Europa. Marshallplan, kalter Krieg und US-Außenwirtschaftspolitik 1945-52, Düsseldorf 1982, S. 30.
25 Manfred Knapp, Das Deutschlandproblem und die Ursprünge des Europäischen Wiederaufbauprogramms. Eine Auseinandersetzung mit John Gimbels Marshall-Plan-Thesen, in: Hans-Jürgen Schröder (Hg.),Marshallplan und westdeutscher Wiederaufstieg. Positionen und Kontroversen, Stuttgart 1990, S. 22-32, hier S. 26.
26 Stephan Bierling, Geburt eines Mythos. Die Rede des US-Außenministers George G. Marshall hat die Welt verändert, in: Der Marshall-Plan. Geschichte und Zukunft, Hans Herbert Holzamer, Marc Hoch (Hg.), Landsberg/Lech 1997, S. 14-23, hier S. 14.
27 Jürgen Heideking, Geschichte der USA, Tübingen; Basel 1999, S. 351.
28 Außenpolitische Leitsätze der USA, 1947 von Präsident Truman verkündet. Sie waren gegen die Sowjetunion gerichtet und forderten , die europäischen Staaten wirtschaftlich und militärisch zu unterstützen. Der Isolationismus der US- Außenpolitik wurde hiermit aufgegeben.
29 Wilfried Mausbach, Zwischen Morgenthau und Marshall. Das wirtschaftspolitische Deutschlandkonzept der USA 1944-1947, Düsseldorf 1996, S. 338.
30 Ebd., S. 339.
31 George F. Kennan, Memoiren eines Diplomaten. Memoirs 1925-1950, Stuttgart 1968, S. 328.
32 Als geeignetes Mittel eines kurzfristigen Programms betrachtete der PPS die Steigerung der Kohleproduktion.
33 Forrest C. Pogue, Marshall und der Marshall-Plan, in: Charles S. Maier/Günter Bischof (Hg.), Deutschland und der Marshall-Plan, Baden-Baden 1992, S. 59- 88, hier S. 64 ff..
34 Wilfried Mausbach, wie in Anm. 10, S. 338.
35 Forrest Pogue, wie in Anm. 33, S. 66.
36 Werner Bührer, wie in Anm. 12, S. 143.
37 Rainer Brähler, wie in Anm. 19, S. 168.
38 Forrest C. Pogue, wie in Anm. 33, S. 66.
39 Address by Secretary of State George C. Marshall on the Marshall Plan as a European Initiative to Economic Recovery, in: Robert Dallek (Hg.), The dynamics of world power. A documentary history of United States Foreign Policy 1945-1973, Vol. 1 Western Europe, New York 1973, S. 52-54, hier S. 53.
40 Ebd., S. 53.
41 Ebd., S. 54.
42 Gerd Hardach, Der Marshall-Plan. Auslandhilfe und Wiederaufbau in Westdeutschland 1948-1952, München 1994, S. 47.
43 Forrest C. Pogue, wie in Anm. 33, S. 70.
44 Ute Daniel, wie in Anm. 24, S. 48.
45 Ebd., S. 49.
46 Michael J. Hogan, Europäische Integration und deutsche Reintegration: Die Marshallplaner und die Suche nach Wiederaufbau und Sicherheit in Westeuropa, in: Charles S. Maier; Günter Bischof (Hg.), Deutschland und der Marshallplan, Baden-Baden 1992, S. 139-199, hier S. 150.
47 Gerd Hardach, wie in Anm. 42, S. 49.
48 Ebd., S. 48.
49 Rainer Brähler, wie in Anm. 19, S. 174.
50 Die westdeutschen Zonen waren an diesem Komitee nicht beteiligt.
51 Forrest C. Pogue, wie in Anm. 33, S. 71.
52 Michael J. Hogan, wie in Anm. 46, S. 153.
53 Werner Bührer, wie in Anm. 36, S. 143.
54 Report of the Committee of European Economic Cooperation on European Recovery, in: Robert Dallek (Hg.), The dynamics of world power. A documentary history of United States Foreign Policy 1945-1973, Vol. 1 Western Europe, New York 1973, S. 54-57, hier S. 55.
55 Ebd., S. 55.
56 Ebd., S. 56.
57 Ebd., S. 56.
58 Gerd Hardach, wie in Anm. 42, S. 99.
59 Ute Daniel, wie in Anm. 24, S. 56.
60 Rainer Brähler, wie in Anm. 19, S. 210.
61 Gerd Hardach, wie in Anm. 42, S. 100.
62 Werner Bührer, wie in Anm. 36, S. 144.
63 Pariser Europakonferenz III.. Abkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa, sowie die dem Rat vom Ausschuss für europäische Zusammenarbeit übermittelten Resolutionen, in: Keesing’s Archiv der Gegenwart. XVIII. und XIX, Jahrgang 1948 und 1949, S. 1464-1466, hier S. 1464.
64 Ebd., S. 1465.
65 Gerd Hardach, wie in Anm, 42, S. 102.
66 Werner Bührer, Westdeutschland und die OEEC. Eingliederung, Krise Bewährung 1947-1961, in: Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 32, München 1997, S.79.
67 Gerd Hardach, wie in Anm. 42, S. 102.
68 Werner Bührer, wie in Anm. 36, S. 144.
69 Foreign Assistance Act of 1948. Findings and Declaration of Policy. Sec. 102. (a), in: Keesing’s Archiv der Gegenwart. XVIII. und XIX, Jahrgang 1948 und 1949, S. 72-90, hier S. 72.
70 Foreign Assistance Act of 1948. Establishment of Economic Cooperation Administration. Sec. 105. (a), in: Keesing’s Archiv der Gegenwart. XVIII. und XIX, Jahrgang 1948 und 1949, S. 72-90, hier S. 74.
71 Gerd Hardach, wie in Anm. 42, S. 66.
72 Foreign Assistance Act of 1948. Nature and Method of Assistance. Sec 111 (a, 2), in: Keesing’s Archiv der Gegenwart. XVIII. und XIX, Jahrgang 1948 und 1949, S. 72-90, hier S. 76.
73 Rainer Brähler, wie in Anm. 19, S. 225.
74 Ebd., S. 221.
75 Foreign Assistance Act of 1948. Bilateral and Multilateral Takings. Sec 115 (b, 6), in: Keesing’s Archiv der Gegenwart. XVIII. und XIX, Jahrgang 1948 und 1949, S. 72-90, hier S. 84.
76 Manfred Knapp, wie in Anm. 25, S. 24.
77 Wilfried Mausbach, wie in Anm. 10, S. 341.
78 Michael J. Hogan, wie in Anm. 46, S. 169.
79 Als Kompromisslösung nahmen die USA die Forderung nach einer Übergangs-Regierung zurück. Im
Gegenzug beschleunigten die Franzosen den Zeitplan für die Bildung einer permanenten deutschen Regierung.
80 Gerd Hardach, wie in Anm. 42, S. 50.
81 Werner Bührer, wie in Anm. 66, S. 45
82 Ebd., S. 43/44.
83 Werner Bührer, Auftakt in Paris. Der Marshallplan und die deutsche Rückkehr auf die internationale Bühne 1948/49, in: Hans-Jürgen Schröder (Hg.), Marshallplan und Westdeutscher Wiederaufstieg, Stuttgart 1990, S. 181-208, hier S. 187.
84 Ute Daniel, wie in Anm. 24, S. 63.
85 Wilfried Mausbach, wie in Anm. 10, S. 344.
86 Address by Secretary of State George C. Marshall on the Marshall Plan as a European Initiative to Economic Recovery, wie in Anm 39, S. 53.
87 Manfred Knapp, wie in Anm. 25, S. 28.
88 Ebd., S. 28.
89 Mayers, David, wie in Anm. 2, S. 139.
90 John Lewis Gaddis, We know now. Rethinking Cold War History, Oxford 1997, S. 194.
91 Wolfgang Krieger, Die Knute Moskaus als Überzeugungswaffe, in: Hans-Herbert Holzamer (Hg.);Marc Hoch(Hg.), Der Marshallplan. Geschichte und Zukunft, Landsberg am Lech 1997, S. 40-45, hier S. 42.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Inhaltsverzeichnis"?
Der Text befasst sich mit der Entstehung des Marshallplans, der Rolle der USA beim Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg und der Gründung der OEEC (Organisation for European Economic Co-Operation). Er untersucht die wirtschaftlichen und politischen Hintergründe der amerikanischen Investitionen in Europa und die Auswirkungen des Kalten Krieges auf diese Entwicklungen.
Welche Rolle spielte die amerikanische Außenwirtschaftspolitik zwischen 1944 und 1947?
Nach 1945 lag die europäische Wirtschaft danieder. Die USA sahen es als ihre Aufgabe an, die Weltwirtschaft in kontrollierte, stabile Bahnen zu lenken. Die amerikanische Außenwirtschaftspolitik konzentrierte sich auf die Beseitigung des Elends in Europa und den Aufbau einer sicheren, konsolidierten Weltwirtschaft gemäß der Open-Door-Policy, die den freien Verkehr und Austausch von Waren förderte.
Wie kam es zur Entstehung des Marshallplans?
Die bisherigen amerikanischen Hilfsmaßnahmen reichten nicht aus, um Europa aus der wirtschaftlichen Krise zu führen. Der kalte Winter 1946/47 verschärfte die Situation, und die kommunistische Bedrohung machte deutlich, dass ein wirtschaftlicher Riegel vorgeschoben werden musste. George C. Marshall aktivierte den Policy Planning Staff (PPS), um ein europäisches Wiederaufbauprogramm zu entwickeln.
Was waren die wichtigsten Punkte in Marshalls Rede an der Harvard Universität?
Marshalls Rede skizzierte die wirtschaftlichen Probleme Europas und forderte indirekt Hilfsleistungen von den USA. Er betonte, dass eine absolute Gesundung der europäischen Wirtschaft erreicht werden müsse und die Initiative für ein solches Programm von den Europäern selbst ausgehen müsse. Die Rolle der USA bestehe lediglich in der Unterstützung eines möglichen europäischen Programms im Rahmen ihrer nationalen Interessen.
Wie kam es zur Gründung der OEEC?
Die Amerikaner wählten die engeren europäischen Verbündeten als Brückenkopf, um ihre Ideen nach Europa zu transportieren. Die britische und französische Regierung luden daraufhin 22 europäische Staaten zu einer Konferenz in Paris ein, um ein Programm für einen Wiederaufbau zu entwickeln. Es wurde ein "Committee of European Economic Cooperation" (CEEC) eingesetzt, dessen Aufgabe es war, eine Bestandsaufnahme der Ressourcen und Kapazitäten der einzelnen Mitgliedsländer zu machen. Am 16. April 1948 wurde die "Organisation for European Economic Co-Operation" (OEEC) gegründet.
Welchen Hintergrund hatten die amerikanischen Investitionen in Europa?
Die USA sahen Europa als einen wichtigen Absatzmarkt und wollten die relevanten Funktionen wie Bedarfsplanung, Programmplanung und Verwendungskontrolle sichern. Die europäischen Staaten sollten bilaterale Abkommen mit den USA schließen, in denen die Konditionen, Auflagen und Bedingungen der Auslandshilfe festgelegt wurden. Außerdem wurde die Einrichtung von Sonder-, bzw. Gegenwertkonten in den jeweiligen OEEC-Staaten gefordert, um die inländische Währung zu konzentrieren und die Kapitalbildung zu fördern.
Welche Rolle spielte Deutschland in den amerikanischen Planungen?
Deutschland sollte eine zentrale Rolle in den amerikanischen Planungen einer Rekonstruktion der europäischen Wirtschaft einnehmen. Die Wiederbelebung und Genesung der deutschen Produktion wurde als ein Kernelement eines ERP-Programms angesehen. Die USA drängten auf eine dreizonale Koordination der Wirtschaft und die Errichtung einer provisorischen Staatsmacht mit dem Endziel einer permanenten deutschen Regierung.
In welchem Kontext stand der Marshallplan zum Kalten Krieg?
Der Marshallplan beinhaltete zwei Komponenten: einen wirtschaftlichen Aspekt, der die Sicherung der amerikanischen Absatzmärkte betraf, und einen politischen Hintergrund, der den Vormarsch des Sozialismus bzw. Kommunismus in der östlichen Welt betraf. Das ERP wurde als defensives Absicherungsmittel gegenüber dem Sozialismus verstanden und sollte eine einheitlich organisierte, kommunismusresistente geopolitische Region Westeuropa aufbauen.
Was waren die wichtigsten Ergebnisse des Marshallplans und der OEEC?
Die Hintergründe des Marshallplans und der OEEC lassen sich in zwei Faktoren einteilen: Der makroökonomische Faktor, der die Integration der europäischen Wirtschaft in das neu gestaltete marktwirtschaftliche Weltsystem zum Ziel hatte, und der politische Faktor, der ein wirtschaftlich und politisch destabilisiertes Europa als offene Flanke für den vorrückenden Kommunismus ansah. Der Marshallplan machte die Teilung Europas in Ost und West manifest.
- Quote paper
- Niels Kristoph (Author), 2002, Marshall-Plan, Seine Entstehungsgeschichte bis zur Gründung OEEC, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107003