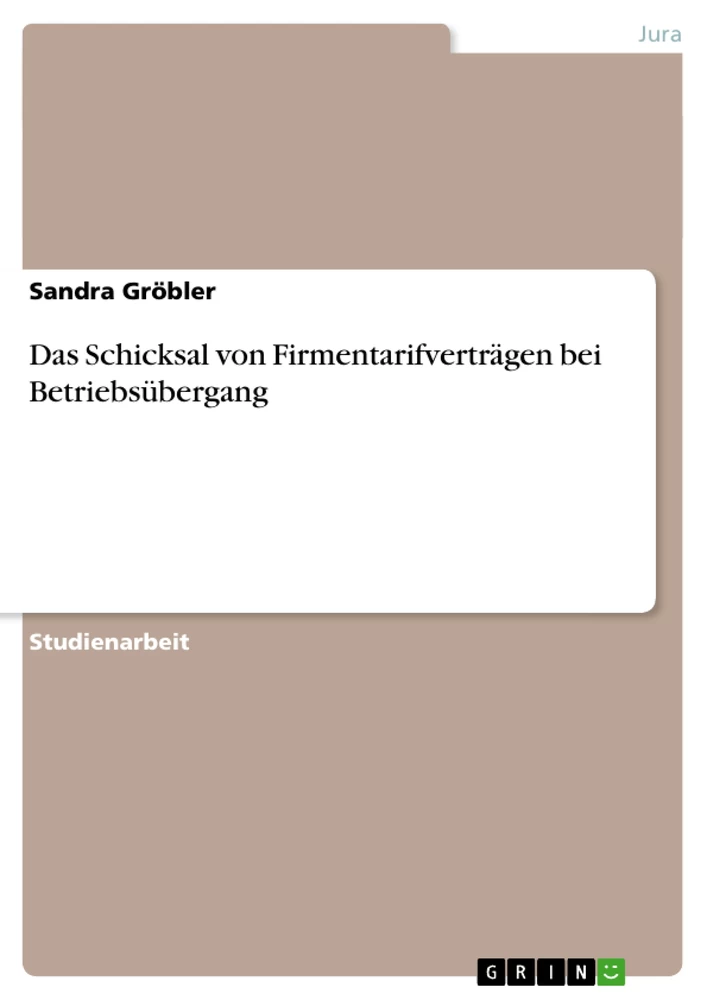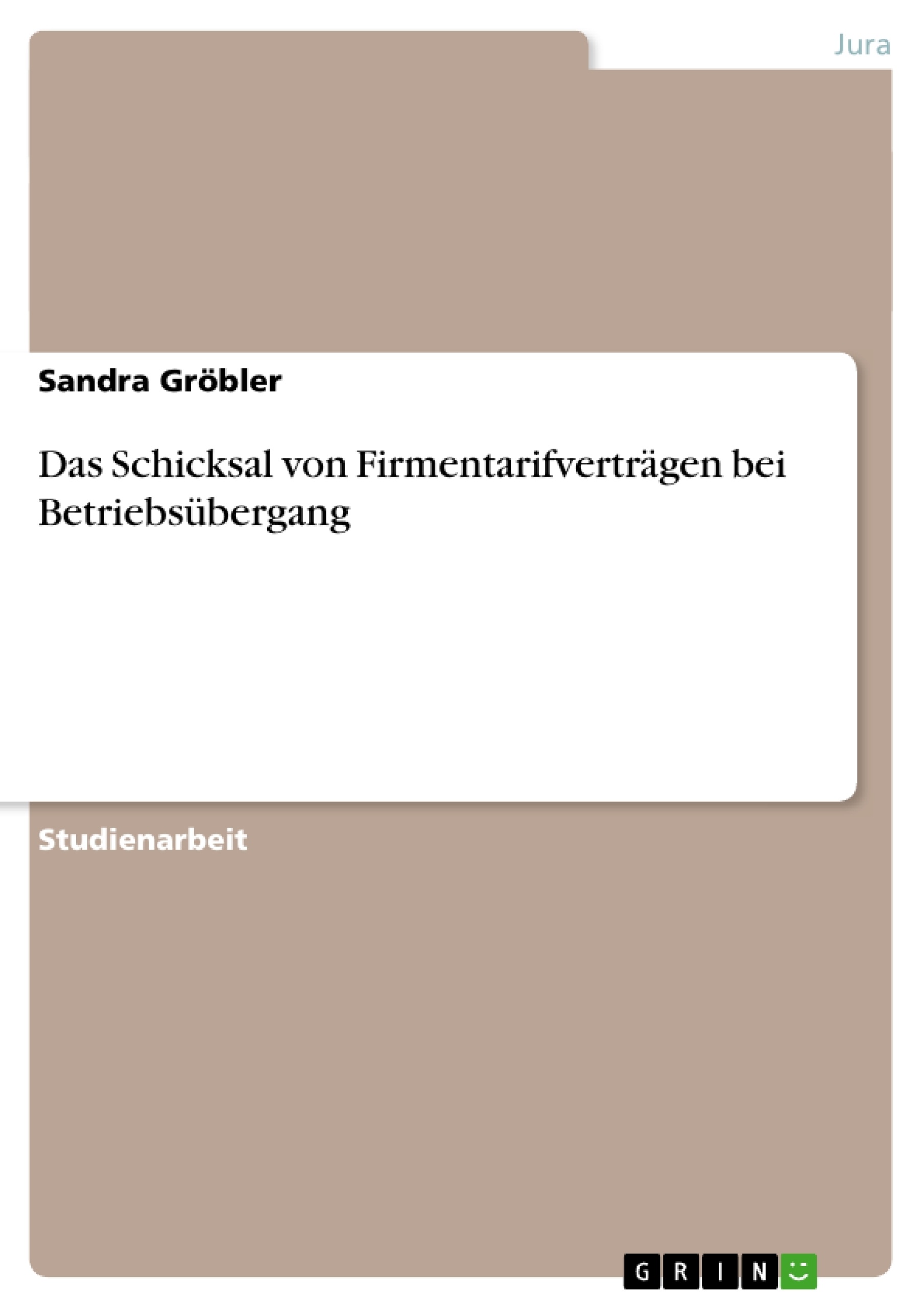Einleitung:
Der Firmentarifvertrag ist eine eigene Art der Tarifverträge. Dabei schließt der einzelne Arbeitgeber, der nach § 2 Abs.1 TVG tariffähig ist, einen Tarifvertrag mit der für sein Unternehmen zuständigen Gewerkschaft, was sich nach dem Unternehmenszweck bestimmt. In dem Firmentarifvertrag sollen vor allem die Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern geregelt werden1. Der Arbeitgeber ist also gleichzeitig Tarifvertragspartei und Partei des Arbeitsvertrages2.
Der Firmentarifvertrag entfaltet seine Wirkung nach § 3
Abs.1 TVG für diejenigen Arbeitnehmer, die
Gewerkschaftsmitglieder und damit tarifgebunden sind. Der Tarifvertrag kann aber unter Umständen auch auf die Arbeitsverhältnisse von nicht mitgliedschaftlich organisierten Arbeitnehmern einwirken, wenn dieser nach § 5 TVG für allgemein verbindlich erklärt wurde.
1. Teil- Der tarifgebundene Erwerber
Der neue Arbeitgeber könnte selbst tarifgebunden sein. Dann stellt sich die Frage, inwieweit er an den Firmentarifvertrag gebunden ist und welchem Tarifvertrag, dem neuen oder dem alten, gegebenenfalls der Vorzug zu geben ist.
A. Übernahme durch Rechtsgeschäft:
Zum einen kann der neue Inhaber den Betrieb oder Betriebsteil rechtsgeschäftlich erworben haben, wobei beides getrennt zu betrachten sein wird.
I. Betriebsübergang:
Es besteht die Möglichkeit für den Erwerber, dass der gesamte Betrieb auf ihn übergeht. Die Rechtsfolgen für ihn bestimmen sich dann nach § 613a BGB.
Ein Betrieb ist dabei die organisatorische Einheit von Personen und Sachen zur Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mit eigener Zielsetzung3. Dieser wechselt dann seinen Inhaber, wobei dieser in die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis eintritt.
1. Zuständigkeit der gleichen Gewerkschaft:
Grundsätzlich kann ein Firmentarifvertrag kollektivrechtlich fortwirken, wenn sich die Zuständigkeit der Gewerkschaft nicht ändert, also der Betriebszweck gleich bleibt. Ist dies aus noch zu erläuternden Gründen nicht möglich, kommt eine individualrechtliche Fortgeltung der Normen des
Firmentarifvertrages nach § 613a Abs.1 BGB in Betracht.
a) Kollektivrechtliche Fortgeltung:
Ist der Erwerber aber wie in dem hier betrachteten Fall schon an einen Tarifvertrag gebunden, so ist eine kollektivrechtliche Fortgeltung allerdings unter dem Gesichtspunkt des Grundsatzes der Tarifeinheit und im Hinblick auf § 613a Abs.1 S.3 BGB ausgeschlossen. Es wird in der Regel auch nicht im Interesse des Arbeitgebers sein, sich an einen zweiten Tarifvertrag zu binden. In Betracht kommt dann allenfalls eine individualrechtliche Fortgeltung.
b) Individualrechtliche Weitergeltung:
Der Firmentarifvertrag wirkt nach § 613a Abs.1 S.2 BGB individualrechtlich fort, indem Rechte und Pflichten, die durch Rechtsnormen eines Tarifvertrages (auch eines
Firmentarifvertrages4 ) Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen des Arbeitnehmer und dem neuen Inhaber werden. Dies ist aber durch S.3 ausgeschlossen, wenn bei dem Erwerber ein anderer Tarifvertrag gilt, zum Beispiel ein
Verbandstarifvertrag. Ließe man den Firmentarifvertrag daneben wirksam, so bestünden zwei Tarifverträge in einem Betrieb nebeneinander. Die Regelung dessen wird uneinheitlich betrachtet.
aa) Anwendung des neuen Tarifvertrages:
Einvernehmen besteht heute darüber, dass die Arbeitnehmer dem neuen Tarifvertrag nicht automatisch unterfallen5.
(1) Ehemalige Rechtsprechung:
Früher vertrat das BAG die Auffassung, dass dem Schutzzweck der Norm ausreichend Geltung getragen war, wenn dem Arbeitnehmer ein anderer Tarifvertrag zur Verfügung stand6.
(2) Herrschende Meinung:
Die heutige Rechtsprechung7 und Literatur8 vertreten den Standpunkt, dass eine kongruente Tarifgebundenheit des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers nötig ist um § 613a Abs.1 S.3 BGB zur Anwendung zu bringen. Begründet wird dies damit, dass S.3 an S.2 anknüpfe, womit die alten Arbeitsbedingungen in Kollektivverträgen gerade für den betroffenen Arbeitnehmer ersetzt werden müssen9. Außerdem wird auf die durch Art. 9 Abs.3 GG geschützte negative Koalitionsfreiheit des Arbeitnehmers hingewiesen. Wenn nur die Tarifbindung des Arbeitgebers ausschlaggebend sei, müsste der entsprechende Tarifvertrag auch bei fehlender
Verbandsmitgliedschaft des Arbeitnehmers auf diesen angewendet werden. Dieses Vorgehen stelle eine Verletzung von Art. 9 Abs.3 GG dar. Eine Ausnahme liege auch dann vor, wenn beim Erwerber ein Verbandstarifvertrag mit derselben Gewerkschaft besteht10. Dann soll es auch nach der h.M. zu einer Verdrängung des Firmentarifvertrages nach § 613a Abs.1 S.3 BGB kommen.
Eine weitere Möglichkeit sei die Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages.
(3) Mindermeinung:
Diese Auffassung des BAG ist nicht ohne Kritik geblieben. Die Gegenmeinung lässt es genügen, wenn nur der neue Arbeitgeber tarifgebunden ist11.
bb) Ergebnis:
In dem zunächst betrachteten Fall ist die gleiche Gewerkschaft zuständig. Daher kommen beide Meinungen hier zum gleichen Ergebnis, es gilt der Tarifvertrag des Erwerbers. Der Firmentarifvertrag wird nach § 613a Abs.1 S.3 BGB verdrängt und eine individualrechtliche Weitergeltung ist so ausgeschlossen.
2. Zuständigkeit einer anderen Gewerkschaft:
Der Erwerber könnte den Betrieb auch umwandeln und so den Betriebszweck und die Branchenzugehörigkeit ändern. Dabei ist er an einen Tarifvertrag mit einer anderen Gewerkschaft gebunden.
a) Kollektivrechtliche Fortgeltung:
Eine kollektivrechtliche Fortgeltung scheidet auch hier in der Regel aus12.
b) Individualrechtliche Fortgeltung:
Fraglich ist auch hier wieder, inwieweit die Normen des
Firmentarifvertrages individualrechtlich fortwirken können. Der betrachtete Streit wird vor allem hier relevant, da sich die Branchenzugehörigkeit des übernommenen Betriebes ändert. Der Erwerber hat dann einen Tarifvertrag mit einer anderen Gewerkschaft abgeschlossen.
aa) Herrschende Meinung:
Die h.M. erzeugt in diesen Fällen Tarifpluralität, das heißt innerhalb eines Betriebes sind mehrere Tarifverträge anzuwenden. Die Normen des Firmentarifvertrages würden nämlich in der Regel individualrechtlich fortwirken, es sei denn die Arbeitnehmer entschließen sich zum Wechsel der Gewerkschaft.
bb) Mindermeinung:
Nach anderer Ansicht wird der Firmentarifvertrag auch hier wieder verdrängt, da die einseitige Tarifbindung des Arbeitgebers genügt. Die Arbeitnehmer, die sich nicht zu einem Gewerkschaftswechsel entschließen, würden dann keinem Tarifvertrag unterfallen.
cc) Bewertung:
Verlangt man kongruente Tarifgebundenheit, wäre der Anwendungsbereich des § 613a Abs.1 S.3 BGB außerordentlich gering, da die Normen bis auf die genannten Ausnahmen immer individualrechtlich fortwirken würden.
(1) Systematische Auslegung:
§ 613a Abs.1 S.1 BGB sagt, dass Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer bei dem neuen Betriebsinhaber geregelt werden. Dies ist grundsätzlich unabhängig davon, ob der einzelne Arbeitnehmer tarifgebunden ist oder nicht. Der Wortlaut spricht also dafür, dass lediglich die Tarifgebundenheit des Erwerbers, also des neuen Arbeitgebers beachtlich ist.
Die Kritiker verweisen auf den Wortlaut des S.4 2. Alt., wonach bei fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit die Anwendung eines im anderen Geltungsbereich liegenden Tarifvertrages zwischen dem Erwerber und dem Arbeitnehmer vereinbart werden kann13. Der Wortlaut verlangt zwingend, dass weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer tarifgebunden sein dürfen. Satz 3 regelt dahingegen die fehlende Tarifbindung des Arbeitnehmers, da ein Erfordernis der beidseitigen Bindung im Vergleich zu S.4 nicht einmal ansatzweise zum Ausdruck kommt.
(2) Teleologische Auslegung:
Nach der h.M. würde es zur Anwendung verschiedener Tarifverträge innerhalb eines Betriebes kommen. Daraus ergibt sich zwangsläufig eine Ungleichbehandlung, die zwar zulässig, aber nicht verständlich ist14. Außerdem ergeben sich aus der Anwendung eines fachlich nicht mehr einschlägigen Tarifvertrages praktische Probleme. Als Tarifvertrag gemäß S.3 kommen nur Tarifverträge in Betracht, die ihren fachlichen und örtlichen Anwendungsbereich auf den betroffenen Betrieb erstrecken15. Daher muss der Sinn und Zweck des § 613a Abs.1 S.3 BGB darin liegen, dass ein fachlich nicht mehr einschlägiger Firmentarifvertrag von einem einschlägigen ersetzt wird. Das ist aber nur realisierbar, wenn die einseitige Tarifbindung des Arbeitgebers genügt16. Der Sinn und Zweck des § 613a Abs.1 S.3 BGB ist gerade die Anpassung und Vereinheitlichung der
Arbeitsverhältnisse17. Das BAG selbst hat ausgeführt, dass der Arbeitgeber die Möglichkeit bekommen muss die „neuen“
Arbeitsverhältnisse an das in seinem Betrieb Übliche anzupassen18. Verlangt man aber nun die Tarifbindung jedes einzelnen Arbeitnehmers um dem Tarifvertrag des Erwerbers Geltung zu verleihen, wird ihm die vom BAG verlangte Vereinheitlichung unmöglich gemacht. Gerade wenn der beim Erwerber geltende Tarifvertrag Verschlechterungen für den Arbeitnehmer mit sich bringen würde, ist ein Wechsel der Gewerkschaft und die damit verbundene Geltung des „neuen“ Tarifvertrages wohl so gut wie ausgeschlossen. Dabei läuft der Zweck des § 613a Abs.1 S.3 BGB leer, womit dies für die geforderte einseitige Tarifbindung des Arbeitgebers spricht.
(3) Entstehungsgeschichte:
Die Begründung zum Gesetzesentwurf besagte, dass S.3 klarstellen solle, dass „die kollektiven Verpflichtungen des Erwerbers den individualrechtlichen wie üblich vorgingen und der Erwerber lediglich verpflichtet sei den bei ihm geltenden Tarifvertrag einzuhalten“19. Damit wird deutlich, dass der neue Inhaber nicht verpflichtet sein kann, neben den bei ihm geltenden Tarifverträgen auch noch andere
Arbeitsbedingungen einzuhalten. Dies ist aber nur dadurch zu erreichen, dass eben keine kongruente Tarifbindung verlangt wird. Außerdem wird darauf verwiesen, dass die üblichen Regelungsmechanismen gelten, was Tarifeinheit bedeutet. Somit muss auf die Grundsätze der Tarifkonkurrenz bzw. Tarifpluralität abgestellt werden. Wenn aber die entsprechende Bindung des Arbeitnehmers entscheidend sein solle, so würde dieser Grundsatz umgangen. Es können also nicht zwei konkurrierende Tarifverträge in einem Betrieb gleichzeitig angewendet werden. Der verdrängte Tarifvertrag findet auch auf solche Arbeitsverhältnisse keine Anwendung, auf die mangels Organisationszugehörigkeit der allein zur Geltung gebrachte Tarifvertrag nicht anzuwenden ist20. Die herrschende Meinung verlangt von diesem Prinzip bei § 613a Abs.1 S.3 BGB eine Ausnahme zu machen. Eine Anwendung als lex specialis ist aber nicht begründbar.
(4) Negative Koalitionsfreiheit und Schutzzweck des § 613a:
Von der h.M. wird eingewandt, dass die Beschränkung auf die Tarifbindung des Arbeitgebers für die Anwendung von S.3 die negative Koalitionsfreiheit des Arbeitnehmers verletze21.
Dem kann allerdings § 612 Abs.2 BGB entgegengehalten werden, der eine Lückenfüllung bestimmt, die sich nach dem einschlägigen Tarifvertrag richtet22. Das wäre hier der Tarifvertrag des Erwerbers. Eine solche Regelung verstößt nicht gegen die negative Koalitionsfreiheit des Art.9 abs.3 GG, da der Arbeitnehmer nicht zu einem
Gewerkschaftsübertritt gezwungen wird. Es wurde bisher schließlich auch noch nie als Verstoß gegen die negative Koalitionsfreiheit angesehen § 612 Abs.2 BGB auf nicht tarifgebundene Arbeitnehmer anzuwenden, was im Ergebnis nichts anderes ist.
Man könnte mit dem Argument der h.M. auch anders herum argumentieren, dass § 613a abs.1 S.2 BGB die negative Koalitionsfreiheit des Arbeitgebers verletzt, da dieser zur Anwendung eines Tarifvertrages gezwungen wird, an den er nicht gebunden ist23.
Weiterhin bemängelt die h.M., dass die einseitige Tarifbindung des Arbeitgebers gegen die Schutzfunktion des § 613a Abs.1 BGB verstoße, der den Arbeitnehmern die bisherigen Arbeitsbedingungen sichern wolle. Die gesetzliche
Wertung des § 613a Abs.1 BGB verlange eine Ersetzung nur durch andere kollektive Regelungen, was eine kongruente Tarifbindung voraussetzt24. Dagegen muss allerdings gesagt werden, dass die § 613a BGB zugrunde liegende Richtlinie 77/187/EWG das nicht zum Ausdruck bringt25.
Alles in allem spricht das Erfordernis der einseitigen Tarifbindung des Arbeitgebers in § 613a Abs.1 S.3 BGB nicht gegen die negative Koalitionsfreiheit oder den Schutzzweck der Norm.
dd) Entscheidung:
Im Ergebnis sprechen die besseren Argumente dafür, dass die einseitige Tarifbindung des Arbeitgebers genügt, um den vor Betriebsübergang geltenden Tarifvertrag zu verdrängen. Allerdings kann der Arbeitnehmer nicht automatisch einem neuen Tarifvertrag unterfallen, wenn er nicht Organisationsmitglied ist. Insoweit entsteht dann ein „tariffreier“ Raum26. Dadurch wird auch die negative Koalitionsfreiheit des Arbeitnehmers gewahrt. Dass er dann nicht mehr den Schutz des Tarifvertrages genießt kann kein ausreichendes Argument sein um den Grundsatz der Tarifeinheit zu umgehen. Er hat jederzeit die Möglichkeit der entsprechenden Gewerkschaft beizutreten und so wieder dem Schutz eines Tarifvertrages zu unterfallen. Zum anderen sind ja bei Weitem nicht alle Arbeitsverhältnisse Tarifnormen unterworfen. Dann besteht einerseits die Möglichkeit im Arbeitsverhältnis Bezug zu nehmen. Wird dies nicht gemacht, bestimmt sich der Inhalt des Arbeitsverhältnisses dann nach dem, was sich aus Gesetz, dem im Betrieb Üblichen und Verweigerungsregeln ergibt. § 613a Abs.1 S.3 BGB stellt den Arbeitnehmer also nicht völlig schutzlos.
ee) Ergebnis:
Damit sind zur Bewertung der individualrechtlichen Weitergeltung des Firmentarifvertrages im Verhältnis zum Tarifvertrag, der beim Erwerber gilt, die Grundsätze der Tarifeinheit anzuwenden. Dabei ist aber nicht wie normalerweise dem sachnäheren Tarifvertrag der Vorzug zu geben, es kommt nach § 613a Abs.1 S.3 ausschließlich zu einer Verdrängung von individualrechtlich fortwirkenden Normen zugunsten eines anderen, im Geltungsbereich liegenden, Tarifvertrages27.
II. Betriebsteilübergang:
Der Betriebsteil ist ein abgrenzbarer Teil der Arbeitsorganisation unterhalb der Ebene des Betriebes28. Abzustellen ist dabei auf eine organisatorische Verbundenheit von Personen und Sachen, die die Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mit eigener Zielsetzung ermöglicht29. Damit wird also innerhalb des betrieblichen Zweckes ein Teilzweck verfolgt. Wird nur ein Teil des Betriebes veräußert, stellt sich die Situation folgendermaßen dar. In den nicht veräußerten Betriebsteilen gilt der Firmentarifvertrag nach wie vor weiter30. Etwas Abweichendes wäre auch nicht vertretbar, da die Situation in diesen Bereichen unverändert fortbesteht. Die Person des Arbeitgebers ändert sich nicht, womit also die Tarifvertragsparteien gleich bleiben. Weiterhin wird sich auch der Betriebszweck in den nicht übergegangenen Betriebsteilen nicht ändern.
Was für den veräußerten Betriebsteil anzunehmen ist, ist umstritten.
1. Kollektivrechtliche Fortgeltung:
Der Firmentarifvertrag kann unter den gleichen
Voraussetzungen kollektivrechtlich fortgelten, wie das beim gesamten Betriebsübergang der Fall ist. Der Erwerber muss sich also durch Vertragsschluss an den Tarifvertrag binden wollen. Voraussetzung ist weiterhin, dass der übernommene Betriebsteil als selbständige Organisationseinheit erhalten bleibt31. Ist das nicht der Fall und werden die Teile organisatorisch aufgelöst, so wird der Firmentarifvertrag gegenstandslos, da der Regelungsbereich nicht mehr vorhanden ist und die Tarifzuständigkeit sich geändert hat.
2. Individualrechtliche Fortgeltung:
Fraglich ist weiterhin, inwieweit der Tarifvertrag individualrechtlich fortwirkt, wenn Neben- oder Hilfsbetriebe übertragen werden. Für eine Kantine eines Metallbetriebes galt beispielsweise ein entsprechender Firmentarifvertrag. Aufgrund des Grundsatzes der Tarifeinheit konnten auch diejenigen Mitarbeiter erfasst werden, die der Metallbranche nicht zuzurechen waren32. Zweifelhaft ist allerdings, ob die Tarifnormen auch dann noch nach § 613a Abs.1 S.2 BGB in das Individualarbeitsverhältnis transformiert werden können, wenn die übertragenen Betriebsteile gar nicht mehr dem Geltungsbereich des
Firmentarifvertrages unterfallen. Grundsätzlich können
Firmentarifverträge individualrechtlich fortwirken33, soweit beide Partner vorher überhaupt tarifgebunden waren34, was in dieser Betrachtung anzunehmen ist. Allerdings ist der
Erwerber ja gerade nicht automatisch an den Firmentarifvertrag gebunden. Dabei wird auch beim
Betriebsteilübergang der Streit relevant, ob bei anderweitiger Tarifbindung des neuen Inhabers kongruente Tarifgebundenheit zu verlangen ist. Konsequenterweise muss man hier zu dem gleichen Ergebnis gelangen, die Bindung des Arbeitnehmers ist für die Anwendung von § 613a Abs.1 S.3 BGB nicht erforderlich. Der Firmentarifvertrag wird dann verdrängt.
Bleibt der Betriebszweck erhalten, wird der Firmentarifvertrag nach einheitlicher Ansicht trotzdem verdrängt, da dann der mit der gleichen Gewerkschaft abgeschlossene Tarifvertrag des Erwerbers zur Anwendung kommt.
3. Ergebnis:
Nach der hier vertretenen Ansicht wird der Firmentarifvertrag immer verdrängt. Folgt man der h.M. käme eine individualrechtliche Fortgeltung nach § 613a Abs.1 S.2 BGB in Betracht, wenn der übertragene Betriebsteil in den Geltungsbereich einer anderen Gewerkschaft fällt, an die der Arbeitnehmer nicht gebunden ist.
B. Übergang durch Gesamtrechtsnachfolge:
Auch bei einer Gesamtrechtsnachfolge kann der Firmentarifvertrag kollektivrechtlich fortwirken35. Dabei sind verschiedene Formen der Gesamtrechtsnachfolge zu unterscheiden.
I. Verschmelzung gem. §§ 2 ff UmwG:
Es kann durch eine Verschmelzung zu einer Gesamtrechtsnachfolge kommen. Zum einen besteht die Möglichkeit der Verschmelzung durch Aufnahme, zum anderen der Verschmelzung durch Neugründung36. An beidem können sich Aktiengesellschaften, GmbHs, Personengesellschaften und Vereine beteiligen, § 3 UmwG. Die Wirkung der Verschmelzung besteht darin, dass das Vermögen einschließlich der Verbindlichkeiten auf den Erwerber übergeht. Darin sind auch Firmentarifverträge inbegriffen, womit diese auf den Rechtsträger übergehen37.
Die Neugründung wird im 2. Teil zu betrachten sein.
Problematisch ist die kollektivrechtliche Fortgeltung bei der Fusion, wenn der neue Inhaber schon tarifgebunden ist.
1. Firmentarifvertrag des Erwerbers:
Der neue Rechtsträger könnte seinerseits bereits an einen Firmentarifvertrag gebunden sein. Werden beide Betriebe nach der Verschmelzung separat weitergeführt, können beide Firmentarifverträge für den jeweiligen Bereich weiterhin parallel Anwendung finden38. Davon ist der Fall zu unterscheiden, dass es nach der Verschmelzung auch zu einem Zusammenschluss der betrieblichen Einheiten kommt. Dann können beide
Firmentarifverträge nicht mehr nebeneinander kollektivrechtlich fortgelten, weil sich der Geltungsbereich nun grundlegend geändert hat. Daher kommt dann für beide
Firmentarifverträge nur eine individualrechtliche Weitergeltung in Betracht. Für den übergehenden Betrieb kommt dabei § 613a Abs.1 S.2 BGB zur Geltung, da für diese Arbeitnehmer der Arbeitgeber gewechselt hat. Das ist aber bei den Arbeitnehmern des übernehmenden Betriebes nicht der Fall, womit § 4 Abs.5 TVG auf diese Anwendung findet.
2. Verbandstarifvertrag beim Erwerber:
Anders ist die Rechtslage, wenn beim Erwerber bereits ein Verbandstarifvertrag galt. Tarifkonkurrenz tritt ein, wenn sowohl der Firmentarifvertrag als auch der Verbandtarifvertrag von der selben Gewerkschaft abgeschlossen wurde, das heißt auf ein Arbeitsverhältnis beide Tarifverträge anwendbar wären.
Für die übernommenen Arbeitnehmer ist der Firmentarifvertrag dabei in der Regel als spezieller anzusehen, womit dieser Vorrang hat39. Für die Arbeitnehmer des Erwerbers bleibt es dagegen bei der Gültigkeit des Verbandstarifvertrages40. Bei einem Zusammenschuss beider betrieblichen Einheiten kann auch hier der Firmentarifvertrag mangels Geltungsvoraussetzungen nicht mehr kollektivrechtlich fortwirken. Es kommt daher zur
Anwendung des § 613a Abs.1 S.3 BGB, da beim Erwerber ein Verbandstarifvertrag gilt. Mithin ist dann auch eine individualrechtliche Fortgeltung ausgeschlossen und der Verbandstarifvertrag findet nunmehr auf alle tarifgebundenen Arbeitnehmer Anwendung.
II. Spaltung, §§ 123 ff UmwG:
Die Spaltung wird in §§ 123 ff UmwG geregelt und kann auf mehreren Wegen vollzogen werden.
1. Aufspaltung:
Bei einer Aufspaltung wird ein Unternehmen unter Auflösung des gesamten Vermögens geteilt und auf mindestens zwei Einheiten übertragen. Das Unternehmen hört daraufhin auf zu existieren41. Damit kann bei dem Veräußerer keine Tarifbindung mehr bestehen42.
a) Streit: Tarifbindung des Erwerbers?
Streitig ist jedoch, wie es mit der Tarifbindung des Erwerbers aussieht.
aa) Ü bergang:
Eine Ansicht lässt auch die neuen Rechtsträger Tarifpartner werden43. Der Firmentarifvertrag beanspruche ohne Rücksicht auf die handelnden Personen Geltung in einem bestimmten Bereich, der auch nicht durch eine Aufspaltung verkleinert werden dürfe. Voraussetzung ist aber auch hier wieder, dass der betriebliche Zweck erhalten bleibt.
bb) Vertragliche Regelung:
Die Gegenmeinung lehnt ein Einrücken jedes Erwerbers in die Tarifvertragspartnerstellung ab44. Bei einer anderen Behandlung komme es zu einer Vielzahl von Firmentarifverträgen, die sich auf eine betriebliche Einheit beziehen. Das sei mit der vertraglichen Grundlage, die für das gesamte Tarifvertragsrecht prägend ist nicht vereinbar. Daher soll nur derjenige Partei des Firmentarifvertrages werden, dem diese Rechtsstellung im Spaltungs- und Übernahmevertrag zugewiesen ist, § 126 Abs.1 Nr.9 UmwG. Ist dies nicht der Fall, sollen die Tarifnormen nur noch individualrechtlich nach § 613a Abs.1 S.2 BGB fortgelten, es sei denn beim Erwerber gilt ein anderer Tarífvertrag, so dass § 613a Abs.1 S.3 BGB zur Anwendung kommt.
b) Bewertung:
Der zuletzt dargestellten Ansicht kann so nicht gefolgt werden. Es würde zu einer Ungleichbehandlung der in den einzelnen Teilen beschäftigten Arbeitnehmern kommen, wenn der Firmentarifvertrag nur bei demjenigen kollektivrechtlich fortwirkt, der sich dazu vertraglich verpflichtet hat, wohingegen die Normen bei denjenigen, die sich im
Übernahmevertrag nicht verpflichten nur noch individualrechtlich fortwirken. Eine solche Vorgehensweise ist nicht begründbar und vertretbar, da sich der Anwendungsbereich des Firmentarifvertrages praktisch nicht erweitert hat, er gilt immer noch für die gleichen Arbeitnehmer. Mithin müssen alle neuen Rechtsträger in die Stellung als Tarifvertragspartei eintreten, womit der Firmentarifvertrag in jedem Bereich kollektivrechtlich fortwirkt.
2. Abspaltung, Ausgliederung:
Bei der Abspaltung und der Ausgliederung werden nur Teile des Unternehmens übertragen, wobei das Unternehmen als solches bestehen bleibt45. Die Tarifgebundenheit des Veräußerers bleibt dabei für die nicht übertragenen Unternehmensteile erhalten46. Hier wird bei mehreren Erwerbern der gleiche Streit wie bei der Aufspaltung relevant, der nach dem selben Prinzip zu lösen ist.
Daher wirkt der Firmentarifvertrag auch bei den Erwerbern kollektivrechtlich fort.
III. Vermögensübertragung:
Für die Vermögensübertragung gelten bei der Vollübertragung nach § 174 Abs.1 UmwG die Grundsätze der Verschmelzung und bei der Teilübertragung die Grundsätze der Spaltung entsprechend.
IV. Erbe:
Bei einer Gesamtrechtsnachfolge auf den Erben tritt dieser voll in die rechtliche Position des Vorgängers ein, womit der Firmentarifvertrag unverändert Geltung hat47.
V. Einschränkung der Tarifgebundenheit:
Obwohl der neue rechtsträger vollkommen in die Position des alten einrückt, muss auch ihm ein gewisser Schutz gewährt werden48.
So schützt Art.9 Abs.3 GG eben auch die negative Koalitionsfreiheit, also sich gerade nicht kollektivrechtlich zu binden. Überginge man dies beim Betriebsübergang völlig, so wäre die Handlungsfreiheit des Einzelnen, Art.2 Abs.1, 19 Abs.3 GG, erheblich eingeschränkt. Daher hat der Rechtsnachfolger in diesem Fall ein Recht zur außerordentlichen Kündigung des Firmentarifvertrages, die jedoch im Sinne des § 121 Abs.1 BGB unverzüglich erfolgen muss49.
2. Teil - Der nicht- tarifgebundene Erwerber
Der neue Inhaber könnte seinerseits auch noch gar nicht tarifgebunden sein. Dabei stellt sich die Frage, ob er den Firmentarifvertrag übernimmt und inwieweit generell ein Tarifzwang besteht.
A. Übergang durch Rechtsgeschäft
Der Erwerber kann den Betrieb durch Rechtsgeschäft übernommen haben.
I. Betriebsübergang:
Auch hier kann wieder der gesamte Betrieb übergehen.
1. Kollektivrechtliche Fortgeltung:
§ 613a Abs.1 S.2 BGB bildet grundsätzlich nur einen Auffangtatbestand, das heißt er greift nicht, wenn eine Weitergeltung des Tarifvertrages auf kollektivrechtlichem Weg möglich ist50. Grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass der Betriebszweck erhalten bleibt, sich also die Zuständigkeit der Gewerkschaft nicht ändert. Fraglich ist dann, ob der Erwerber einem Tarifzwang unterliegt, also automatisch mit dem Betriebsübergang zur Partei des
Firmentarifvertrages wird. Die Besonderheit der
Firmentarifverträge liegt aber gerade darin, dass der Arbeitgeber nicht Mitglied des Arbeitgeberverbandes ist und den Tarifvertrag selbst mit der jeweiligen Gewerkschaft abgeschlossen hat. Eine Beurteilung dessen ist nach wie vor umstritten.
a) Situation vor Einf ü gung der S. 2-4:
Der Gesetzgeber fügte 1980 die S. 2-4 an § 613a Abs.1 BGB aufgrund der EG- Anpassungsnovelle vom 13.8.1980 an51. Bis dahin besagte §613a BGB lediglich, dass der rechtsgeschäftliche Betriebserwerber in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen eintritt. Die kollektive Weitergeltung des Firmentarifvertrages wurde überwiegend bejaht, die Begründung fiel allerdings unterschiedlich aus.
aa) Offene Rechtsfortbildung:
Eine Ansicht bejahte die kollektivrechtliche Fortgeltung mit der offenen Rechtsfortbildung52. Die eigentliche Tarifvertragspartei sei das Unternehmen an sich, das allerdings keine selbständige Rechtspersönlichkeit besitze.
Eine Differenzierung zwischen Gesamtrechts- und Einzelrechtsnachfolge sein unzulässig, wobei zu sagen ist, dass eine kollektivrechtliche Weitergeltung bei der Gesamtrechtfolge grundsätzlich anzunehmen ist. Eine kollektivrechtliche Fortgeltung komme hiernach bei der Rechtsnachfolge und bei der Erhaltung des veräußerten Betriebes als selbständige organisatorische Einheit in Betracht53.
bb) § 25 HGB analog:
Die Gegenmeinung stützte die kollektivrechtliche Weitergeltung des Firmentarifvertrages auf § 25 HGB54. Der Erwerber war danach tarifgebunden, sofern er dies bei der Übernahme nicht ausgeschlossen hat. Dabei soll die Partiestellung auf den Erwerber übergegangen sein. An dieser Auffassung wurde kritisiert, dass § 25 HGB nur einzelne Rechte und Pflichten für den Übergang erfasste55 und nur eine zusätzliche Haftung bestimmte56.
cc) § 613a BGB analog:
Eine weitere Ansicht begründete die Fortgeltung mit der analogen Anwendung des § 613a BGB57. Begründung war, dass die Rechtsnachfolge in einen Firmentarifvertrag notwendige Konsequenz des in § 613a BGB vorgeschriebenen Übergangs sei. Kritiker58 bringen an, dass § 613a BGB zwar einen Arbeitsplatzschutz, nicht aber einen Inhaltsschutz des
Arbeitsverhältnisses vorschreibe. Auch würde die Gestaltungsbefugnis des Erwerbers nicht eingeschränkt.
dd) Nachwirkung f ü r ü bernommene Arbeitnehmer:
Zum Teil wurde auch vertreten, dass der Firmentarifvertrag für die übernommenen Arbeitnehmer nachwirken könne59.
b) Heutige Situation:
Es erscheint fraglich, ob die vor Inkrafttreten des § 613a Abs.1 S.2-4 BGB vertretenen Lösungsansätze auch heute noch ihre Berechtigung finden. Wenn eine kollektivrechtliche Fortgeltung nun ausgeschlossen wäre, käme nur noch eine individualrechtliche Weitergeltung der Normen aus dem Firmentarifvertrag nach § 613a Abs.1 S.2 BGB in Betracht.
aa) § 613a Abs.1 S.1 BGB analog:
Zum Teil wird auch heute noch § 613a Abs.1 S.1 BGB analog angewendet60, jedenfalls dann, wenn die Betriebsidentität erhalten bleibt. Angeführt wird, dass nach § 3 Abs.1 TVG die Tarifbindung beim Firmentarifvertrag an die Stellung des Arbeitgebers anknüpft. Der Sinn eines Firmentarifvertrages liege darin, diesen darauf auszulegen sowohl die Existenz individueller Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber zu überdauern, also primär arbeitsplatzbezogen zu sein. Dabei soll auch der Betriebsinhaberwechsel keine Ausnahme machen, wenn die in § 3 Abs.1 TVG vorausgesetzte Rechtsstellung als Arbeitgeber ebenfalls von einem anderen Rechtssubjekt übernommen werden kann. Das sehe § 613a Abs.1 S.1 BGB eben ausdrücklich vor.
Eingeschränkt wird die kollektivrechtliche Weitergeltung aber dadurch, dass der Betrieb als kollektivrechtlich erfassbare Organisation übergehen und die Arbeitgeberstellung tariflich identisch bleiben soll61. Außerdem soll auch der Betriebszweck erhalten bleiben müssen62.
Diese Ansicht wird jedoch größtenteils abgelehnt63. Arbeitgeber im Sinne des TVG ist jede natürliche oder juristische Person, die Arbeitnehmer beschäftigt. Daran knüpfe der Gesetzgeber die Tarifgebundenheit in § 3 Abs.1 TVG, nicht an einen betriebsbezogenen Arbeitgeberbegriff64. Wenn die Arbeitsverhältnisse also beim Betriebsübergang nach § 613a Abs.1 S.1 BGB auf den Erwerber übergehen, verliert der Veräußerer seine Arbeitgeberstellung und der neue Inhaber ist somit ein anderer Arbeitgeber im Sinne von
§§ 2 Abs.1, 3 Abs.1 TVG, der nicht Partei des
Firmentarifvertrages ist. Außerdem müsste eine Regelungslücke im Gesetz bestehen, die eine Analogie rechtfertigt. Diese ist aber nach Inkrafttreten der S.2-4 geschlossen worden, so dass eine Analogie überflüssig wird.
bb) Teleologische Reduktion: Abstellen auf Betriebsidentit ä t:
Eine andere Ansicht stellt für die kollektivrechtliche Fortgeltung von Firmentarifverträgen nur auf den Erhalt der
Betriebsidentität ab und vergleicht diese mit Betriebsvereinbarungen65. Begründet wird diese Vorgehensweise damit, dass zum übernommenen Betrieb der Firmentarifvertrag in gleicher Weise gehöre wie die Betriebsvereinbarung. Beide seien sich ähnlich, so dass auch eine gleiche Behandlung erfolgen müsse. So müsste auch der Firmentarifvertrag bei Identitätserhaltung in gleicher Weise erhalten werden66. Als eigentliche Tarifvertragspartei sei dabei der Betrieb als Organisationseinheit anzusehen67. Damit soll eine teleologische Reduktion des § 613a abs.1 BGB gerechtfertigt sein und eine kollektivrechtliche Weitergeltung begründen.
Dagegen ist aber zu sagen, dass das TVG dem Firmentarifvertrag dieselben Rechtswirkungen wie dem Verbandstarifvertrag zuspricht und ihn so gerade nicht mit der
Betriebsvereinbarung gleichstellt68. Zwischen beiden Systemen bestehen erhebliche Unterschiede, was eine Gleichbehandlung ausschließt. So gilt die Betriebsvereinbarung zum Beispiel für alle Arbeitnehmer, der Firmentarifvertrag entfaltet aber nur für tarifgebundene Arbeitnehmer normative Wirkung. Die Stellung des Arbeitgebers als Tarifpartner ergibt sich erst durch den Abschluss eines Tarifvertrages. Etwas anderes würde der Eigenschaft des Tarifsystems als Vertrags- und Regelinstitution zuwider laufen.
Daher gibt es keinen Grund § 613a Abs.1 BGB teleologisch zu reduzieren und eine kollektivrechtliche Weitergeltung des Firmentarifvertrages zu verlangen69.
cc) Offene Rechtsfortbildung:
Vertreter, die eine offene Rechtsfortbildung bejahen, kommen zu einer kollektivrechtlichen Fortgeltung des Firmentarifvertrages70. Gründe seien auch hier die Arbeitsplatzbezogenheit der Tarifbindung und der Betrieb als eigentliche Vertragspartei71. Dem ist wiederum der Wortlaut des § 613a Abs.1 S.2 BGB entgegenzuhalten, der in der Regel nur eine individualrechtliche Weitergeltung von Firmentarifverträgen anordnet. Eine Ausnahme könnte bei einer sogenannten verdeckten Gesetzeslücke gemacht werden, die vorliegt, wenn das Gesetz zwar eine Regel enthält, diese aber auf eine bestimmte Gruppe von Fällen ihrem Sinn und Zweck nach nicht passt72. Daher müsste eine kollektivrechtliche Fortgeltung vom TVG oder den Vorschriften über die
Rechtsnachfolge verlangt werden. Nach §§ 25 HGB, 419 BGB lässt sich aber keine Verpflichtung dazu entnehmen. Da Firmentarifverträge vom TVG wie Verbandstarifverträge behandelt werden, lässt sich auch daraus keine Besonderheit entnehmen.
dd) Nachwirkung nach § 4 Abs.5 TVG:
Schaub meint, es könne zu einer Nachwirkung im Sinne von § 4 Abs.5 TVG kommen, wenn der übergegangene Betrieb als Organisationseinheit erhalten bleibt73.
Dies widerspricht allerdings der Konzeption von § 613a
Abs.1 BGB74. Außerdem ist § 4 Abs.5 TVG in diesem
Zusammenhang gar nicht einschlägig, da danach einem Rechtsträger, der keiner Tarifbindung unterliegt ein fremdes Regelungswerk aufgezwungen werden könne, zu dem er in keiner Verbindung steht75.
Dem ist zuzustimmen, womit eine kollektivrechtliche Fortgeltung kraft Nachwirkung nicht in Betracht kommt.
ee) Bewertung und Entscheidung:
Allen Theorien darf keine kollektive Fortgeltung des Firmentarifvertrages beim neuen Inhaber entnommen werden. Sie begrenzen das Wahlrecht des Erwerbers beim Betriebsübergang, was weder von § 613a BGB noch vom TVG gefordert und gerechtfertigt wird76. Etwas anderes kann hingegen angenommen werden, wenn der Erwerber sich dem Vorgänger oder der Gewerkschaft gegenüber verpflichtet die tariflichen Vereinbarungen anzuerkennen77. Eine kollektivrechtliche Fortgeltung ist also nur im Wege der Vertragsübernahme möglich78, wobei auch ein neuer, aber identischer Firmentarifvertrag abgeschlossen werden kann.
c) Ergebnis:
Der neue Inhaber kann demnach nicht gezwungen sein den Firmentarifvertrag kollektivrechtlich fortgelten zu lassen. Ein Tarifzwang ist somit auch abzulehnen.
2. Individualrechtliche Fortgeltung:
Da der Erwerber ja nicht tarifgebunden ist, können die Normen des Firmentarifvertrages problemlos individualrechtlich fortwirken, weil eine Tarifkonkurrenz oder Tarifpluralität ausgeschlossen ist. Die durch den Tarifvertrag geregelten Rechte und Pflichten werden Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem Arbeitnehmer und dem neuen Inhaber, § 613a Abs.1 S.2 BGB.
Voraussetzung dafür ist, dass beim alten Inhaber beiderseitige Tarifbindung bestand, da § 613a Abs.1 S.2 BGB nur diejenigen Arbeitnehmer erfasst, die sonst durch den Betriebsübergang ihren tariflichen Schutz verlieren würden79. Ein Firmentarifvertrag gilt auch individualrechtlich fort, wenn sich der fachliche Geltungsbereich ändert80, womit eine Änderung des Betriebszweckes darauf also keinen Einfluss hat. Die individualrechtliche Weitergeltung bezieht sich allerdings nicht auf den gesamten Firmentarifvertrag, sondern nur auf den normativen Teil81, das heißt auf Inhaltsnormen und Betriebsnormen, die in untrennbarem Zusammenhang mit der Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten stehen82. Die im Firmentarifvertrag zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs geregelten Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis werden in dieses transformiert, wobei auch nur Regelungen mit zwingender Wirkung individualrechtlich fortgelten können83. Für das Verhältnis des fortgeltenden Tarifvertrages zu individual- vertraglichen Vereinbarungen gilt das Günstigkeitsprinzip aus § 4 Abs.3 TVG analog, womit von beiden Regelungen für die selbe Materie die für den Arbeitnehmer Günstigere gilt84. Die in das Arbeitsverhältnis transformierten Regelungen dürfen nach § 613a Abs.1 S.2 BGB innerhalb eines Jahres nicht geändert werden. Eventuelle Änderungen wären dann nach § 134 BGB unwirksam85. Änderungen vor Ablauf der Jahresfrist sind allerdings möglich, wenn der Tarifvertrag vorher ausläuft, § 613a Abs.1 S.4 1.Alt. BGB. Außerdem fällt die individualrechtliche Fortgeltung des Firmentarifvertrages ab dem Zeitpunkt weg, in dem die Arbeitsvertragsparteien die Geltung eines anderen Tarifvertrages vereinbaren, § 613a Abs.1 S.4 2.Alt. BGB. Dann greift nämlich wieder S.3 ein.
Auch nach Ablauf der Jahresfrist entfällt die zwingende Wirkung der transformierten Tarifnormen. Sie gelten dann als arbeitsvertragliche Einheitsregeln, das heißt sie können auch zu Lasten der Arbeitnehmer geändert werden86.
II. Betriebsteilübergang:
Andere Probleme ergeben sich, wenn nur Teile des Betriebes veräußert werden.
1. Kollektivrechtliche Fortgeltung:
Der Firmentarifvertrag kann unter den gleichen Voraussetzungen wie beim Betriebsübergang kollektivrechtlich fortwirken, der Erwerber muss sich an diesen binden wollen.
2. Individualrechtliche Fortwirkung:
Will er dies nicht, so wirken die Normen nach § 613a Abns.1 S.2 BGB individualrechtlich fort. Problematisch wird das nur, wenn der veräußerte Betriebsteil nicht mehr der gleichen Gewerkschaft unterfällt. Ob eine individualrechtliche Fortwirkung dann möglich ist, ist umstritten.
a) Transformation in das Individualarbeitsverh ä ltnis:
Die herrschende Meinung bejaht auch in diesen Fällen, in denen die Arbeitnehmer eigentlich nicht mehr in den Geltungsbereich des Firmentarifvertrages fallen, die Transformation der Normen des Tarifvertrages nach § 613a Abs.1 S.2 BGB87. Der Wortlaut des § 613a Abs.1 S.2 BGB gebe keinen Anlass für eine Einschränkung des Anwendungsbereiches. Gegen eine solch großzügige Anwendung bestehen allerdings Bedenken88. § 613a garantiere dem Arbeitnehmer keinen Betsandsschutz schlechthin. Gegen einen Wegfall der Geltungsvoraussetzungen seien die Arbeitnehmer ohne einen Betriebsinhaberwechsel auch nicht geschützt. Die Norm solle vorrangig den Bestandsschutz der Tarifnormen bei fehlender Bindung, beim Firmentarifvertrag in der Regel anzunehmen, garantieren.
Danach kann eine Transformation der Normen des Firmentarifvertrages bei fehlenden Geltungsvoraussetzungen nicht aus § 613a Abs.1 S.2 BGB in Betracht kommen.
b) Anwendung des § 4 Abs.5 TVG:
Eine andere Ansicht schützt die Normen des Firmentarifvertrages durch die entsprechende Anwendung von § 4 Abs.5 TVG89. Danach sei es wegen rechtsmissbräuchlicher Umgehung der Tarifgeltung so zu sehen. Kritiker lehnen auch eine Nachwirkung der Tarifnormen ab90. Begründet wird dies damit, dass Tarifnormen, die aus dem
Geltungsbereich herausfallen überhaupt keinen Geltungsanspruch haben. § 4 Abs.5 TVG reagiere auch nur auf den Ablauf des Tarifvertrages. Ein neu abgeschlossener Tarifvertrag würde für die übertragenen Betriebsteile keine Wirkung entfalten, da diese einem neuen Geltungsbereich unterfallen.
Der Firmentarifvertrag ist eben auch speziell auf den Betrieb zugeschnitten, dessen Arbeitgeber ihn abschließt. Die übertragene Betriebsteile fallen dort hinaus sobald sie organisatorisch aufgelöst sind. Mithin ist eine Nachwirkung der Tarifnormen aus § 4 Abs.5 TVG ausgeschlossen.
c) Vertragsrechtliche Tarifwirkung:
Rieble verlangt auch eine Fortgeltung der Tarifnormen, allerdings nimmt er einen Vertragsinhaltsschutz der aktuellen tariflichen Arbeitsbedingungen zum Zeitpunkt des Betriebsteilübergangs an91 . Dies gelte nur für Individualnormen, die das Arbeitsverhältnis regeln und in es eingehen können. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Tarifgeltung einem individualrechtlichen Änderungsvertrag gleichzustellen.
d) Bewertung:
Die vertragsrechtlich Tarifwirkung erscheint hier vorzugswürdig.
Aufgrund des Schutzes und der Bindung an den Firmentarifvertrag haben die Arbeitnehmer darauf verzichtet, sich Verbesserungen (Lohnerhöhungen etc.) individualrechtlich zu sichern. Lässt man diese Wirkungen des Firmentarifvertrages bei Betriebsteilübergang entfallen, weil die Teile organisatorisch aufgelöst wurden, fielen sämtliche Verbesserungen weg und der Arbeitsvertrag ist einzig gültig. Ein solches Ergebnis kann nicht zufrieden stellen und wird ja auch einheitlich abgelehnt. Arbeitnehmer, die nicht tarifgebunden waren hätten sämtliche
Verbesserungen in Änderungsverträgen gesichert, die nach § 613a Abs.1 S.1 BGB auf den neuen Inhaber übergingen. Eine
Ungleichbehandlung beider Gruppen könnte nicht gerechtfertigt werden. Beides ist allerdings vergleichbar, womit das Arbeitsverhältnis nach Wegfall der Tarifnormgeltung des zuletzt gewonnenen Inhalt haben. Den anderen Lösungsansätzen sind die genannten Kritikpunkte entgegenzuhalten.
3. Ergebnis:
Eine kollektivrechtliche Fortgeltung des Firmentarifvertrages in dem veräußerten Betriebsteil ist abzulehnen, wenn der Betriebszweck sich ändert oder der Erwerber sich nicht an diesen binden will.
Individualrechtlich können die Tarifnormen aber auch trotz organisatorischer Auflösung fortwirken, da diese vertragsrechtlich zum Inhalt des Arbeitsverhältnisses werden. Existieren die übernommenen Teile selbständig weiter, kommt eine individualrechtliche Fortgeltung unter den gleichen Voraussetzungen wie beim Betriebsübergang in Betracht.
B. Übergang durch Gesamtrechtsnachfolge:
Der neue Rechtsträger, der den Betrieb durch Gesamtrechtsfolge erwirbt, kann auch noch nicht tarifgebunden sein.
I. Kollektivrechtliche Fortwirkung:
Der Firmentarifvertrag gilt bei einem Betriebsübergang durch Gesamtrechtsnachfolge auch bei einem nicht- tarifgebundenen
Erwerber kollektivrechtlich fort. Unterschiede zum tarifgebundenen neuen Rechtsträger sind insoweit nicht vorhanden. Insbesondere wenn der neue Inhaber vor Betriebsübergang noch keine eigenen Arbeitnehmer beschäftigte und bei der Verschmelzung durch Neugründung ergeben sich keine Probleme und der Firmentarifvertrag kann in vollem Umfang kollektivrechtlich fortwirken.
Fraglich ist allerdings wie sich die kollektivrechtliche Fortwirkung gestaltet, wenn der Erwerber bei Betriebsübergang schon eigene Arbeitnehmer beschäftigt. Eine Ansicht lehnt eine kollektivrechtliche Weitergeltung unter diesen Bedingungen ab, da sich der Geltungsbereich des Firmentarifvertrages dann auf alle Arbeitsverhältnisse erstrecke92. Für eine solche Ausweitung dieser Rechtsbeziehung bestehe weder Anlass noch Rechtfertigung.
Die Gegenansicht bejaht eine kollektivrechtliche Weitergeltung mit der Begründung, dass sich der Firmentarifvertrag auf die übernommenen Arbeitnehmer reduziere93. Ein Firmentarifvertrag beziehe sich auf die betrieblichen Verhältnisse des den Vertrag abschließenden Rechtsträgers. Das war nicht der Erwerber, womit eine Geltung für „seine“ Arbeitnehmer ausgeschlossen sei. Daher ist eine kollektivrechtliche Fortgeltung des
Firmentarifvertrages für die übernommenen Arbeitnehmer auch zu befürworten.
II. Individualrechtliche Fortwirkung:
Folgt man der hier vertretenen Ansicht, wird eine individualrechtliche Fortgeltung meist nicht mehr in Betracht kommen. Eine Ausnahme besteht, wenn der Erwerber den Firmentarifvertrag kündigt. Dann gilt allerdings nichts anderes als bei der individualrechtlichen Fortgeltung beim Erwerb durch Rechtsgeschäft, § 613a Abs.1 S.2 BGB muss angewendet werden. Das gilt auch, wenn mit der anderen Ansicht eine kollektivrechtliche Weitergeltung abgelehnt wird.
Zusammenfassung:
Ist der Erwerber bei Betriebs(teil)übergang durch Rechtsgeschäft bereits tarifgebunden, so wird entgegen der h.M. auch bei nur einseitiger Tarifbindung des Arbeitgebers § 613a Abs.1 S.3 BGB anzuwenden sein, es gilt dann der Tarifvertrag des Erwerbers.
Besteht noch keine Tarifbindung kann eine kollektivrechtliche Fortgeltung des Firmentarifvertrages in Betracht kommen, wenn sich der Erwerber an diesen binden will. Ist das nicht der Fall, kommt es zur individualrechtlichen Fortgeltung der Normen des Firmentarifvertrages aus § 613a Abs.1 S.2 BGB.
[...]
1 MünchArbR §256 Rnr.13.
2 ErfKomm-Schaub §3 TVG Rnr.17.
3 Hromadka/Maschmann ArbR 2 S.471.
4 RGRK §613a Rnr.185.
5 Coester-Waltjen, JK 2002 BGB §613a/2.
6 Schwerdtner, JK 1987 BGB §613a/193.
7 BAG ZIP 1994, 1797, 1800; ZIP 2001, 626, 628.
8 Staudinger-Richardi/Annuß §613a Rnr.193; Erman-Hanau §613a Rnr.95; MünchArbR §120 Rnr.182; Gussen Rnr.233ff; ErfKomm-Preis §613a Rnr.77f.
9 Kania, DB 94, 530.
10 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E110.
11 Zöllner, DB 95, 1403; Moll, RdA 96, 280.
12 S.S.2.
13 Zöllner, DB 95, 1404..
14 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E112.
15 Zöllner, DB 95, 1404.
16 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E113.
17 Moll, RdA 96, 280.
18 BAG AP Nr.15 zu §4 TVG Ordnungsprinzip.
19 BT-Drucks. 8/3317 S.11.
20 BAG AP Nr.20 zu §4 TVG Tarifkonkurrenz.
21 ErfKomm-Preis §613a Rnr.105f.
22 Zöllner, DB 95, 1405; Hromadka, DB 96, 1876.
23 Heinz, DB 98, 1866.
24 Soergel-Raab §613a Rnr.125; Gussen Rnr.236.
25 Zöllner, DB 95, 1404; Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E119.
26 BAG AP Nr.20 zu §4 TVG Tarifkonkurrenz.
27 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E101.
28 MünchArbR §124 Rnr.44.
29 MünchArbR §124 Rnr.44.
30 MüKo- Schaub §613a Rnr.133.
31 MüKo- Schaub §613a Rnr.133.
32 Rieble, Anm. zu BAGE v. 14.06.1994, SAE 95, 75, 78.
33 Gussen Rnr.200; RGRK §613a Rnr.200.
34 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E85.
35 GmbH-Hb. Teil IV-Moll Rnr.605; ErfKomm- Preis §613a Rnr.95; FS für Hilger/Stumpf- Hanau/Vossen S.198.
36 Däubler, RdA 95, 137.
37 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E73; Däubler, RdA 95, 140; Wieland Rnr.287.
38 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E76; Däubler, RdA 95, 140; BAG AP Nr.10 zu §2 TVG Tarifzuständigkeit.
39 MünchArbR §296 Rnr.33; Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E77.
40 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E77.
41 Kempen, BB 91, 2010; Däubler, RdA 95, 137.
42 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E81.
43 Gaul, NZA 95, 723; Däubler, RdA 95, 142; Kempen, BB 91, 2010f.
44 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E80; Boecken Rnr.207.
45 Kempen, BB 91, 2010.
46 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E80.
47 GmbH-Hb. Teil IV- Moll Rnr.605.
48 GmbH-Hb. Teil IV- Moll Rnr.605.
49 GmbH-Hb. Teil IV- Moll Rnr.605.
50 Schiefer, NJW 98, 1821.
51 BGBl. I 1980 S.1308.
52 Wiedemann/Stumpf §4 TVG Rnr.73.
53 Wiedemann/Stumpf §4 TVG Rnr.74f.
54 Hueck-Nipperdey LB des ArbR Bd.II §1 S.473.
55 Hanau/Vossen FS Hilger/Stumpf, S.296.
56 Mösenfechtel/Schmitz, RdA 76, 108.
57 Seiter, AR-Blattei, Betriebsinhaberwechsel I, 15. FSBlatt.
58 Wiedemann/Stumpf §3 TVG Rnr.73; Mösenfechtel/Schmitz, RdA 76, 108f.
59 Mösenfechtel/Schmitz, RdA 76, 109.
60 Kempen, BB 91, 2008; Jung, RdA 81. 362.
61 Kempen, BB 91, 2008.
62 Moll, RdA 96, 275.
63 Gussen S.132; Kania, DB 94, 533.
64 Kania, DB 94, 534.
65 Moll, RdA 96, 275; GmbH-Hb. Teil IV-Moll Rnr.418; StaudingerRichardi/Annuß §613a Rnr.178.
66 Moll, RdA 96, 275.
67 Kempen/Zachert §3 TVG Rnr.57; Moll, RdA 96, 275.
68 Gussen Rnr.199.
69 Erman-Hanau §613a Rnr.79.
70 MüKo- Schaub §613a Rnr.134.
71 Kittner/Zwanziger- Bachner §117 Rnr.5;
Hagemeier/Kempen/Zachert/Zilius §613a Rnr.43.
72 Gussen Rnr.197.
73 MüKo- Schaub §613a Rnr.133.
74 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E70.
75 Henssler, ZfA 98, 533.
76 Gussen Rnr.198.
77 GmbH-Hb. Teil IV-Moll Rnr.607.
78 h.M.: Kania, DB 94, 534; Wank, NZA 87, 507; ErfKomm-Preis §613a BGB Rnr.95; Erman-Hanau §613a Rnr.79; Soergel-Raab §613a Rnr.106; MünchArbR §124 Rnr.182; Henssler, ZfA 98, 532; Willemsen/Hohenstatt/Schweibert E70.
79 MünchArbR §124 Rnr.186.
80 Kittner/Zwanziger §117 Rnr.10.
81 Preis/Steffan FS für Kraft S.482.
82 Kittner/Zwanziger §117 Rnr.12; a.A. MünchArbR §124 Rnr.187.
83 Kittner/Zwanziger §117 Rnr.13; MünchArbR §124 Rnr.188.
84 MünchArbR §124 Rnr.189.
85 Preis/Steffan FS für Kraft S.483; Moll, RdA 96, 279.
86 Preis/Steffan FS für Kraft S.483.
87 Gussen Rnr.201; Düwell in: Rieder, Betriebsübergang S.193, 217.
88 Rieble, Anm. zu BAGE v. 14.06.1994, SAE 95, 75, 79; Lieb ArbR Rnr.318.
89 Lieb ArbR Rnr.318; MüKo- Schaub §613a Rnr.133.
90 Rieble, Anm. zu BAGE v. 14.06.1994, SAE 95, 75, 82.
91 Rieble, Anm. zu BAGE v. 14.06.1994, SAE 95, 75, 82.
92 Hanau, ZGR 90, 555; Gaul, NZA 95, 722.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Firmentarifvertrag?
Ein Firmentarifvertrag ist eine spezielle Art von Tarifvertrag, der zwischen einem einzelnen, tariffähigen Arbeitgeber und der für sein Unternehmen zuständigen Gewerkschaft abgeschlossen wird. Er regelt hauptsächlich die Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern.
Wie wirkt sich ein Firmentarifvertrag aus?
Nach § 3 Abs. 1 TVG gilt ein Firmentarifvertrag für Gewerkschaftsmitglieder, die somit tarifgebunden sind. Unter Umständen kann er auch auf nicht gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer wirken, wenn er nach § 5 TVG für allgemeinverbindlich erklärt wurde.
Was passiert mit einem Firmentarifvertrag bei einem Betriebsübergang durch Rechtsgeschäft (§ 613a BGB)?
Bei einem Betriebsübergang geht der Erwerber grundsätzlich in die Rechte und Pflichten aus den Arbeitsverhältnissen ein. Ob der Firmentarifvertrag kollektivrechtlich fortwirkt, hängt davon ab, ob die Zuständigkeit der Gewerkschaft gleich bleibt. Ist der Erwerber bereits an einen Tarifvertrag gebunden, kann die kollektivrechtliche Fortgeltung ausgeschlossen sein. In bestimmten Fällen kann eine individualrechtliche Fortgeltung nach § 613a Abs. 1 BGB in Betracht kommen.
Was versteht man unter "kollektivrechtlicher Fortgeltung" im Zusammenhang mit einem Firmentarifvertrag?
Kollektivrechtliche Fortgeltung bedeutet, dass der Firmentarifvertrag weiterhin als Tarifvertrag gilt, wenn sich die Zuständigkeit der Gewerkschaft nicht ändert, also der Betriebszweck gleich bleibt. Die Normen wirken direkt und zwingend für die tarifgebundenen Arbeitnehmer.
Was bedeutet "individualrechtliche Weitergeltung" des Firmentarifvertrags nach § 613a Abs. 1 BGB?
Individualrechtliche Weitergeltung bedeutet, dass die Rechte und Pflichten aus dem Firmentarifvertrag Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem Arbeitnehmer und dem neuen Inhaber werden. Diese Rechte und Pflichten werden quasi in den individuellen Arbeitsvertrag transformiert. Dies kann ausgeschlossen sein, wenn beim Erwerber ein anderer Tarifvertrag gilt.
Gilt automatisch der neue Tarifvertrag des Erwerbers für die übernommenen Arbeitnehmer?
Nein, die Arbeitnehmer unterfallen dem neuen Tarifvertrag nicht automatisch. Es ist strittig, ob eine kongruente Tarifgebundenheit (sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sind an den gleichen Tarifvertrag gebunden) erforderlich ist, damit § 613a Abs. 1 S. 3 BGB zur Anwendung kommt. Die herrschende Meinung verlangt diese kongruente Tarifgebundenheit.
Was passiert, wenn die Zuständigkeit der Gewerkschaft sich ändert (andere Gewerkschaft beim Erwerber)?
Wenn der Erwerber an einen Tarifvertrag mit einer anderen Gewerkschaft gebunden ist, scheidet eine kollektivrechtliche Fortgeltung in der Regel aus. Es ist umstritten, inwieweit die Normen des Firmentarifvertrags individualrechtlich fortwirken können. Die herrschende Meinung erzeugt in diesen Fällen Tarifpluralität (mehrere Tarifverträge im Betrieb), während eine Mindermeinung den Firmentarifvertrag verdrängt sieht.
Was sind die Konsequenzen, wenn man kongruente Tarifgebundenheit verlangt?
Verlangt man kongruente Tarifgebundenheit, wäre der Anwendungsbereich des § 613a Abs. 1 S. 3 BGB sehr gering, da die Normen bis auf wenige Ausnahmen immer individualrechtlich fortwirken würden.
Welche Argumente sprechen dafür, dass nur die Tarifbindung des Arbeitgebers ausreicht, um den Firmentarifvertrag zu verdrängen?
Systematische Auslegung des § 613a Abs. 1 BGB, teleologische Auslegung (Vereinheitlichung der Arbeitsverhältnisse), Entstehungsgeschichte des Gesetzes und das Argument, dass die Beschränkung auf die Tarifbindung des Arbeitgebers die negative Koalitionsfreiheit des Arbeitnehmers nicht verletzt.
Was passiert bei einem Betriebsteilübergang?
In den nicht veräußerten Betriebsteilen gilt der Firmentarifvertrag weiterhin. Für den veräußerten Betriebsteil ist umstritten, ob und wie der Firmentarifvertrag fortwirkt. Kollektivrechtliche Fortgeltung ist unter den gleichen Voraussetzungen wie beim gesamten Betriebsübergang möglich. Individualrechtliche Fortgeltung ist fraglich, insbesondere wenn Neben- oder Hilfsbetriebe übertragen werden und diese nicht mehr dem Geltungsbereich des Firmentarifvertrages unterfallen.
Was passiert bei einem Übergang durch Gesamtrechtsnachfolge (Verschmelzung, Spaltung etc.)?
Auch bei einer Gesamtrechtsnachfolge kann der Firmentarifvertrag kollektivrechtlich fortwirken. Es sind verschiedene Formen der Gesamtrechtsnachfolge zu unterscheiden (Verschmelzung, Spaltung). Problematisch ist die kollektivrechtliche Fortgeltung bei der Fusion, wenn der neue Inhaber schon tarifgebunden ist. Bei der Spaltung ist streitig, ob die neuen Rechtsträger Tarifpartner werden oder nicht.
Was passiert, wenn der Erwerber nicht tarifgebunden ist?
Wenn der neue Inhaber nicht tarifgebunden ist, stellt sich die Frage, ob er den Firmentarifvertrag übernimmt und inwieweit generell ein Tarifzwang besteht. Es ist umstritten, ob der Erwerber automatisch mit dem Betriebsübergang zur Partei des Firmentarifvertrages wird. Die herrschende Meinung lehnt einen Tarifzwang ab.
Was ist die Konsequenz daraus, dass der Erwerber nicht tarifgebunden ist?
Da der Erwerber nicht tarifgebunden ist, können die Normen des Firmentarifvertrages problemlos individualrechtlich fortwirken, weil eine Tarifkonkurrenz oder Tarifpluralität ausgeschlossen ist. Die durch den Tarifvertrag geregelten Rechte und Pflichten werden Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem Arbeitnehmer und dem neuen Inhaber (§ 613a Abs. 1 S. 2 BGB).
- Quote paper
- Sandra Gröbler (Author), 2002, Das Schicksal von Firmentarifverträgen bei Betriebsübergang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106979