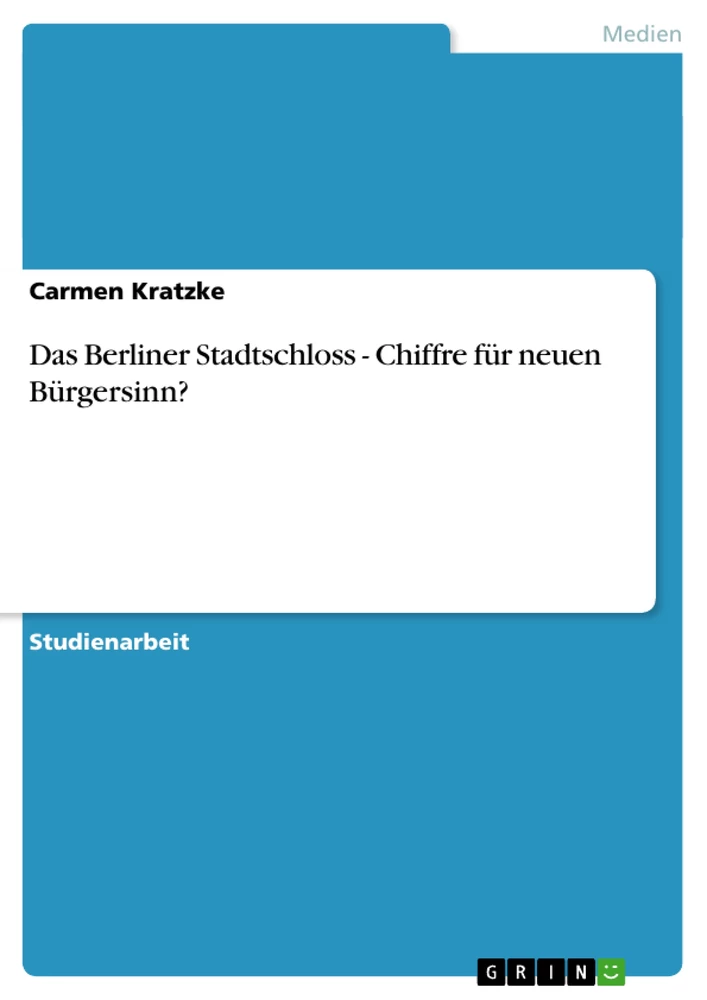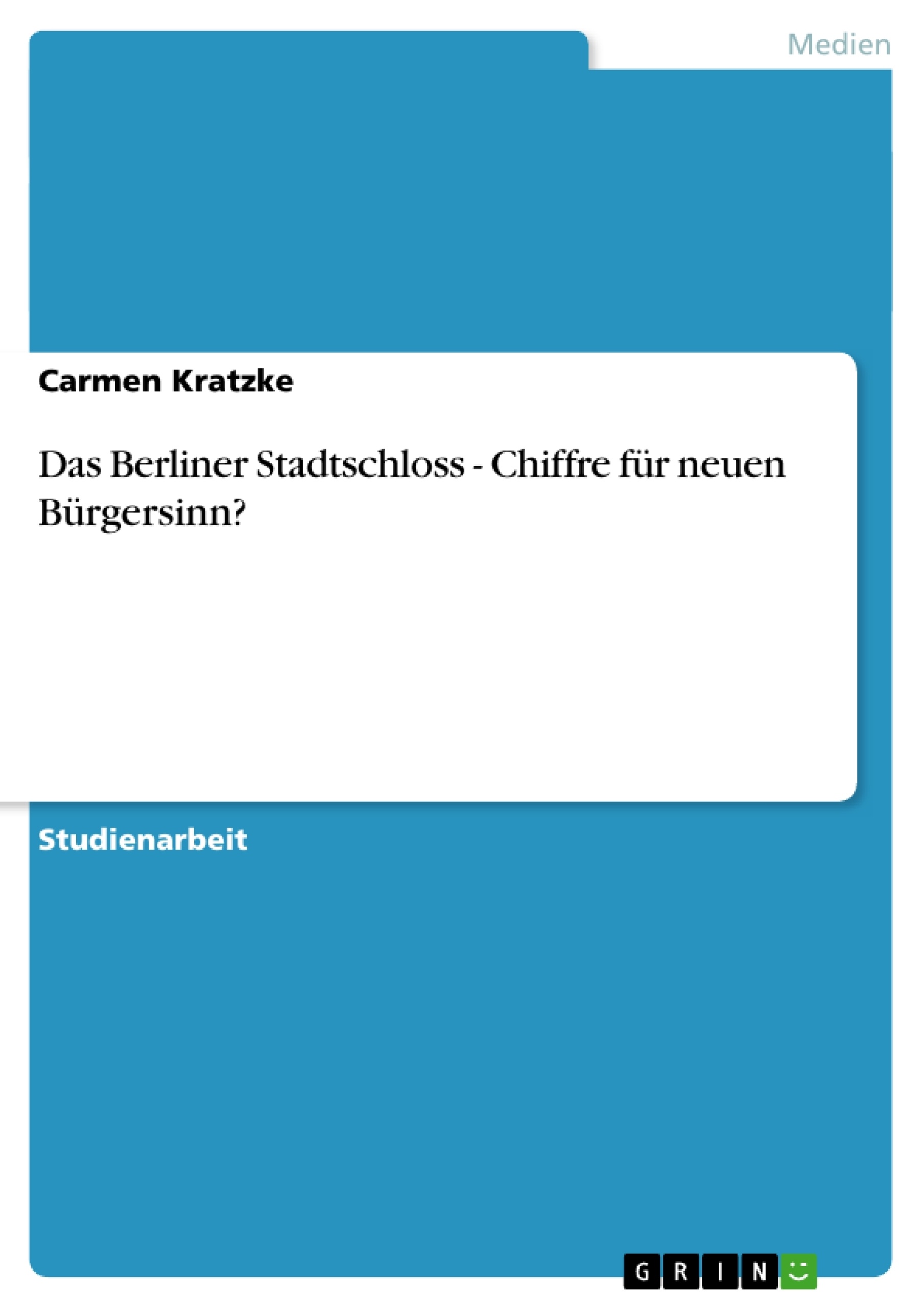Das Schloss - eine Chiffre für neuen Bürgersinn?
„Eine Sehnsucht geht um in Berlin: die Sehnsucht nach dem Schloss der preußischen Könige, der deutschen Kaiser. Der regierende Bürgermeister will es wieder, der Bundeskanzler will es, die CDU, die Grünen. Diese Sehnsucht ist eine Sehnsucht nach Mitte. Denn wie die Achsen der Stadt heute, wie eh und je, wie gestreckte Zeigefinger auf jenen leeren Platz verweisen, wo Walther Ulbricht 1950 das Haus der Hohenzollern sprengen ließ, so streben die Nervensysteme des politischen Sentiments einem Zentrum zu, in dem seit den Katastrophen des 20. Jh. ein Vakuum herrscht….wenn das Schloss in der Lage ist eine Chiffre für neuen Bürgersinn zu werden, dann sollte man es wiederherstellen“1
Über 500 Jahre war das Stadtschloss ein politisch und städtebaulich wichtiger Teil Berlins. Als Amtssitz der Hohenzollern symbolisierte es nicht nur einen absolutistischen Machtanspruch, sondern bot den Bürgern der damaligen Zeit auch Halt und Orientierung. Durch seine stereometrische Prägnanz bildete der Baukörper wertvolle Raumkanten, nahm wichtig Blickbeziehungen auf fasste den ihn umgebenden Raum. Auf dem Schlossplatz finden sich noch heute Teile der freigelegten Fundamente des ehemaligen Schlosses. Um diese sichtbare Wunde im Stadtgrundriss gruppieren sich städtebaulich zusammenhanglose Einzelfragmente wie der Palast der Republik, das ehemalige Staatsratsgebäude, Schinkels Altes Museum. Der Platz wirkt ungefasst und leer. Diese unbefriedigende Situation war Thema einer fast elfjährigen Debatte, eines städtebaulichen Wettbewerbs und endlosen hitzigen Streitereien zwischen Historikern, Architekten und Lobbyisten aller Art. In diesen Tagen entscheidet der Bundestag über die Zukunft des Areals. Die extra einberufene Expertenkommission „Historische Mitte“2empfiehlt in ihrem Abschlussbericht die Heilung der sich aus der Wunde ergebenden Sehnsucht durch den Abriss des Palastes der Republik und die Errichtung eines Schloss-Neubaus. Dem Schloss wird hier eine kurative Wirkung zugeschrieben. Es soll durch seine städtebauliche Existenz und durch seine fiktive Symbolkraft die Sehnsucht nach Mitte befriedigen. Dies sind hohe Erwartungen an einen seit über 50 Jahren aus dem Stadtgefüge gelöschten Baukörper.
Geschichtliche Prozesse haben die Stadt verändert und Spuren in ihrem Grundriss hinterlassen. Im letzten Jahrhundert hat Berlin den Untergang von vier deutschen Staaten erlebt. Kriegszerstörung, deutsche Teilung und raumgreifende Neuplanungen in der Nachkriegszeit, wie z. B. die Neuanlage von Plätzen und Alleen, lassen sich auch im Umfeld des Schlossplatzes stark spüren und man stellt fest, dass der Ort nicht mehr der selbe ist. (siehe Abbildung 2)
Abbildung 2: Überlagerung der Stadtkarten von 1938( grau) und 1990 (rot)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Zeitgeschichte hat auch dazu beigetragen, dass sich in den letzten 50 Jahren die Zentren der Stadt aus der Mitte gen Osten bzw. gen Westen verschoben haben und sich die städtebauliche Wertigkeit der Berliner Mitte verändert hat.3
Die einstige stereometrische Wirkung des Schlosses kann von keinem der Baukörper am Platz erreicht werden. Am ehesten würde dies vom Palast der Republik erwartet, der in der Nachkriegszeit auf einem Teilbereich des ehemaligen Schlossgrundrisses errichtet wurde. Doch zum einen bedingt durch das gegenüber dem Schloss geringere Bauvolumen, zum anderen durch seine Lage am Randbereich des Areals ist dieses Gebäude nicht in der Lage dem Platz Halt zu geben. Auch die übrigen Gebäude sind mit einer ganzheitlichen Raumkonzeption nicht zu vereinbaren. Sie tragen selbst in Ihrer Gesamtheit nicht zu einer Verbesserung der räumlichen Qualität bei. Hieraus zu schlussfolgern, dass das Schloss als einziger Körper in der Lage wäre ein bauliches Rückgrat für die Berliner Mitte zu bilden, wäre nicht richtig, denn das gesamte Ensemble , auf das es sich bezog fiel der Geschichte zum Opfer.
Politisch symbolisiert das Schloss einen zentralistischen Machtanspruch, der in seiner Ideologie kaum mit unserem heutigen demokratischen Verständnis zu vereinbaren ist, da dort freie Lebens- und Denkprozesse nicht geduldet würden. Warum also sollte die Demokratie als Bauherr die trostlose Brache Berlin Mitte mit Überresten des Hohenzollern- Schlosses überbauen? Verspricht man sich etwa Trost für den durch die eindringlichen Ereignisse des 20. Jahrhunderts gekränkten nationalhistorischen Stolz durch die Pracht des Schlüter- Hofes oder des Eosander Portals? Oder versucht man das lediglich das ruhelose Auge durch Liebreiz und Schönheit zu täuschen? Leider scheint der optische Aspekt allein viele Menschen zufrieden zu stellen. Prägnant hierfür ist auch der Kommentar unseres Bundeskanzlers.Er befürwortet den Neubau „ weil das Schloss schön ist“4Diese rein populistische Bauchaussage, gleichermaßen amüsant, wie erschreckend und enttäuschend, lässt leider auf eine leider zu geringe Durchdringung des Themas schließen.
Aus der Sicht der Denkmalpflege erscheint hier eine zusätzliche Problematik. Das Berliner Stadtschloss stand zwar 500 Jahre am selben Ort, doch veränderte sich sein Gesicht, seine Ausrichtung und Baumasse im Laufe der Zeit. Diese kontinuierlichen Modifikationen und Umbauten waren teils Reaktionen auf städtebauliche Veränderungen in der Umgebung, teils riefen sie Transformationen im Stadtgrundriss hervor. Welche bauliche Ausprägung des Schlosses möchte man denn wieder aufbauen? Welche Epoche und welches Ereignis waren in Zusammenhang mit dem Schloss denn für unser heutiges Verständnis derart wichtig, dass wir es unbedingt baulich wiederholen sollten? Daten und Maßstäbe sucht man vergeblich. Doch genau hier sitzt der springende Punkt. Gerne wird die Zeit vor 1918 als eigentlich identitätsstiftende Epoche für Berlin erwähnt, denn die dramatischen Vorfälle des letzten Jahrhunderts wurde nie richtig verarbeitet. Viel zu gerne würde man sie aus dem kollektiven Gedächtnis der Stadt, und natürlich auch des Landes, streichen. Hier wird deutlich, dass die Deutschen nicht von einer anderen Zukunft träumen, sondern von einer anderen Vergangenheit. Berlin soll zu einer normalen deutschen Stadt werden, Deutschland zu einem normalen Land. Hieraus resultiert eine Vorgehensweise, die für die Berliner Baupolitik kennzeichnend ist: Im Namen der Historie versucht man mit dem 19. am das 21. Jahrhundert anzuknüpfen und dabei die baulich - zeitgeschichtlichen Spuren des 20. Jahrhunderts auszulöschen. Wenn alles nach Plan läuft, wird in wenigen Jahren von den baulichen Zeugnissen unbequemer Zeitabschnitte, wie z. B. der DDR, nichts nennenswertes mehr vorhanden sein.
Ein Indiz dafür ist die eingangs bereits beschriebene Forderung der Kommission „Historische Mitte“ welche in Ihrem Abschlussgutachten den Abriss des Palastes der Republik fordert. Dieses Gebäude, eines der letzten politischen Denkmale für die DDR, sollte schon 1990 aufgrund seiner Asbestverseuchung einem Neubau weichen. Das Verlangen nach einer beschönigenden Korrektur der Geschichte ist angesichts der deutschen Vergangenheit eine verständliche, wenn auch äußerst problematische Sehnsucht. Der Palast ist hierfür ein anschauliches Beispiel, denn wir dürfen ihn nicht nur als Symbol für einen vergangenen Staat und die damit verbundene Teilung begreifen, sondern sollten auch seinen Erinnerungswert für die ostdeutschen Bürger beachten .Sie verbinden mit dem Gebäude weniger Erinnerungen an politische Veranstaltungen ,als an eine Stätte des Vergnügens mit Restaurants, Cafés und Bühnen, vor allem aber einen Ort des politischen Engagements der Wendezeit. Die ostdeutsche Geschichte findet keine Akzeptanz in der westdeutschen Bevölkerung. Man versucht die Ereignisse zu verdrängen und die ostdeutschen Bürger der West- Geschichte anzupassen. Diese Bevormundung zeigt sich auch in den Abrissgedanken für den Palast der Republik .Mit dem Abriss des Gebäudes geht ein weiteres Stück der ostdeutschen Vergangenheit und Identität unter. Der Verlust dieses, wenn auch ungeliebten Denkmals, würde die Wunde „Berliner Mitte“ noch tiefer aufreißen.
Das 20. Jahrhundert war eine wichtige Epoche für Berlin. Die zeitgeschichtlichen Ereignisse wie Moderne, Faschismus, Weltkrieg, Stalinismus, Sozialismus, Kalter Krieg, Revolte und Kapitalismus, um nur einige zu nennen, haben die Stadt geprägt und verändert. In dem kontinuierlichen Wechselspiel Zerstörung, Modifikation und Neuplanung entwickelte sich Berlin zu einem Gemenge widersprüchlicher ideologischer Elemente. Die Geschichtlichkeit kommt hier weniger in der Ansammlung historischer Bausubstanz zum Ausdruck, als in der Auslöschung der baulichen Vergangenheit. Es ist absurd, dass Berlin, gerade wegen des Fehlens der meisten seiner historischen Bauten als ein Ort voller Historie erscheint.
Für welchen zeitgeschichtlichen Abschnitt man sich auch im Zuge eines etwaigen Schlossneubaus entscheiden würde, das historische Gebäude und der Neubau könnten optisch nie identisch sein, da authentisch Pläne fehlen. Das Bild des neuen Schlosses würde sich aus Teilüberlieferungen und Photographien zusammensetzen. Geschichtlichkeit und Authentizität des Neubaus sollen durch scheinbare Präzision im Detail suggeriert werden, während man alles Missbeliebige, nicht Eingängige oder Unökonomische am Neubau zu modifizieren gedenkt.5Wie soll denn eine derartige Verunklärung der Geschichte einen Symbolcharakter erhalten? Das eigentlich Echte, Authentische in unseren Erinnerungen würde seinen Wert gegenüber dem historisch gewordenen verlieren. Der Neubau würde zu einer willkürlichen, toten Abstraktion, die lediglich optisch ausgehungerte Touristen befriedigen würde. Eine Kulissenarchitektur als optisch hochwertiger Hintergrund für Fotos, ähnlich dem Pariser Platz. Dieser Ansatzpunkt der Geschichtsbeschönigung lässt die in Berlin stark verfochtenen Ideologien der Kritischen Rekonstruktion für diesen Bereich zu leeren Phrasen werden. Ziel der Kritischen Rekonstruktion sollte es nicht sein, Berlin einem einzelnen Bauwerk anzupassen, sondern sich auf bewährte Strukturen zu besinnen und differenzierte Denkansätze für eine lebenswertere Stadt zu schaffen.
Mit den ideologischen Ansätzen einer Schlossimitation ist natürlich auch ein enormer Kostenfaktor verbunden. 6- 8 Milliarden Euro für einen virtuos gelogenen Platz? Wie viel für eine neue Stadt? Seit wann kann man denn geschichtliche Identifikationspunkte kaufen? Der Neubau könnte maximal zu einem interessanten Exempel für mediale Architektur werden, jedoch hat der Schlossplatz eine dafür zu wichtige Bedeutung für Berlin. Die Signalwirkung eines derartigen Großprojektes ist nicht zu unterschätzen. Eine Welle von Rekonstruktionen wäre zwar nicht unmittelbar zu befürchten, jedoch wird die Haltung der Gesellschaft zu Denkmalen und Geschichte im Allgemeinen einen prekären Wandel erfahren. Die Zerstörung von originaler Substanz mit anschließender Rekonstruktion würde vollends hoffähig. Doch Erinnerungskultur braucht das Authentische und die authentische Erinnerung an die Schlossbaugeschichte sind historische Fundstücke und Fragmente. Sie werden aussagekräftiger und wirkungsvoller sein als jede Schlossreplik und sie bedeuten als originale Einzelteile mehr als eine bauliche Lüge.
Ein geschichtsverleugnender Neubau wird nie die Option auf einen Denkmalstatus erhalten. Schon eher wäre dies denkbar, wenn der Ort neu interpretiert würde. Die bürgerliche Unruhe und Unzufriedenheit und die bevorstehende Wahl treiben den Entscheidungsprozess mit Zeitdruck voran. Dabei gäbe es doch die Möglichkeit den Raum erstmal anderweitig zu bespielen. Keine Nutzung mehr als Parkplatz oder qualitativ minderwertiger Rummelplatz, sondern beispielsweise Lesungen , Ausstellungen , Freilichttheater. Eine Belebung der Mitte nicht durch Zwang von oben, sondern durch die Bürger. Eine Heilung der Wunde aus der Mitte heraus. Diese neue Symbolik kann eher zu einer Lösung der Problematik führen, als die erzwungene Standpunktdiskussion um Geschichtsverleugnung.
Wie zu erkennen ist, ist die derzeitige Brache am Schlossplatz ist sowohl in städtebaulicher, als auch in politisch - ideologischer und geschichtlicher Hinsicht problematisch und unbefriedigend .Es reicht nicht einen Teilaspekt des Themas beleuchten, denn es geht hier nicht um die Neuerstellung eines Bauwerks, sondern um ein sensibles Verständnis für geschichtlichen Gefüge in Zusammenhang mit der Sehnsucht nach Mitte als der politischen Botschaft . Diese Sehnsucht sitzt tief. Sie lässt sich nicht auf Optik, Raumgefühl und Geschmack reduzieren. Deutschland ist nach der langen Teilung immer noch auf der Suche nach einer Basis für eine gemeinschaftliche Geschichte. Dies ist in Berlin, als ehemals geteilter Stadt deutlicher spürbar als an jedem anderen Ort. Vor allem den ostdeutschen Bürgern fehlt ein Symbol für den Neubeginn für eine gemeinsame deutsche Geschichte. Die Erinnerung an gefestigte Werte aus der Vorkriegszeit ist somit verständlich. Diese Suche nach einer neuen Mitte ist nicht durch Blendwerke und Attrappen zu befriedigen. Unter diesen Umständen ist das Schloss nicht in der Lage Chiffre für einen neuen Bürgersinn zu werden. Die Befriedigung wäre nur von kurzer Dauer, denn das Bewusstsein des Volkes lässt sich nicht täuschen. Der Respekt vor allem vor der ostdeutschen Geschichte würde einen kompletten Neuentwurf für den Ort fordern, der die baulichen Zeugnisse des Vergangenen und den heutigen Stadtgrundriss respektiert und dadurch Halt und Zuversicht gibt. Ein Bauwerk, gelöst von der übertriebenen Sehnsucht nach der guten Geschichte wäre ehrlich. Wichtig hierfür ist der Ort und nicht der Versuch der krampfhaften Belebung vergangener Epochen. Eine solche Maßnahme wäre identitätsfördernd und würde alle Probleme auf einen Schlag lösen.
Eine Monumentalarchitektur wäre aus geschichtlichem Pathos auch mit kultureller Nutzung in der heutigen Zeit mit Vorsicht zu genießen, selbst unter einem etwaigen Gesichtspunkt „function follows form“. Leicht könnte die Bedeutung ins Negative kippen. Deshalb muss das zukünftige Element in erster Linie denen zur Verfügung stehen, die den Halt suchen: den Bürgern.
Abbildung 1: Abriss des Schlüter- Hofes .in: www.berliner-schloss.de
Abbildung 2: Überlagerung Stadtkarte 1938/ 1990 .in: www.stattwerkstatt.de
[...]
1Schuller, Konrad. Sehnsucht nach Mitte, in: FAZ 26.05.2000, Nr.122 S.12
2 Abschlussbericht der Expertenkommission „Historische Mitte“.in: www.berliner-schloss.de
3 Stadtwerkstatt Berlin, Der Reader. In: www.Stadtwerkstatt.de
4 Schröder, Gerhard. Kommentar zur Schlossdebatte , in: www.berliner-schloss.de
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Das Schloss - eine Chiffre für neuen Bürgersinn?"?
Der Text befasst sich kritisch mit dem Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses und hinterfragt, ob es wirklich eine Lösung für die "Sehnsucht nach Mitte" sein kann. Er untersucht die städtebaulichen, politischen, ideologischen und geschichtlichen Aspekte dieser Entscheidung.
Welche Rolle spielte das Berliner Stadtschloss historisch?
Das Stadtschloss war über 500 Jahre ein wichtiger Teil Berlins, sowohl politisch als auch städtebaulich. Es symbolisierte die Macht der Hohenzollern, bot aber auch Orientierung für die Bürger.
Warum wurde das Schloss abgerissen?
Walther Ulbricht ließ das Schloss der Hohenzollern 1950 sprengen.
Was befindet sich heute an der Stelle des Schlosses?
Heute befinden sich dort Teile der freigelegten Fundamente des ehemaligen Schlosses, der Palast der Republik, das ehemalige Staatsratsgebäude und Schinkels Altes Museum.
Was ist die "Sehnsucht nach Mitte"?
Die "Sehnsucht nach Mitte" beschreibt das Bedürfnis nach einem Zentrum in Berlin, das seit den Katastrophen des 20. Jahrhunderts fehlt. Das Schloss soll diese Sehnsucht befriedigen.
Was empfiehlt die Expertenkommission "Historische Mitte"?
Die Kommission empfiehlt den Abriss des Palastes der Republik und die Errichtung eines Schloss-Neubaus, um die "Sehnsucht nach Mitte" zu heilen.
Welche Kritik wird am Wiederaufbau des Schlosses geäußert?
Der Text kritisiert, dass das Schloss einen zentralistischen Machtanspruch symbolisiert, der nicht mit dem heutigen demokratischen Verständnis vereinbar ist. Außerdem wird hinterfragt, welche historische Ausprägung des Schlosses wiederaufgebaut werden soll und ob der Neubau authentisch sein kann.
Was wird über den Palast der Republik gesagt?
Der Palast der Republik wird als ein Denkmal für die DDR gesehen, das nicht abgerissen werden sollte, da er für viele Ostdeutsche einen Erinnerungswert hat.
Welche Rolle spielt die Kritische Rekonstruktion?
Der Text kritisiert, dass die Ideologien der Kritischen Rekonstruktion im Fall des Schlosses zu leeren Phrasen werden, da es nicht darum geht, Berlin einem einzelnen Bauwerk anzupassen, sondern sich auf bewährte Strukturen zu besinnen.
Welche Kosten sind mit dem Wiederaufbau des Schlosses verbunden?
Die Kosten für den Neubau werden auf 6-8 Milliarden Euro geschätzt.
Welche Alternativen zum Wiederaufbau des Schlosses werden vorgeschlagen?
Es wird vorgeschlagen, den Raum anderweitig zu bespielen, z.B. mit Lesungen, Ausstellungen oder Freilichttheater, um die Mitte durch die Bürger zu beleben.
Warum ist die aktuelle Situation am Schlossplatz problematisch?
Die Brache am Schlossplatz ist sowohl in städtebaulicher, als auch in politisch-ideologischer und geschichtlicher Hinsicht problematisch und unbefriedigend.
Welche Bedeutung hat die ostdeutsche Geschichte?
Der Text betont, dass die ostdeutsche Geschichte in der westdeutschen Bevölkerung keine Akzeptanz findet und dass man versucht, die Ereignisse zu verdrängen und die ostdeutschen Bürger der West-Geschichte anzupassen.
Kann das Schloss eine Chiffre für neuen Bürgersinn werden?
Der Text argumentiert, dass das Schloss unter den gegebenen Umständen nicht in der Lage ist, eine Chiffre für neuen Bürgersinn zu werden, da das Bewusstsein des Volkes sich nicht täuschen lässt und der Respekt vor allem vor der ostdeutschen Geschichte einen kompletten Neuentwurf für den Ort fordern würde.
- Quote paper
- Carmen Kratzke (Author), 2002, Das Berliner Stadtschloss - Chiffre für neuen Bürgersinn?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106873