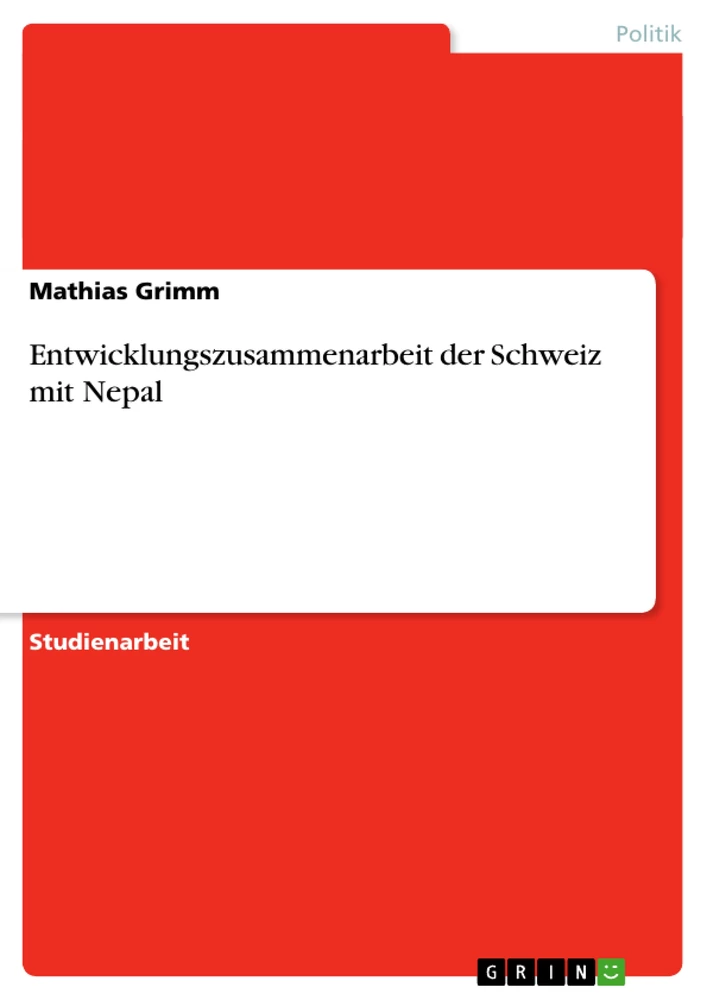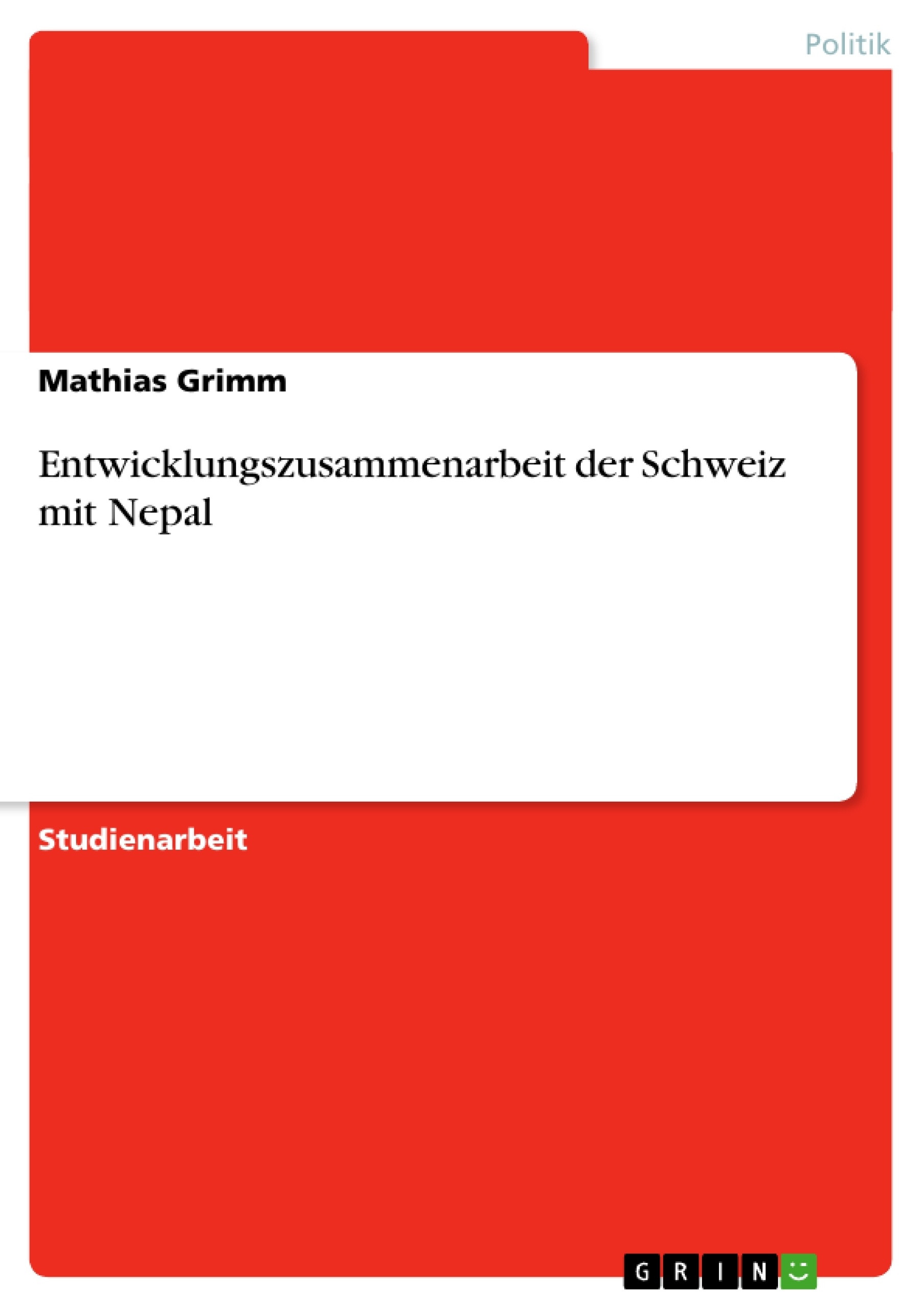Warum engagiert sich ein Land wie die Schweiz bei der Entwicklung ärmerer Länder? Die Arbeit erklärt von einem inderdependenztheoretischen Standpunkt den Begriff "Entwicklung" und beleuchtet aus entwicklungstheoretischer Perspektive die Interessen und Strategien der am Prozess beteiligten Akteure. Am Beispiel der Kooperation zwischen der Schweiz und Nepal wird das Leitbild der DEZA und die zwischen diesen Partnern praktizierte Entwicklungszusammenarbeit kritisch hinterfragt.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
1.1 Fragestellung
1.2 Aufbau der Arbeit und Begründung der Fallauswahl
1.3 Einige Fakten und Kennzahlen
2. Theorie
2.1 Die erste Dilemmafrage: Was bedeutet ”Entwicklung” in Nepal
2.2 Interdependenztheorie
2.3 Entwicklungstheorie
2.4 Wie initiiert man Entwicklung? Die DEZA-Strategie als Antwort auf die zweite Dilemmafrage
3. Schlussfolgerungen und Interpretationen
4. Literaturverzeichnis
Tabellenverzeichnis:
Tabelle 1: Kennzahlen- und Faktenvergleich Nepal -Schweiz:
Tabelle 2: Entwicklungszusammenarbeit des Bundes in Nepal: Schwerpunkte und Aufwand:
1. Einleitung
Durch den Globalisierungsprozess ist die Welt engmaschiger geworden. Die Medien projizieren uns das Leid in anderen Ländern in Bild und Ton direkt ins Wohnzimmer. Die modernen Transportmittel machen es möglich, in weniger als 24 Stunden selbst inmitten des Geschehens humanitärer Katastrophen zu gelangen. Was global passiert, macht uns zunehmends betroffen, Entwicklungsländer sind gar nicht so weit weg.
Betroffenheit ist ein Motiv, in einem Land Entwicklungshilfe zu leisten, es sind aber noch andere Interessen mit der Hilfeleistung in Entwicklungsfragen verbunden. Diesen wird in dieser Arbeit, die im Rahmen des Proseminars für Internantionale Beziehungen des Instituts für Politikwissenschaft verfasst wurde, auf die Spur gegangen.
“Ziel der Entwicklungsarbeit und der humanitären Hilfe ist es, die Lebensbedingungen der Bevölkerungen in ärmeren Ländern zu verbessern...“, so der erste Satz der Zielsetzung im Leitbild der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) im eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (DEZA 1999: 1).
1.1 Fragestellung
Warum aber engagiert sich die Schweiz überhaupt bei der Entwicklung ärmerer Länder? Welches Interesse hat die Schweiz an den Lebensbedingungen in diesen Ländern? Durch welche Strategien werden die Zielsetzungen in der Entwicklungszusammenarbeit verfolgt?
Am Fallbeispiel Nepal analysiere ich die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz auf den Ebenen Interesse und Strategie aus entwicklungstheoretischer Perspektive und aus der Perspektive der Interdependenztheorie. Zum Zweck einer “ganzheitlichen““ Sichtweise wird keine Unterscheidung zwischen bi- und multilateraler Entwicklungszusammenarbeit vorgenommen. Es sollen aber zwei Dilemmas, die vor allem bei der Umsetzung von Entwicklungspolitik eine Rolle spielen, aufgezeigt werden. Nämlich: 1. Was bedeutet Entwicklung? Und: 2. Wie initiiert sie erfolgreich?
1.2 Aufbau der Arbeit und Begründung der Fallauswahl
Zur Klärung dieser Fragen wird zuerst unter Abschnitt 2.1 auf das erste Dilemma der Entwicklungszusammenarbeit am Beispiel Nepal eingegangen. Im Abschnitt 2.2 werden die Interdependenztheorie und im Abschnitt 2.3 die Entwicklungstheorien zur Klärung des Interesses an Entwicklungszusammenarbeit herangezogen. In Abschnitt 2.4 wird aufgezeigt, inwiefern die DEZA durch die Strategie, mit der die entwicklungspolitischen Ziele umgesetzt werden sollen, auf die zweite Dilemmafrage antwortet.
Für die Wahl des Fallbeispiels Nepal waren zwei Gründe ausschlaggebend: Erstens ist Nepal ein Schwerpunktland der Schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit: Die Schweiz engagiert sich seit über vierzig Jahren in diesem Himalayastaat. Zweitens habe ich dort in den Jahren 1996 während vier Wochen und 2001 während drei Wochen Bekanntschaft mit Land und Leuten gemacht und pflege ein paar persönliche Kontakte, soweit dies möglich ist.
Während meinen beiden Aufenthalten in Nepal habe ich mir oft die Frage gestellt, wie dort eine nachhaltige Entwicklung in Gang gesetzt werden könnte. Bei meiner ersten Reise sah ich in der Topographie Nepals die grösste Herausforderung für Entwicklungsanstrengungen. Bei meinem zweiten Aufenthalt stachen mir vor allem ökologische Probleme (Übernutzung des Waldes, Erosion, Wasserwirtschaft, Abfallentsorgung) ins Auge, die eine Entwicklung mit dem Etikett “nachhaltig“ gefährden.
Die neuesten Ereignisse rund um das Massaker am nepalesischen Königshof waren zwar kein Beweggrund für die Wahl dieses Falles, sie bieten aber eine Fülle an aktuellen Informationen über die innenpolitischen Verhältnisse dieses Landes und einen spannenden Interpretationsspielraum in bezug auf die Konsequenzen der künftigen Entwicklungszusammenarbeit mit Nepal. Im Schluss- und Interpretationsteil wird kurz darauf eingegangen.
1.3 Einige Fakten und Kennzahlen
Nepal ist ein Vielvölkerstaat, in dem verschiedene Religions- und Sprachgemeinschaften und ethnische Gruppen zusammenleben. Das Kastenwesen der dominanten indo-arischen Bevölkerung und die grossen sozialen Unterschiede (Stadt / Land, Gebildete / Ungebildete) schaffen aber ein Spannungspotential, welches die Harmonie zwischen den sozialen Gruppen gefährden könnte. In nord-südlicher Richtung kann Nepal topographisch in vier Zonen aufgeteilt werden: in den hohen Himalaja, wovon etwa die Hälfte vergletschert und nicht wirtschaftlich nutzbar ist und die steilen, tief eingeschnittenen fruchtbaren Flusstäler, in die Hügellandschaft vor der Hochgebirgszone und im Süden in die Tiefebene Terrai.
Nepal grenzt an die beiden Länder China und Indien, wobei vor allem zum südlichen Nachbar Indien enge Beziehungen und grosse Abhängigkeiten bestehen. Nepal hatte seit der Staatsgründung 1768 bis 1951 rege Beziehungen mit dem besetzten Tibet und mit Indien. Damals kontrollierte Nepal einen grossen Teil des Handels auf der Seidenstrasse. Aber erst seit 1950 kann von einer Öffnung des Landes nach aussen gesprochen werden. Das heute offenkundige Mächteungleichgewicht zwischen Nepal und seinen Anliegerstaaten beeinflusst die nepalesische Aussenpolitik wesentlich .
Die verbotene maoistischen Communist-Party hat 1996 mit dem Ziel, eine Bauernrepublik zu errichten, den Bürgerkrieg ausgerufen. Seither destabilisieren in einigen Regionen des Landes Guerillagruppen die innenpolitische Lage. Der Staat hat mit Gewalt auf den Widerstand der unterprivilegierten Schichten reagiert. Bisher forderten die Auseinandersetzungen gemäss Helvetas mehr als 1'500 Menschenopfer (Brückenbauer 2001).
Häufig gestellte Fragen
Was ist der thematische Schwerpunkt der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz am Fallbeispiel Nepal. Dabei werden Interessen und Strategien aus entwicklungstheoretischer Perspektive und der Interdependenztheorie beleuchtet. Zwei zentrale Dilemmas werden untersucht: Was bedeutet "Entwicklung" und wie wird sie erfolgreich initiiert?
Warum wurde Nepal als Fallbeispiel gewählt?
Nepal ist ein Schwerpunktland der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit, mit einer über vierzigjährigen Geschichte. Zudem hat der Autor persönliche Erfahrungen und Kontakte in Nepal.
Welche Fakten über Nepal werden in der Einleitung genannt?
Nepal ist ein Vielvölkerstaat mit unterschiedlichen Religions- und Sprachgemeinschaften, aber auch grossen sozialen Unterschieden. Topographisch gliedert sich Nepal in den Himalaja, die Hügellandschaft und die Tiefebene Terrai. Nepal grenzt an China und Indien, wobei vor allem zu Indien enge Beziehungen und Abhängigkeiten bestehen. Innenpolitisch destabilisiert der Bürgerkrieg, der von maoistischen Gruppen ausgerufen wurde, die Lage.
Welche Dilemmas werden bei der Entwicklungszusammenarbeit untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwei Hauptdilemmas: Erstens, die Frage nach der Bedeutung von "Entwicklung" im nepalesischen Kontext. Zweitens, die Frage, wie Entwicklung erfolgreich initiiert werden kann.
Welche Theorien werden zur Analyse herangezogen?
Die Interdependenztheorie und verschiedene Entwicklungstheorien werden verwendet, um die Interessen hinter der Entwicklungszusammenarbeit zu analysieren. Die DEZA-Strategie wird untersucht, um zu sehen, wie sie auf das Dilemma der Initiierung von Entwicklung reagiert.
Was ist das Ziel der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit laut DEZA?
Laut DEZA ist das Ziel der Entwicklungsarbeit und humanitären Hilfe die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerungen in ärmeren Ländern.
Welche Fragen werden in der Einleitung aufgeworfen?
Die Einleitung fragt, warum sich die Schweiz überhaupt in der Entwicklung ärmerer Länder engagiert, welche Interessen die Schweiz an den Lebensbedingungen in diesen Ländern hat und welche Strategien zur Verfolgung der entwicklungspolitischen Ziele eingesetzt werden.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit behandelt in Abschnitt 2.1 das Dilemma der Entwicklungszusammenarbeit am Beispiel Nepal. In den Abschnitten 2.2 und 2.3 werden die Interdependenztheorie und die Entwicklungstheorien zur Klärung des Interesses an Entwicklungszusammenarbeit herangezogen. Abschnitt 2.4 untersucht, wie die DEZA-Strategie auf das zweite Dilemma antwortet. Schliesslich folgen Schlussfolgerungen und Interpretationen.
Was wird über die Rolle des maoistischen Aufstands gesagt?
Die verbotene maoistische Communist-Party hat 1996 den Bürgerkrieg ausgerufen, um eine Bauernrepublik zu errichten. Dies destabilisiert die innenpolitische Lage in einigen Regionen des Landes.
Wie wird die Armut Nepals beschrieben?
Nepal wird als eines der am wenigsten entwickelten und ärmsten Länder der Erde beschrieben. Es rangiert gemäss UNDP-Bericht an 154. Stelle von 175 gelisteten Staaten.
- Quote paper
- lic. phil Mathias Grimm (Author), 2001, Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz mit Nepal, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106825