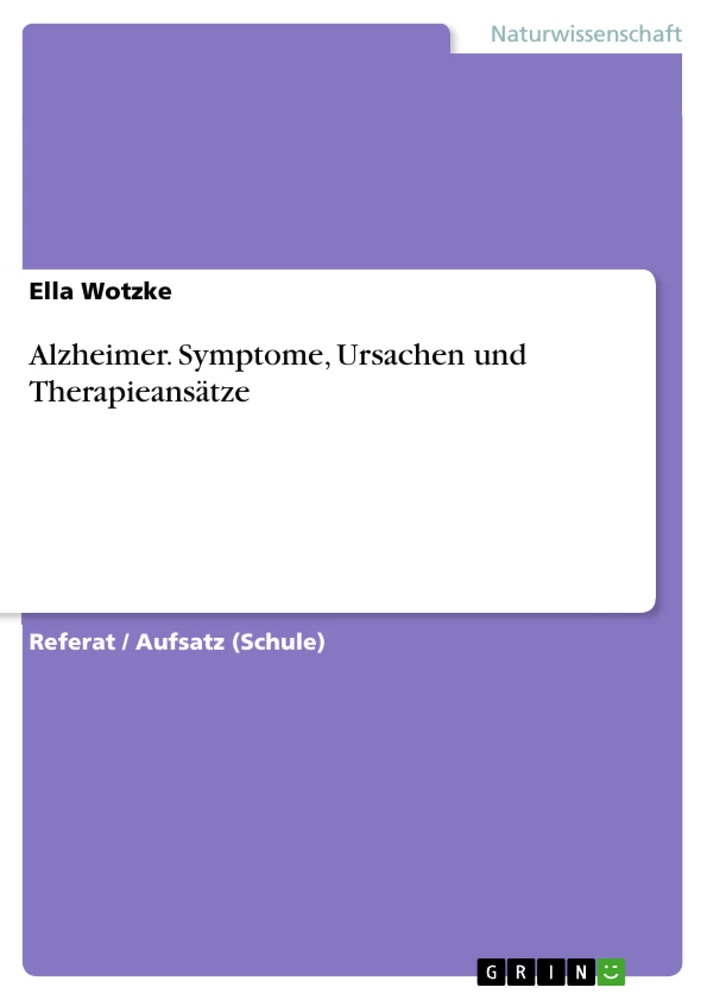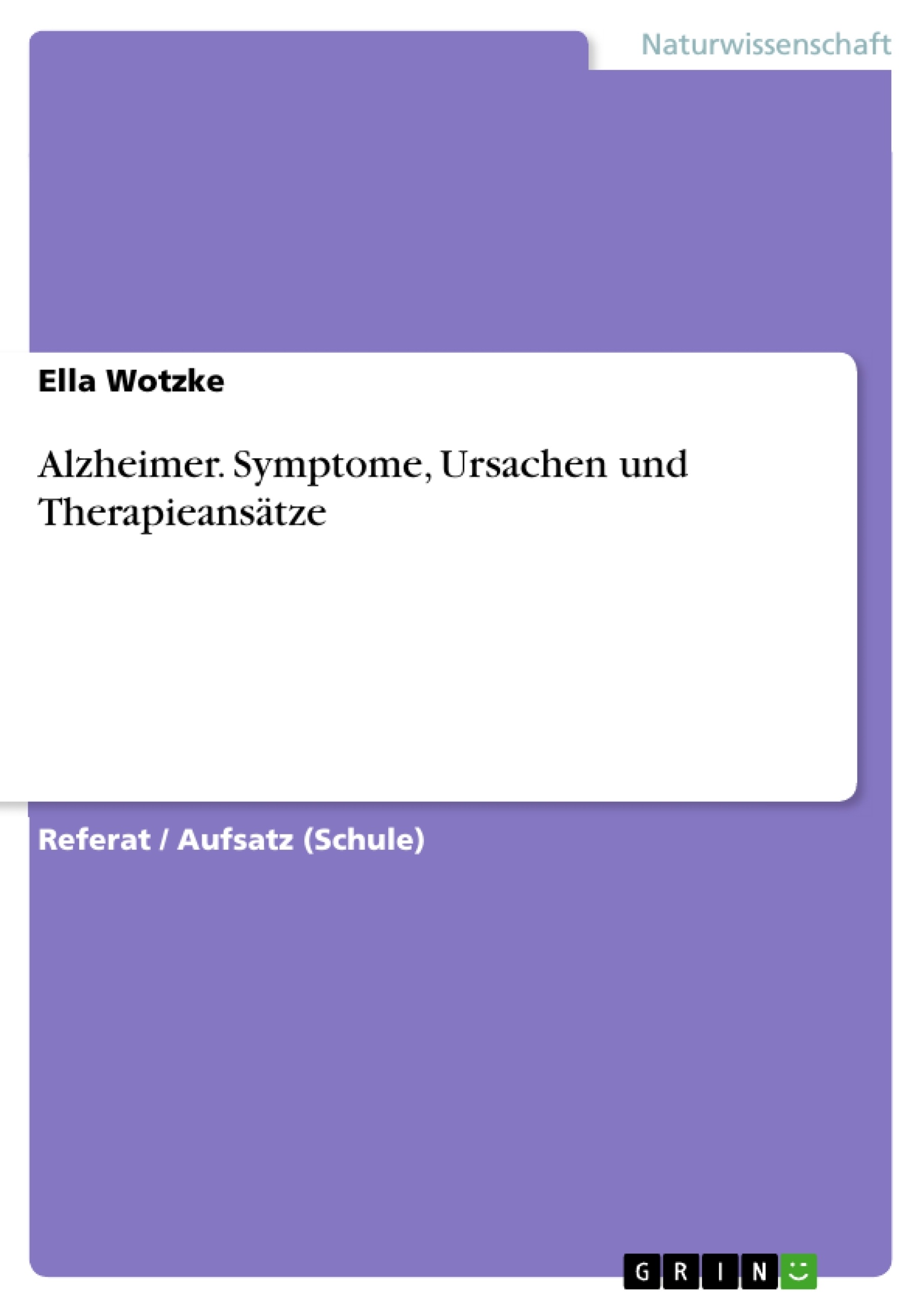Stellen Sie sich vor, Ihre Erinnerungen verblassen, Ihr Geist wird zu einem Nebel, und die Welt um Sie herum verschwimmt unaufhaltsam. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine eindringliche Reise in das Herz der Alzheimer-Krankheit, einer der größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Von den ersten, subtilen Anzeichen bis hin zu den tiefgreifenden Auswirkungen auf das Gehirn und das Leben der Betroffenen, werden die komplexen Symptome, Diagnoseverfahren und pathologischen Veränderungen dieser verheerenden Krankheit detailliert und verständlich erläutert. Entdecken Sie die neuesten Forschungsergebnisse zu den möglichen Ursachen, von genetischen Faktoren und Amyloid-Plaques bis hin zu neurofibrillären Bündeln und dem Einfluss von Apolipoprotein E. Erfahren Sie mehr über die innovativen Therapieansätze, die darauf abzielen, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und die Hoffnung auf eine zukünftige Heilung zu nähren. Die bundesweite Trenduntersuchung an St. Augustiner Altenheimen ermöglicht zudem einen Einblick in die aktuelle Versorgungssituation und die Herausforderungen, denen sich Pflegekräfte und Angehörige täglich stellen müssen. Dieses Buch ist ein unerlässlicher Ratgeber für Betroffene, Angehörige, Pflegepersonal und alle, die sich für die neuesten Erkenntnisse und Behandlungsstrategien im Bereich der Alzheimer-Forschung interessieren. Es bietet nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch praktische Unterstützung und ermutigende Perspektiven im Umgang mit dieser komplexen Krankheit. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Neurowissenschaften und gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für die Alzheimer-Krankheit, ihre Ursachen und die potenziellen Wege zu einer besseren Zukunft für Millionen von Betroffenen weltweit. Die Themen sind: Alzheimer, Demenz, Ursachenforschung, Therapie, Pflege, Neurologie, Gedächtnisverlust, Amyloid, Tau-Protein, Diagnostik, Altenpflege, Neurodegenerative Erkrankungen, Gehirnforschung, Krankheitsverlauf, Lebensqualität, Angehörige, Patientenversorgung, Forschungsergebnisse, Gesundheitswesen, Risikofaktoren, Prävention, Früherkennung, Molekulare Mechanismen, Klinische Studien, Pharmazeutische Interventionen, Psychosoziale Unterstützung, Ethische Aspekte, Gesellschaftliche Auswirkungen, Medizinische Innovationen, Lebensstilfaktoren, Kognitive Funktionen, Neuroinflammation, Oxidativer Stress, Mitochondriale Dysfunktion, Synaptische Plastizität, Neurotransmitter, Bildgebungstechniken, Biomarker, Genetik, Epigenetik, Proteomik, Metabolomik, Systembiologie, Translationale Forschung, Personalisierte Medizin, Digitale Gesundheit, Künstliche Intelligenz, Robotik, Assistenzsysteme, Ambient Assisted Living, Telemedizin, Versorgungsmodelle, Finanzierung, Politik, Recht, Bildung, Aufklärung, Sensibilisierung, Stigma, Inklusion, Teilhabe, Empowerment, Selbsthilfe, Patientenorganisationen, Forschungsethik, Datenintegrität, Open Science, Wissenschaftskommunikation, Citizen Science, Gesundheitskompetenz, Gesundheitsförderung, Präventionsstrategien, Resilienz, Salutogenese, Lebenslanges Lernen, Aktives Altern, Würde, Autonomie, Selbstbestimmung, Palliative Care, Hospiz, Sterbebegleitung, Trauerbegleitung, Spiritualität, Sinnfindung, Hoffnung, Zuversicht, Engagement, Solidarität, Menschlichkeit, Mitgefühl.
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung
1. Symptome und Diagnose
2. Pathologische Veränderungen und mögliche Ursachen
3. Therapieansätze
4. Bundesweiter Trend Untersuchung an St. Augustiner Altenheimen
Literaturverzeichnis
Anhang
EINLEITUNG
Alois Alzheimer(1864-1915),ein deutscher Psychiater und Neuropathologe lernte im November 1901 in der „Städtischen Anstalt für Irre und Epileptische“ in Frankfurt am Main die 51-jährige Auguste Deter (Abb.1) kennen und notiere damals im Kranken- blatt:
„26.XI..1901. sitzt im Bett mit ratlosem Gesichtsausdruck. -Wie heißen Sie? - Auguste.
- Familienname ? - Auguste. -Wie heißt ihr Mann? -Ich glaube Auguste. - Ihr Mann? - Ja, so mein Mann(Versteht offenbar die Frage nicht)- Sind Sie verheiratet? - Zu Auguste. -Frau Deter? - Ja, zu Auguste Deter.“1
Knapp viereinhalb Jahre später entdeckte Alzheimer in der Hirnrinde seiner verstorbenen Patientin hirsekorngroße Ablagerungen, die er mit ihrem merkwürdigen Verhalten in Verbindung brachte. Seitdem ist die Krankheit nach ihm benannt. 1995 fanden Frankfurter Neurologen heraus, dass Alzheimer viel mehr Gefäßveränderungen in Augustes Gehirn dokumentiert hatte und sie nicht an Alzheimer, sondern an einer anderen Demenzform litt.
Heute ist Alzheimer die viert häufigste Todesursache. Tendenz steigend. Prominente
Opfer sind z.B. der ehemalige US-Präsident Ronald Reagen(90) und der Geiger Helmut Zacharias(81).
Jeden kann es treffen...!
1 Symptome und Diagnose
Die „Alzheimer-Krankheit“ oder auch „Morbus Alzheimer“ ist eine primär degenerative Erkrankung des Gehirns- es zeigen sich eine deutliche Atrophie (Abb.6) sowie große, liquorgefüllte Hohlräume- die schleichend beginnt, zu einer ausgeprägten Demenz fortschreitet und mit dem Tod des Betroffenen endet.
Das Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation (ICD-10) unterscheidet zwei Alzheimerformen. Bei einem frühen Beginn spricht man von „präseniler Demenz vom Alzheimertyp (DAT)“, bei späten von „seniler Demenz vom Alzheimertyp (SDAT)“.Trennpunkt ist das 65. Lebensjahr. Bei „DAT“ sind häufig schon ähnliche Fälle in der Familie aufgetreten, so dass genetische Ursachen eine Rolle zu haben scheinen .Es zeichnet sich durch eine rasche Verschlechterung und vermehrt neuropsychologische Störungen aus. Dagegen tritt „SDAT“ eher sporadisch auf. Ein langsamer Verlauf und Gedächtnisstörungen sind das Hauptmerkmal. Eine genaue Trennung ist aber im Grunde nicht möglich, da der frühe Typ auch in höherem Alter ausbricht, und der späte Typ gelegentlich vor dem 65. Lebensjahr vorkommt.
„Der geistige und körperliche Abbau erfolgt bei der Alzheimer-Erkrankung weitgehend in der umgekehrten Reihenfolge wie der Aufbau der entsprechenden Entwicklungs- schritte beim Kind.“2Zunächst machen sich oft vage Störungen der Befindlichkeit wie Leistungsschwäche, Niedergeschlagenheit oder Kopfschmerzen als „Vorboten“ be- merkbar. Bis die Krankheit spürbar wird, können bis zu 30 Jahre vergehen. Die durch- schnittliche Dauer des Krankheitsverlaufs sind 6-8 Jahre, in Einzelfällen 1und bis zu 15 oder sogar 20 Jahre.
Als erstes sind Kurzzeitgedächtnis und räumliche Orientierung betroffen, häufig treten auch Wortfindungsstörungen auf. Diese Merkmale verschlimmern sich stetig im Krank- heitsverlauf und es treten zunehmend neuropsychologische Störungen wie Aphasie (Störungen des Sprechens und Sprachverstehens) und Apraxie (Schwierigkeiten der Bewegungskoordination, z.B. Auto fahren, Ankleiden) hinzu, begleitet von psychiatri- schen Störungen wie leichte Euphorie oder Depressivität, Persönlichkeitsveränderun- gen, Umkehrung des Tag-Nacht-Rhythmus, Wahnvorstellungen, Halluzinationen, feindselige Projektionen der eigenen Schwächen auf andere, Agitation (motorische Un- ruhe), Umherlaufen, Reizbarkeit und Störungen des Sozialverhaltens. Der Erkrankte wirkt oft aphatisch und die Verwirrtheit kann gegen Abend zunehmen („Sundown- ing“).Da dem Betroffenen erst komplizierte Aufgaben, später Routinearbeiten und zum Schluß sogar automatische Verrichtungen schwer fallen, weil er nacheinander alles ver- gißt, ist er zunehmend auf Hilfe angewiesen.
Das Langzeitgedächtnis bleibt noch lange erhalten, am längsten die Kindheitserinnerungen .Mit der Zeit verliert der Mensch den Realitätsbezug, begleitet von einer Agnosie (Unfähigkeit, Objekte und Menschen wiederzuerkennen) und lebt in der Vergangenheit. Manche entwickeln stereotype Verhaltensweisen oder sagen sinnlos einzelne Silben auf (Logoklonie).Im Endstadium verstummt der Betroffene völlig, gelegentlich kann ein anhaltendes, unartikuliertes Schreien vorkommen. Irgendwann kann er Blase und Darm nicht mehr kontrollieren (Inkontinenz), verlernt nacheinander Gehen, Sitzen, Lachen, am Ende kann er nicht einmal mehr den Kopf halten.
Häufig treten Krämpfe auf, seltener epileptische Anfälle und die Infektionsgefahr nimmt stark zu. Der Tod tritt oft durch hinzukommende Erkrankungen ein, am häufigsten auf Grund einer Lungenentzündung.
Eine genauere Einteilung des Krankheitsverlaufs in sieben Stadien (nach Dr. Barry Reisberg), kann dabei helfen, festzustellen wie weit fortgeschritten die Demenz ist, oder Folgeerkrankungen rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln.
Eine Früherkennung ist bereits bei der Diagnose der Alzheimer-Krankheit wichtig, damit der Erkrankte Vorsorge für die Zukunft treffen kann und auch damit sich Angehörige einstellen können.
In „Gedächtnissprechstunden“ von Krankenhäusern wird mit Hilfe des sogenannten „SIDAM Interviews“ zu Gedächtnis, motorischen und kognitiven Fähigkeiten geprüft, ob eine Demenz- also eine Störung geistig-seelische Leistungen in so hohem Maße, dass die Bewältigung des Alltags erschwert und soziale und berufliche Strukturen be- einträchtig werden- ,ein Delirium- d.h. eine Bewußtseinstrübung mit ähnlicher Sym- ptomatik, jedoch in der Regel reversibel- oder eine „normale Alterserscheinung“ vor- liegt. Es gibt auch einen kostenlos erhältlichen TFDD-Test, welcher jedoch eine Untersuchung von erfahrenen Ärzten und Psychologen nicht ersetzen kann. Bei einem Demenzfall ist die Ursache rauszufinden. Zwar ist Alzheimer mit 60-72% die häufigste, doch die wenigen behandelbaren Demenzformen (5%) gilt es früh zu erkennen und zu behandeln. Weitere psychiatrische Untersuchungen dienen zum Ausschluß depressionsbedingter Pseudodemenzen.
Bildgebende Verfahren und Laboruntersuchungen prüfen nach dem Vorliegen mögli- cher anderer Ursachen, wie Multi-Infarkt-Demenzen, B12- und Folsäuremangel, Medi- kamentenmißbrauch, Morbus Parkinson und insgesamt über 70 andere Krankheiten.
Dabei werden mit Hilfe der Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) Gehirnstrukturen deutlich gemacht, um feingewebliche Veränderungen zu erkennen, während eine Po- sitronen-Emissions-Tomographie (PET) Einblicke in die Gehirnaktivität erlaubt, die bei Alzheimerkranken in bestimmten Regionen verringert ist. Weiterhin umfaßt die Untersuchung EKG und EEG. Eine neuere, aber noch umstrittene Methode ist die Untersuchung der Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit (Liquor) auf den Eiweißstoff „ß- Amyloid“. Ein Bluttest kann auch hilfreich sein.
Am Ende der Untersuchungen steht ein Abschlußgespräch mit Betroffenen und einigen Angehörigen, um Persönlichkeitsveränderungen aufzudecken und um Defizite sowie erhaltene Kompetenzen zu erkennen.
Eine 100%ige Diagnose ist erst nach dem Tod und einer Untersuchung des Gehirns möglich, aber man kann die Krankheit mit 90%iger Genauigkeit angeben. Je früher sie erkannt wird, desto eher kann man ihren Verlauf verzögern.
2 Pathologische Veränderungen und mögliche Ursachen
Die eigentliche Ursache der Alzheimer-Krankheit ist nach wie vor unbekannt, allerdings gibt es gesicherte Befunde sowie einige Vermutungen. Sicher belegt ist bisher die gene- tische Veranlagung bei einer Untergruppe von erkrankten Personen. Demnach sind Mu- tationen auf den Chromosomen 1,14 und 21 für jeden zweiten Fall von familiär gehäuf- tem Alzheimer mitverantwortlich, insgesamt allerdings nur für 5% der Fälle. Diese feh- lerhaften Gene werden autosomal-dominant vererbt, denn das normale, auf dem Ge- schwisterchromosom liegende kann den Fehler offensichtlich nicht kompensieren. Menschen mit einem Morbus Down besitzen ein zusätzliches Chromosom 21 und ent- wickeln alle, erreichen sie das 40. Lebensjahr überhaupt, typische pathologische Verän- derungen der Alzheimer-Krankheit, die auch ähnlich im Gehirn verteilt sind. Auf dem Chromosom 21 liegt das Gen, welches das „ß-Amyloid-Vorläuferprotein“ („ßAPP“= „ßAmyloidPrecusorProtein) codiert. Dieses Protein ist 695-770 Aminosäuren
(As) lang und durchquert die Zellmembran vieler Zellen so, dass ein kurzes Stück ins Zellinnere ragt und ein längeres nach außen reicht. Aus diesem Protein wird nun dort, wo es die Membran durchquert, das „ß-Amyloidpeptid“ („ß-Amyloid“) rausgeschnitten, was auf zwei Weisen geschehen kann (Abb.2).Trennt zunächst die Alpha-Secretase das Protein, spaltet die Gamma-Secretase im nächsten Schritt das harmlose Peptidfragment „p3“ ab. Wird jedoch die Beta-Secretase als erstes aktiv, trennt es von ßAPP ein 99 As langes Spaltstück ab, wovon die Gamma-Secretase das Amyloid abschneidet. Besteht dieses Amyloid aus 40 As, so ist auch dieses harmlos. In weniger als 10% der Fälle ent- hält es allerdings zwei, höchstens drei As mehr, was auf die Nervenzellen in mehrerer Hinsicht toxisch wirkt. Es stört den Calcium-Haushalt der Zellen und schädigt die Mito- chondrien so, dass sie übermäßig Sauerstoffradikale ausbreiten, welche ihrerseits wich- tige Zellbestandteile, wie Proteine und die DNA, angreifen. Darüber hinaus setzen durch das Peptid geschädigte Zellen anscheinend Stoffe frei, die Mikroglialzellen, Teile des Gehirnimmunsystems, anziehen und eine Entzündungsreaktion auslösen. „Im Gen von ßAPP (sind) mehrere Mutationen (gefunden worden), auf Grund derer das Protein genau dort andere As trägt, wo die drei Secretasen das Molekül spalten“3, infol- gedessen sich eine übernormal häufige Produktion des Amyloid oder gerade des länge- ren Fragments erklären lassen könnte. Besonders verheerend sind die Folgen, wenn aus der normalen, löslichen Form des ß-Amyloids, das schraubenartig zu einer Alpha-Helix gewunden ist, die unlösliche wellblechartige ß-Faltblattstruktur entsteht. Diese können sich nämlich zu verhängnisvollen Fasern zusammenlagern und die sogenannten „seni- len“ oder auch „neuritischen Plaques“ bilden (Abb.4), typisches Merkmal der Alzhei- mer-Krankheit und wichtigster Gegenstand der aktuellen Forschung .Diese extrazellulä- ren Strukturen sind im Durchschnitt 5-200µm groß und „vorhandene Verklumpungen wachsen pro Sekunde um ein weiteres ß-Amyloid-Bruchstück“4. Ein „klassischer Pla- que“(Abb.2, Abb.5) zentriert in seinem Kern Amyloid, umgeben von einem dornen- kronartigen Ring aus absterbenden Zellbruchstücken, wie Axonen und Dendriten. Au- ßerdem sammeln sich dort auch Mikroglialzellen an, die womöglich versuchen die be- schädigten Neuronen, vielleicht sogar die Plaques selber, fortzuräumen. Die amyloiden Plaques treten schon ziemlich früh im Krankheitsverlauf auf, jedoch korreliert ihre Menge nicht mit dem Grad der Demenz. Trotzdem spricht ihr massives Vorkommen „im Hippocampus -einer Struktur für das Gedächtnis- und in der Großhirn- rinde (Kortex), der Hauptschaltstelle für Vernunft, Sprache, Lernen und andere wichtige Denkprozesse“5, für einen Zusammenhang mit den typischen Symptomen der Alzhei- mer-Krankheit.
Bei der Entstehung der Plaques können es auch die Secretasen sein, die fehlerhaft arbei- ten. Auf Chromosom 14 ist das Gen für Präsenilin 2 und auf Chromosom 1 das für Prä- senilin 2 lokalisiert worden. Diese Gene codieren Proteine mit der „Aufgabe [...]andere membrangebundene Proteine zu zerschneiden oder dabei zu helfen. Zu ihnen gehört das ßAPP.“6Noch ist allerdings unbekannt, ob die Präseniline selbst die Gamma-Secretase, die man bisher noch nicht isolieren konnte, sind oder ob sie ihr irgendwie helfen, indem sie „das Enzym aktivieren oder es mit ßAPP in Kontakt bringen.“7Fest steht: Mutatio- nen verursachen eine frühe und sehr aggressive Alzheimer-Form, da durch die Mutanten die Schnittrate durch die Gamma-Secretase anscheinend gesteigert wird.
Ein deutlich häufiger vorkommendes schadhaftes Gen befindet sich auf Chromosom 19 und scheint ein Risikofaktor für den sporadischen Alzheimertyp zu sein, denn 40-50% der Betroffenen weisen es auf, obwohl es in der sonstigen Bevölkerung eher selten vor- kommt (ca. 10%). Dieses Gen codiert das „Apolipoprotein E“ („ApoE“), das in drei Versionen vorkommt: g2, E3 und E4. ApoE4 stellt das Suszeptibilitätsgen (also den Risikofaktor) dar. Offenbar wird es von einem bestimmten, für solche Räumdienste zuständigen Molekül effektiver aus dem Zellzwischenraum in die Zelle abtransportiert als ß-Amyloid (Abb.2), so dass dieses sich draußen anlagert und Schaden anrichtet. Für diese These spricht, dass Betroffene mit ApoE4 mehr ß-Amyloid-Ablagerungen aufwei- sen als ohne. Außerdem steigt das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, bei Menschen, die sich fettreich ernähren um 23% ,sobald sie Träger dieses Merkmals sind. Der Zu- sammenhang mit dem Fettstoffwechsel liegt nahe, weil ApoE am Transport und der Verarbeitung von Cholesterin beteiligt ist.
Neben den Plaques stehen die „neurofibrillären Bündel“ (Abb.7) im Zentrum vieler Forschungen. Die intrazellulären Ablagerungen, auch „Tangles“ genannt, bestehen ü- berwiegend aus dem Protein „Tau“, welches sich normalerweise an Tubulin, den Grundbaustein der Mikrotubuli, Stützgerüst und Transportstraße einer Zelle, bindet (Abb.3). Tangles entstehen, wenn sich diese Tau-Proteinfasern paarweise umeinander winden („paarige helikale Filamente“) (Abb.8). Sie sind im Durchschnitt 10-20nm groß, zeigen sich im Krankheitsverlauf erst später und ihre Masse kolleriert mit dem Grad der Demenz, denn die zunehmende Masse der Tau-Bündel drückt die Mikrotubuli beiseite (Abb.3), so dass diese ihre Funktion nicht mehr ausüben können und die Neuronen ab- sterben.
Ein Grund dafür, dass sich die Fasern plötzlich verdrillen, statt sich ordnungsgemäß an Tubulin zu binden, könnte deren Überschuss sein. Ein verdächtiges Gen liegt auf Chromosom 17, das auch das „Tau“-Gen trägt. Es könnte die Ursache für die Überpro- duktion darstellen oder dafür verantwortlich sein, dass sich Tau nicht an Tubulin binden kann.
Möglich ist auch, dass „unter dem Einfluss des [...] ApoE4 abnormal viele Phosphat- gruppen an das Tau-Protein angelagert (werden) (Überphosphorylierung) und damit dessen Bindung an Tubulin gestört“8wird.„In Alzheimer-Gehirnen ist außerdem der Anteil an löslichem Pin 1 stark reduziert.“9Dieses Enzym, eine sogenannte Prolyl- Isomerase, kann die Funktion des überphosphorylierten Tau-Proteins wieder herstellen.
Im späteren Verlauf der Krankheit, wenn die Zellpopulation bereits um die Hälfte oder mehr geschrumpft ist, findet sich, besonders im Hippocampus, die „granulovakuoläre Degeneration (DVG)“. Sie besteht aus einer oder mehreren Vakuolen im Cytoplasma, häufig um den Zellkern herum, die ein dichtes körniges Material enthalten, welches unter dem Elektronenmikroskop von kristallener Struktur erscheint. Aufgrund der Va- kuolen schwillt das Cytoplasma an und die Zellen gehen zugrunde. Die GVD könnte eine Ursache für den Verlust des Langzeitgedächtnisses in späteren Stadien der Krank- heit sein.
Eine Veränderung in der Feinstruktur der Zellen sind die „Hirano-Körperchen“, die die Neuronen, sowie die Fortsätze durchdringen, dabei vermutlich Ribosomen einschließen können und diese funktionsuntüchtig werden, so dass keine Gedächtnisspuren mehr geformt werden können.
Das bereits erwähnte, verhängnisvolle Amyloid (ein kongophiles Material, weil es sich mit dem Farbstoff Kongo rot einfärbt) lagert sich auch übermäßig in den Blutgefäßchen des Gehirns ab (Angiophatie). Einigen „Vorstellungen zufolge zeigt die kongophile Angiophatie eine Störung des Immunsystems oder eine Schädigung der Blut-Hirn- Schranke an, die das Gehirn vor dem Eintritt fremder Substanzen schützt. Eine Schädigung dieser Barriere könnte die Angiopathie und somit auch die Häufigkeit von Infarkten und Hämorrhagien bei der Alzheimer-Krankheit erklären.“10
Alle erwähnten Veränderungen sind im Grunde altersabhängige Phänomene und finden sich auch bei der normalen Hirnalterung, allerdings in wesentlich geringerem Maße. Sie betreffen überwiegend Kortex, beeinträchtigen also sensorische Empfindungen und kognitive Fähigkeiten, und Teile des limbischen Systems, besonders den Hippocampus, denen die Gedächtnisfunktion zugeteilt wird.
Einher mit dem pathologischen Veränderungen geht auch ein Mangel an Neurotransmit- tern, besonders des Acethylcholins(ACh), sowie die für dessen Auf- und Abbau verant- wortlichen Enzyme Cholinacethyltransferase (CAT) und Acethylcholinesterase (AChE). Auch Serotonin, Noradrenalin, Somatostatin, Glutamat, Gamma-Amino-Buttersäure und Dopamin sind vermindert. Ihr Fehlen stört nicht nur die Kommunikation der ver- schiedenen Hirnareale sondern führt auch zum Absterben von Neuronen.
Neuere Hypothesen sind „advanced glyc(osyl)ation endproducts AGE)”, die bei der Glykolisierung von Proteinen entstehen und dazu beitragen sollen, dass die lösliche Form des ß-Amyloids in die unlösliche Form umgewandelt wird, und eine Mutation oder altersbedingt verminderte Aktivität des Gens für „Neprilysin“. Eine Mutation könnte das Alzheimer-Risiko erhöhen, da Neprilysin die Fähigkeit besitzt Amyloid zu zerstören.
Eher unwahrscheinlich ist die „Virus-Theorie“, der zufolge ein Virus mit einer Inkubationszeit von mehreren Jahrzehnten die Krankheit auslösen soll.
Unbestritten ist dagegen, dass auch äußere Faktoren eine Rolle spielen müssen. So steigern ungünstige Lebensbedingungen (wie Einsamkeit) und ungünstige Einflüsse (z.B. falsche Ernährung) gerade während der sensiblen Phase der Hirnreifung das Risiko. Auch ein niedriger Bildungsgrad ist Faktor, womöglich weil ein untrainiertes Gehirn weniger Reserven hat. Schädel-Hirn-Traumen erhöhen ebenfalls das Risiko, vielleicht zeigen sich die Symptome aber auch nur früher, da Hirnzellen absterben. In letzteren Fällen wären es dann im Grunde keine Ursachen.
Diskutiert wird auch über bestimmte Metalle in Trinkwasser und Nahrung, da sich in den Gehirnen von Betroffenen erhöhte Konzentrationen von Quecksilber, FCKW, Thallium, Cadium und besonders Aluminium findet.
3 Therapieansätze
Die Alzheimer-Krankheit ist weitgehend therapieresistent. Allerdings kann man den Krankheitsprozess verlangsamen. Es gibt nicht-medikamentöse Möglichkeiten wie „menschliche Zuwendung, angemessener Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, Akti- vierung und Beschäftigung, sowie demenzgerechte Gestaltung der Umwelt (Milieuthe- rapie).“11Sie stabilisieren die Lebensqualität der Betroffenen, so dass zusätzlichen Er- krankungen wie Depressionen vorgebeugt wird. Bei solchen Begleiterscheinungen wie Verhaltensstörungen, Unruhe, Depressionen und Halluzinationen kommen vorsichtig Psychopharmaka zum Einsatz.
Auch sind Medikamente im Umlauf, die den Mangel an Neurotransmittern wie ACh beheben sollen, so z.B. die AchE-Hemmer Tacrin oder Donepezil. Diese werden besonders im Frühstadium eingesetzt, wenn noch genügend ACh vorhanden ist. Auch ein Hemmstoff für Gamma-Secretase hat sich in Tierversuchen bereits bewährt und Verträglichkeitstests bei Menschen bestanden.
Teilweise verbessern Nootropika die Hirnleistung, sind jedoch umstritten.
Andere Forscher wollen vorhandenes Amyloid daran hindern Plaques zu bilden, indem sie es in seiner löslichen Form stabilisieren. Nikotin, sowie dessen Stoffwechselprodukt Cotinin scheint diese Fähigkeit zu haben. Studien ergeben, dass Raucher ein geringeres Alzheimer-Risiko haben. Allerdings sind die negativen Nebenwirkungen von Nikotin zu groß, als dass man es verschreiben könnte. Man hat nun Peptide entwickelt, die ß- Amyloid ähnlich genug sind, mit ihm eine Verbindung einzugehen, und gleichzeitig stabil genug, sich nicht zu Faltblättern zusammenzulegen. Sogar vorhandene Amyloid- fasern scheinen wieder aufgelöst zu werden. Allerdings sind auch bei Peptiden die Risi- ken groß (Allergien, Autoimmunreaktionen), außerdem müssten sie regelmäßig ge- spritzt werden, da bei einer oralen Einnahme die sofortige Trennung in As folgen wür- de.
Patienten, die wegen hoher Cholesterinwerte mit Blutfettsenkern ( Statine) behandelt werden, erkranken dreimal seltener an Alzheimer, so dass man spekuliert diese vorbeugend einzusetzen. In Tierversuchen mit Statin Simvastation konnte sogar ein Rückgang der Ablagerungen um 40-50% beobachtet werden.
Antioxidantien, Vitamin E und C, Flavonoide und Carotenoide sind Radikalfänger, haben einen schützenden Effekt und senken erwiesenermaßen das Erkrankungsrisiko. Studien über Entzündungshemmer wie Ibutropfen sind im Gang. Besondere Schlagzeilen hat ein Versuch mit Mäusen gemacht, die genetisch so verändert wurden, dass sie unnatürlicherweise Plaques bekamen, die ihre Lernfähigkeit beeinträchtigten. Innerhalb derer ersten Lebensjahre, als sich bei ihnen erfahrungsgemäß noch keine Ablagerungen befanden, spritzte man ihnen die synthetische Form des ß- Amyloids, das AN-1792. Die Mäuse entwickelten ß-Amyloid-Antikörper, so dass sich die Plaquebildung fast vollständig verhindern ließ (Abb.9). Bei älteren Mäusen konnten die bereits vorhandenen Plaques deutlich verringert werden (Abb.10) und „nach einiger Zeit (lernten sie) wieder so gut wie gesunde Artgenossen.“12
Auch Menschen vertragen die „Alzheimer-Impfung“. Während allerdings bei Mäusen dieses Protein ein unnatürlicher „Eindringling“ ist, ist es bei Menschen ein körpereigenes Molekül. Sollte das Immunsystem dennoch darauf reagieren, kann man nicht wissen, ob seine Ausschaltung nicht unerwünschte Nebenwirkungen hat, denn die Funktion dieses Stoffes ist noch unbekannt.
4 Bundesweiter Trend
Untersuchung an St. Augustiner Altenheimen
In Deutschland gibt es zur Zeit ca. 960 000 demente Menschen, von denen 60% unter Alzheimer leiden. Die Dunkelziffer wird jedoch auf 800 000 bis 1.2 Millionen Alzhei- merkranke geschätzt. In den USA leben 4 Millionen Betroffene. Und die Zahl der Pati- enten wächst stetig, da die Lebenserwartung steigt und mit dem Alter das Risiko einer Erkrankung wächst. Während es ab dem 65. Lebensjahr 5-8% beträgt, ist es zehn Jahre später auf 15-20% gestiegen. Nach dem 85. Lebensjahr ist jeder zweite bis dritte betrof- fen. Frauen häufiger als Männer.
Nach einer eigenen Untersuchung an den St. Augustiner Altenheimen St. Monika und St. Franziskanus leiden von 257 Heimbewohnern (51 Männer, 206 Frauen), 100 Patienten an Alzheimer, davon nur 15 Männer. Nach Angaben der Altenpfleger, schätzen sie die Alzheimererkrankten aber weit höher, denn noch ist nicht bei allen eine eindeutige Diagnose in den Krankenakten festgehalten.
Die meisten Bewohner sind zwischen 70 und 90 Jahren alt, ausgenommen einiger weniger darüber. Die Alzheimerpatienten sind im Durchschnitt 80 Jahre alt.
Schätzungen zufolge werden in 25 Jahren weltweit 22 Millionen Menschen betroffen sein. In 30 Jahren werden in Deutschland 1,5 Millionen der 2,5 Millionen Dementen an Alzheimer leiden. In 50 Jahren wird sich die Patientenzahl verdreifachen und Krebs als zweithäufigste Todesursache überrundet werden Andererseits ist man optimistisch, Ansatzpunkte für Therapien gibt es zahlreich und man hofft in 20 Jahren eine deutliche Linderung der Leiden, vielleicht sogar eine Heilung zu erreichen.
Schlußwort
„Alzheimer“ erschien mir ein interessantes Thema, nachdem ich einen Artikel darüber in der Zeitschrift „GEO“ gelesen habe. Außerdem arbeitet meine Mutter in S. Monika und erzählt immer wieder von Bewohnern und deren merkwürdigem Verhalten. Anfangs war die Bearbeitung des Themas jedoch etwas frustrierend, da die meiste Lite- ratur sich nur mit Symptomen und richtiger Pflege der Betroffenen beschäftigt, drei von vier Büchern die ich in der Unibibliothek ergattern konnte nur mit Diagnose. Interessant wurde es allerdings, als ich die Veränderungen im Gehirn, deren mögliche Ursachen sowie bereits bekannte Zusammenhänge begriff und die Krankheit allmählich verstand. Deshalb habe ich hier meinen Schwerpunkt gesetzt. Inzwischen könnte ich mir sogar vorstellen, später auch mal in Forschungsbereichen wie diesen zu arbeiten. Leider ist das einzige Buch über die Aspekte der Ursachen bereits zehn Jahre alt, so dass meine Hauptquellen wissenschaftliche Zeitschriften und das Internet darstellen. Ich hoffe diese waren seriös.
Die Untersuchung an den Altenheimen war teilweise problematisch. Zwar konnte mich meine Mutter mit der Leiterin von St. Monika vermitteln, diese hatte aber keine Zeit oder Lust genaue Angaben zu machen und gab nur ungefähre Auskünfte. Die Leiterin von St. Franziskanus nannte mir nur angebliche Ansprechpartner. Diese haben sich selbst aber gar nicht so gesehen, so dass ich hin und her geschickt wurde. Eine von acht Wohngruppen war gar nicht zu einer Auskunft bereit, die meisten der anderen sieben schätze ich auch als nur geschätzt ein, da nur zwei sich die Mühe gemacht haben die Krankenakten durchzusehen.
Literaturverzeichnis
BÜCHER:
Gruetzner, Howard:Alzheimersche Krankheit,
Ein Ratgeber für Angehörige und Helfer
Deutsche Bearbeitung: Ralf Ihl und Lutz Frölich Psychologie Verlags Union, Weinheim, 1992
Hahn, Peter:Neurologie und Psychiatrie für Altenpflegepersonal
4., überarbeitete Auflage
Spitta Verlag GmbH, Balingen, Deggendorf, im Winter 1990/91
Schäffler, Arne; Menche, Nicole (Hrsg.): Pflege Konkret Innere Medizin
Lehrbuch und Atlas für die Pflegeberufe
2., korrigierte Auflage, Gustav Fischer, Stuttgart Jena Lübeck Ulm 1998
Trebert Martin:Psychiatrische Altenpflege,Ein praktisches Lehrbuch
3., überarbeitete Auflage, BELTZ Psychologie Verlags Union, Weinheim, 1995
ZEITSCHRIFTEN
Brettin, Michael:Alzheimer( S.72- S.94) Geo (3/2001)
H. St George-Hyslop, Peter:Hilfe bei Alzheimer?Spektrum der Wissenschaft (3/2001)
Dr. Groß, Michael:Eine Impfung gegen die Alzheimer-Krankheit?Spektrum der Wissenschaft (11/1999)
INTERNETSEITEN
http://www.alzheimer-berlin.de/krankheit.html
http://www.Alzheimerforum.de/2/2/gzadi5mssadl.html http://www.alzheimerforum.de/4/5/pin1.html
http://www.alzheimer-online.de./arztsite/1ma/11kra/11-03.htm
http://www.alzheimer-online.de./arztsite/1ma/11kra/11-05.htm
http://www.BerlinOnline.de/wissen/wissenschaftsarchiv/20010606/html/med045066. html
http://www.deutsche-alzheimer.de/Right_ALZ.htm
http://www.medizinfo.de/kopfundseele/alzheimer/kongress/k1.1.htm http://www.medizinfo.de/kopfundseele/alzheimer/kongress/k1.2.htm http://www.medizinfo.de/kopfundseele/alzheimer/kongress/k1.5.htm
http://www.medizinfo.de/kopfundseele/alzheimer/kongress/k1.6.htm http://www.referate.de (Referate Archiv, Alzheimer) http://www.reich-neurologie.de/alzheimer.htm
[...]
1GEO(12/2001),S.85
2Trebert, „Psychiatrische Altenpflege“, S.27
3Spektrum der Wissenschaft (3/2001), Peter H. St G.-H., „Hilfe bei Alzheimer?“, S.49
4http://www.alzheimerforum.de/2/2/gzadi5mssadl.html, Dr. Dr. H. Mück, S.2 von 3
5Spektrum der Wissenschaft (3/2001), Peter H. St G.-H., „Hilfe bei Alzheimer?“, S.46
6Spektrum der Wissenschaft (3/2001), Peter H. St G.-H., „Hilfe bei Alzheimer?“, S.50
7Spektrum der Wissenschaft (3/2001), Peter H. St G.-H., „Hilfe bei Alzheimer?“, S.50
8http://www.referate.de/.../load.php?uin... ,S.2 von 3
9http://alzheimerforum.de/4/5/pin1.html ,Dr. rer. nat. B. Urmoneit, S.2 von 2
10H. Gruetzner, „Alzheimersche Krankheit“, S.230
11http://www.deutsche-alzheimer.de/Right_ALZ.htm , „10 Antworten“, S.1f von 4
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Alzheimer-Krankheit (Morbus Alzheimer) laut diesem Text?
Die Alzheimer-Krankheit, auch Morbus Alzheimer genannt, ist eine primär degenerative Erkrankung des Gehirns, die schleichend beginnt, zu einer ausgeprägten Demenz fortschreitet und mit dem Tod des Betroffenen endet. Sie ist durch Atrophie und große, liquorgefüllte Hohlräume im Gehirn gekennzeichnet.
Welche Symptome treten bei Alzheimer auf?
Zu den Symptomen gehören anfängliche vage Störungen wie Leistungsschwäche, Niedergeschlagenheit und Kopfschmerzen. Im weiteren Verlauf treten Kurzzeitgedächtnisverlust, räumliche Orientierungslosigkeit, Wortfindungsstörungen, Aphasie, Apraxie, Persönlichkeitsveränderungen, Verwirrtheit, Agnosie und schließlich Inkontinenz auf. Im Endstadium verstummt der Betroffene oft und ist völlig auf Hilfe angewiesen.
Wie wird Alzheimer diagnostiziert?
Die Diagnose erfolgt durch Gedächtnissprechstunden, SIDAM-Interviews, TFDD-Tests, psychiatrische Untersuchungen zum Ausschluss von Pseudodemenzen, bildgebende Verfahren (MRT, PET), Laboruntersuchungen zum Ausschluss anderer Ursachen und Liquoruntersuchungen. Eine 100%ige Diagnose ist erst nach dem Tod durch eine Untersuchung des Gehirns möglich.
Was sind die pathologischen Veränderungen im Gehirn bei Alzheimer?
Zu den pathologischen Veränderungen gehören senile Plaques (Ablagerungen von ß-Amyloid), neurofibrilläre Bündel (Tangles) aus Tau-Protein, granulovakuoläre Degeneration (GVD), Hirano-Körperchen, Amyloid-Ablagerungen in Blutgefäßen (Angiopathie) und ein Mangel an Neurotransmittern wie Acetylcholin.
Welche möglichen Ursachen oder Risikofaktoren werden im Text genannt?
Genetische Veranlagung (Mutationen auf den Chromosomen 1, 14 und 21), ß-Amyloid-Produktion und -Ablagerung, fehlerhafte Secretasen, ApoE4-Gen, Überphosphorylierung von Tau-Protein, ungünstige Lebensbedingungen, niedriger Bildungsgrad, Schädel-Hirn-Traumen und möglicherweise bestimmte Metalle im Trinkwasser.
Welche Therapieansätze gibt es?
Die Therapie ist weitgehend resistent, kann aber den Krankheitsprozess verlangsamen. Es gibt nicht-medikamentöse Möglichkeiten wie menschliche Zuwendung, Aktivierung und Beschäftigung und eine demenzgerechte Gestaltung der Umwelt (Milieutherapie). Medikamentös werden AChE-Hemmer, Psychopharmaka (bei Begleiterscheinungen) und potenziell Nootropika eingesetzt. Antioxidantien und Entzündungshemmer werden erforscht, ebenso wie Impfungen gegen ß-Amyloid.
Wie ist der bundesweite Trend bezüglich Alzheimer?
Es gibt eine steigende Zahl von Alzheimer-Patienten aufgrund der steigenden Lebenserwartung. Die Untersuchung in St. Augustiner Altenheimen zeigt, dass ein erheblicher Teil der Heimbewohner an Alzheimer leidet, wobei die Dunkelziffer vermutlich höher ist.
Welche Rolle spielt das ß-Amyloid-Vorläuferprotein (ßAPP)?
ßAPP ist ein Protein, aus dem das ß-Amyloidpeptid herausgeschnitten wird. Je nach Art der Spaltung können harmlose oder toxische Formen des ß-Amyloids entstehen. Mutationen im Gen von ßAPP können zu einer übernormal häufigen Produktion des Amyloids führen.
Was sind Neurofibrilläre Bündel (Tangles)?
Neurofibrilläre Bündel, auch Tangles genannt, sind intrazelluläre Ablagerungen, die überwiegend aus dem Protein „Tau“ bestehen. Diese Fasern verdrillen sich und beeinträchtigen die Funktion der Mikrotubuli, was zum Absterben der Neuronen führt.
Was ist die Rolle von Apolipoprotein E (ApoE)?
ApoE kommt in drei Versionen vor: g2, E3 und E4. ApoE4 stellt ein Risikofaktor für den sporadischen Alzheimertyp dar. Es wird angenommen, dass ApoE4 ß-Amyloid weniger effektiv aus dem Zellzwischenraum abtransportiert, was zu Ablagerungen und Schäden führt.
- Quote paper
- Ella Wotzke (Author), 2002, Alzheimer. Symptome, Ursachen und Therapieansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106783