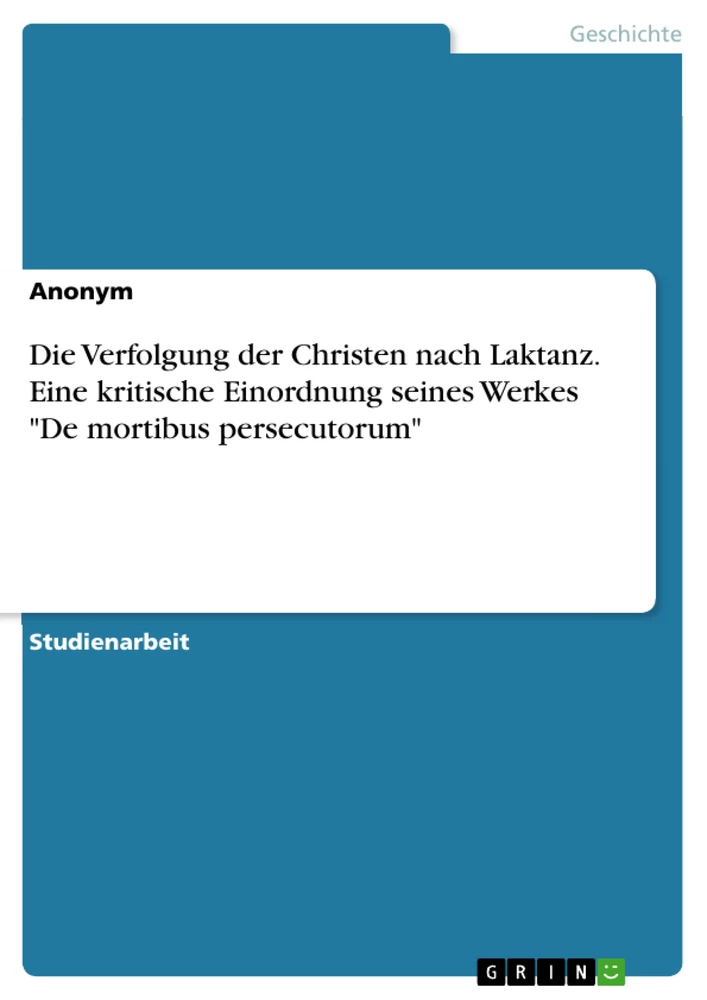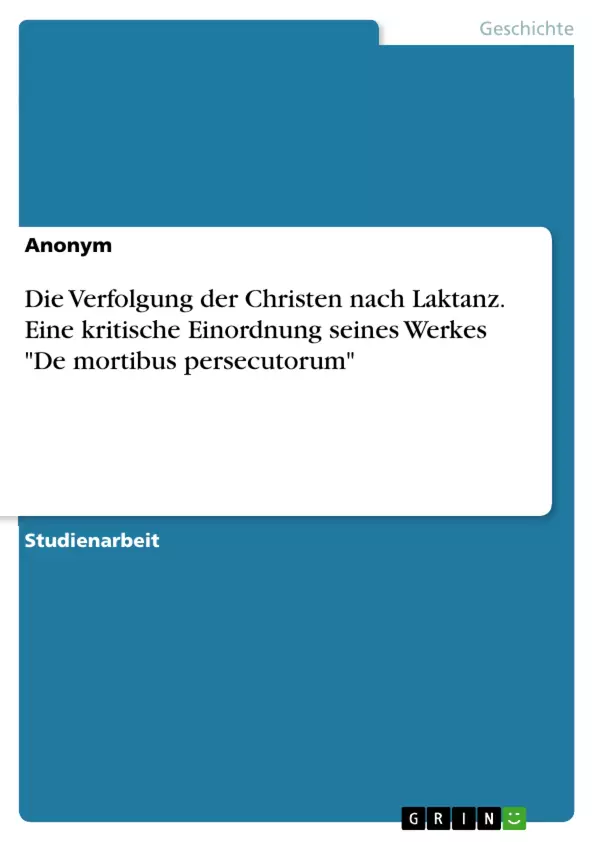Der Anbruch der Spätantike wurde von verschiedenen politischen und kulturellen Veränderungen begleitet, ein wesentlicher Faktor war jedoch unbestreitbar das Überschwappen des frühen Christentums aus dem römisch beherrschten Palästina nach Europa. Diese neue, monotheistische Religion fand schnell Anhänger, aber auch Gegner. Entgegen der landläufigen Meinung handelte es sich bei ‚der Christenverfolgung‘ der römischen Antike nicht um eine kontinuierliche und strukturierte Bewegung gegen Christen. Vielmehr handelte es sich bei den Christenverfolgungen im Römischen Reich um eine Reihe von, anfänglich nicht kaiserlich angeordneten und sich örtlich manifestierenden, Repressalien gegen den Einfluss des Christentums.
Mit dem Erstarken der neuen Religion im Kerngebiet des Reiches sowie der beginnenden Reichskrise des dritten Jahrhunderts änderte sich dieser Zustand jedoch. Die äußere, durch Sassaniden und germanische Verbände, und innere, durch wirtschaftliche Not, Unruhen und Usurpationen hervorgerufene Bedrohungslagen veranlassten Kaiser Decius 249 bis 251 dazu, von der Bevölkerung Loyalität einzufordern. Wu
Dieser Wendepunkt ist als Ausgangspunkt für die kaiserlich initiierten und systematisch ausgeführten Verfolgungen der Christen anzusehen, welche mit dem Toleranzedikt des Galerius 311 sowie durch die Mailänder Vereinbarungen 313 politisch beendet wurden.
Eines dieser Ereignisse war wohl Anlass für den christlichen Apologeten Laktanz "De mortibus persecutorum" zu verfassen, eine der wenigen und deshalb um so wertvolleren literarischen Quellen für diese Epoche.
Laktanz erlebte die Verfolgung sowie den Siegeszug seiner Religion im Römischen Reich als Zeitzeuge und teilweise gar als Augenzeuge mit und verhandelt in seinem Werk die Gründe für und Auswirkungen der kaiserlichen Maßnahmen – jedoch indem er die Lebens- und Todesumstände römischer Kaiser, die sich aus seiner Sicht in besonderem Maß schuldig gemacht hatten, in seinen Fokus stellt. Hierbei ist besonders interessant, wie sich Laktanz dem Kampf um die Deutung seiner Zeit verpflichtet, indem er in seinem Text in äußerst polemischer Art und Weise Position bezieht.
Näher betrachtet werden soll in dieser Arbeit, welche Kaiser Laktanz als Verfolger darstellt und wie diese charakterisiert werden, um nachzuverfolgen, wie der Verfasser den jeweiligen Tod als Bestrafung markiert
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kritische Einordnung des Werks
- Aktuelle Forschungslage
- Quellenkritik
- Äußere Kritik
- Innere Kritik
- Verfolgung der Christen nach Laktanz
- Ursachen und Ausbruch der Verfolgungen
- Der Verlauf der großen Verfolgung
- Das Ende der Verfolgungen – Das Ende der Verfolger
- Exkurs: Tod als Gottesurteil in der Antike
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Laktanz' "De mortibus persecutorum" und analysiert dessen Darstellung der Christenverfolgungen im römischen Reich. Die Zielsetzung besteht darin, Laktanz' Perspektive auf die Verfolgungen und seine Charakterisierung der beteiligten Kaiser zu beleuchten, insbesondere wie er deren Tod als göttliche Bestrafung darstellt. Die Arbeit berücksichtigt die aktuelle Forschungslage und wendet eine kritische Quellenanalyse an.
- Laktanz' Darstellung der Christenverfolgungen
- Charakterisierung der römischen Kaiser bei Laktanz
- Die Interpretation des Todes der Kaiser als göttliche Strafe
- Kritische Auseinandersetzung mit der Quellenlage
- Einordnung von Laktanz' Werk in den Kontext der historischen Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert den historischen Kontext des frühen Christentums im römischen Reich und die nicht-kontinuierliche Natur der Christenverfolgungen. Sie führt Laktanz' "De mortibus persecutorum" als wichtige Quelle ein und hebt dessen polemischen Charakter und Fokus auf das Schicksal römischer Kaiser hervor. Die Einleitung betont die Bedeutung des Werks für das Verständnis der damaligen Zeit und den Kampf um dessen Deutung.
2. Kritische Einordnung des Werks: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die aktuelle Forschung zu Laktanz und seinem Werk. Es differenziert verschiedene Forschungsansätze, die sich mit Laktanz' Positionen zu philosophischen und machtpolitischen Aspekten, seiner Darstellung von Diokletian und Konstantin, sowie dem Vergleich seiner Schriften mit denen von Eusebius von Caesarea befassen. Die Kapitel befasst sich auch mit der Frage nach der Zuverlässigkeit von Laktanz' Bericht und seiner Methode.
3. Verfolgung der Christen nach Laktanz: Dieses Kapitel untersucht Laktanz' Darstellung der Christenverfolgungen. Es analysiert die von Laktanz angegebenen Ursachen und den Ausbruch der Verfolgungen, den Verlauf der großen Verfolgung unter Diokletian, und schließlich deren Ende mit dem Toleranzedikt des Galerius und den Mailänder Vereinbarungen. Die Kapitel analysiert, wie Laktanz die Ereignisse darstellt und interpretiert.
Schlüsselwörter
Laktanz, De mortibus persecutorum, Christenverfolgungen, Römisches Reich, Diokletian, Konstantin, Quellenkritik, Geschichtswissenschaft, göttliche Strafe, Polemik, frühes Christentum, Spätantike.
Häufig gestellte Fragen zu Laktanz' "De mortibus persecutorum"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Laktanz' "De mortibus persecutorum" und dessen Darstellung der Christenverfolgungen im römischen Reich. Sie beleuchtet Laktanz' Perspektive auf die Verfolgungen, seine Charakterisierung der beteiligten Kaiser und seine Interpretation ihres Todes als göttliche Strafe. Die Arbeit beinhaltet eine kritische Quellenanalyse und bezieht die aktuelle Forschungslage mit ein.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Laktanz' Darstellung der Christenverfolgungen; Charakterisierung der römischen Kaiser bei Laktanz; Interpretation des Todes der Kaiser als göttliche Strafe; kritische Auseinandersetzung mit der Quellenlage; Einordnung von Laktanz' Werk in den Kontext der historischen Forschung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung; Kritische Einordnung des Werks (inkl. aktueller Forschungslage und Quellenkritik); Verfolgung der Christen nach Laktanz (inkl. Ursachen, Verlauf und Ende der Verfolgungen); Exkurs: Tod als Gottesurteil in der Antike; Fazit.
Wie wird die Quellenlage behandelt?
Die Arbeit beinhaltet eine ausführliche Quellenkritik, die sowohl die äußere als auch die innere Kritik an Laktanz' Werk umfasst. Sie berücksichtigt die aktuelle Forschungslage und differenziert verschiedene Forschungsansätze zur Beurteilung der Zuverlässigkeit von Laktanz' Bericht und seiner Methode.
Welche Rolle spielt die Interpretation des Todes der Kaiser?
Ein zentraler Aspekt der Arbeit ist die Analyse, wie Laktanz den Tod der römischen Kaiser als göttliche Strafe darstellt. Dies wird im Kontext der damaligen Zeit und im Vergleich zu anderen Quellen untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Laktanz, De mortibus persecutorum, Christenverfolgungen, Römisches Reich, Diokletian, Konstantin, Quellenkritik, Geschichtswissenschaft, göttliche Strafe, Polemik, frühes Christentum, Spätantike.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler und Studierende, die sich mit dem frühen Christentum, der Spätantike und der römischen Geschichte befassen. Sie eignet sich insbesondere für diejenigen, die sich mit Laktanz' Werk und dessen Interpretation auseinandersetzen möchten.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen können in der vollständigen Arbeit gefunden werden (Hinweis: Die HTML-Version enthält nur eine Zusammenfassung).
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Die Verfolgung der Christen nach Laktanz. Eine kritische Einordnung seines Werkes "De mortibus persecutorum", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1066474