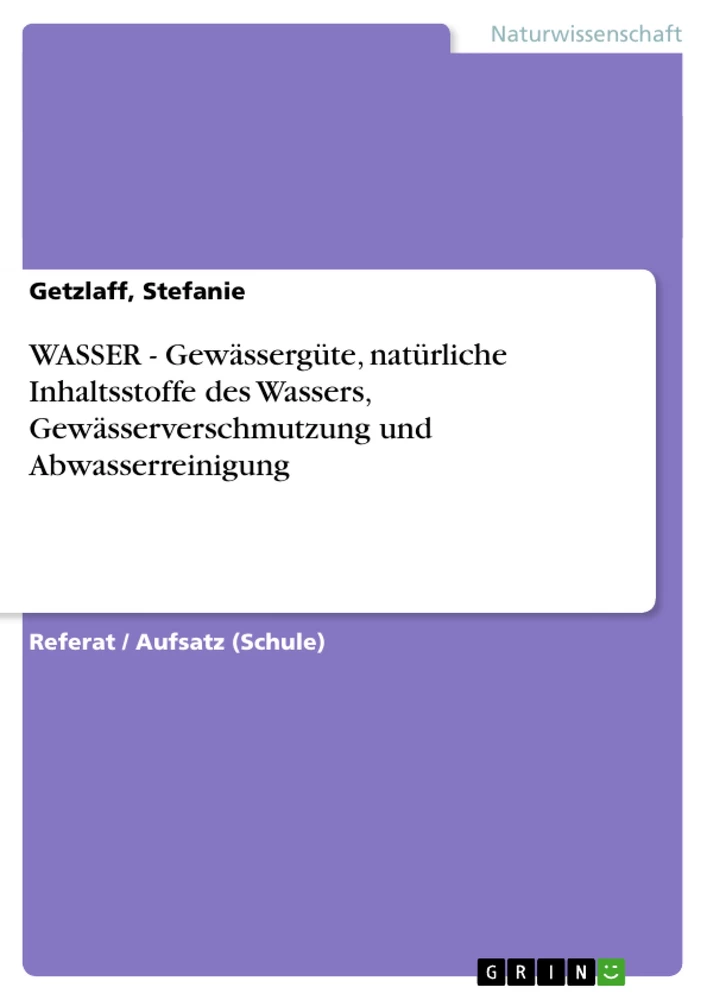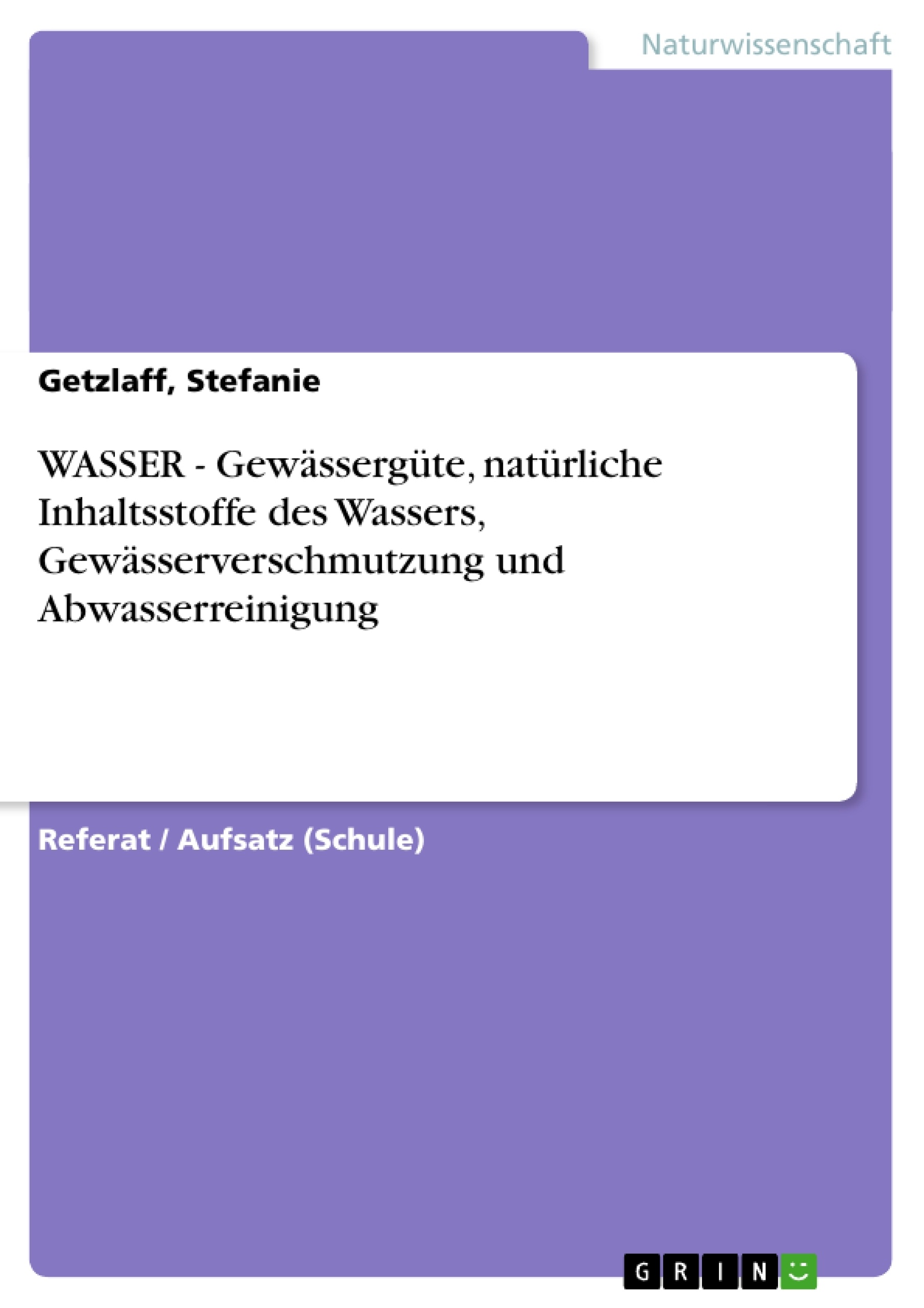Stellen Sie sich vor, Sie könnten das unsichtbare Leben eines einzigen Wassertropfens verfolgen, von seiner reinen Geburt als Niederschlag bis zu seiner Verwandlung durch menschliche Einflüsse. Dieses Buch ist Ihre Lupe für die verborgene Welt des Wassers, ein unverzichtbarer Ratgeber, der die komplexen Zusammenhänge zwischen Gewässergüte, Wasserverschmutzung und den lebensnotwendigen Prozessen der Abwasserreinigung aufdeckt. Tauchen Sie ein in die faszinierende Charakterisierung verschiedener Wasserarten – von kristallklarem Quellwasser bis hin zu den komplexen Gemischen in Flüssen und Seen. Entdecken Sie, wie menschliche Aktivitäten die chemische Zusammensetzung unserer Gewässer verändern und welche verheerenden Folgen dies für die Umwelt haben kann. Lernen Sie die Geheimnisse der Gewässergütebestimmung kennen, vom Saprobiensystem für Fließgewässer bis hin zum Trophiesystem für Stillgewässer, und verstehen Sie, wie ökologische und chemische Untersuchungen uns helfen, den Zustand unserer aquatischen Ökosysteme zu beurteilen. Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in die kritischen Inhaltsstoffe des Wassers, von lebenswichtigen Mineralien wie Calcium und Magnesium bis hin zu gefährlichen Schadstoffen wie Nitraten und Schwermetallen, und erklärt ihre Auswirkungen auf unsere Gesundheit und die Umwelt. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die hochmodernen Kläranlagen, die unsere Abwässer reinigen, und erfahren Sie, wie diese komplexen Systeme die natürlichen Selbstreinigungskräfte der Gewässer nachahmen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Reinigungsstufen, von der mechanischen Filterung bis zur biologischen Zersetzung und chemischen Behandlung, und entdecken Sie die innovativen Methoden zur Entsorgung und Weiterverwendung von Klärschlamm. Ob Sie ein Student der Chemie, ein Umweltaktivist oder einfach nur ein besorgter Bürger sind, dieses Buch wird Ihr Verständnis für die Bedeutung sauberen Wassers schärfen und Ihnen das Wissen vermitteln, um zum Schutz unserer wertvollsten Ressource beizutragen. Dieses Buch ist ein detaillierter Einblick in die Welt der Wasserchemie und Gewässergüte, beleuchtet die komplexen Prozesse der Wasserverschmutzung und Abwasserreinigung und bietet einen fundierten Überblick über die verschiedenen Wasserarten, ihre Inhaltsstoffe und die Methoden zur Beurteilung ihrer Qualität. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den verschiedenen Güteklassen von Fließgewässern, von unbelasteten Reinwasserzonen bis hin zu stark verschmutzten Abwasserzonen, sowie auf den chemischen und physikalischen Faktoren, die die Wasserqualität beeinflussen. Das Buch untersucht auch die Kriterien für die Beurteilung der Wasserqualität, wie Sauerstoffgehalt, pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit, und gibt Einblicke in die Bedeutung verschiedener Inhaltsstoffe wie Stickstoff und Phosphat. Darüber hinaus wird die Funktionsweise von Kläranlagen detailliert beschrieben, von der Sammlung und Ableitung der Abwässer bis zur mechanischen, biologischen und chemischen Reinigung, sowie die Entsorgung und Weiterverwendung der herausgefilterten Stoffe. Ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die sich für den Schutz unserer Wasserressourcen interessieren. Entdecken Sie die unsichtbaren Gefahren, die in unseren Flüssen und Seen lauern, und erfahren Sie, wie wir unsere wertvollsten Ressourcen schützen können.
SPEZIALGEBIET AUS CHEMIE:
Gewässergüte, natürliche Inhaltsstoffe - Gewässerverschmutzung und Abwasserreinigung (Kläranlagen)
Wasser gibt es in ungeheurer Menge, denn rund 71% der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Jedoch muss man zwischen verschiedenen Wasserarten unterscheiden.
I. Charakterisierung verschiedener Wasserarten:
In diesem ersten Kapitel sollen die verschiedenen Wasserarten kurz erklärt werden. Ausführliche Erörterungen folgen in den weiteren Kapiteln.
1. Niederschlagswasser:
Wasser, das als Regen, Schnee, Tau, Rauhreif und Hagel wieder auf die Erdoberfläche gelangt, ist an und für sich der reinste Wassertyp der Natur. Das liegt daran, dass es einem natürlichen Destillationsprozess entstammt.
Das Problem jedoch ist, dass diese Art von Wasser einen intensiven Kontakt zur Luft hat. So wird das Niederschlagswasser durch Industrie- und Fahrzeugabgase, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Ruß und auch durch Radioaktivität verunreinigt.
2. Grundwasser
Als echtes oder natürliches Grundwasser bezeichnet man alles unter der Erdoberfläche befindliches Wasser. Grundwasser ist letzten Endes ebenfalls irgendwann einmal gefallenes Niederschlagswasser, das durch die verschiedenen Schichten des Bodens und des tieferen Untergrundes gesickert ist. Wasser sickert so lange durch verschiedene Schichten, bis es letztendlich auf wasserundurchlässige Schichten zu stehen kommt. Die Qualität des Grundwassers ist von den chemischen, biologischen und mechanischen Eigenschaften der verschiedenen durchströmten Schichten abhängig. So kann das Wasser verschiedene Temperaturen, Gerüche und Geschmäcker aufweisen. Auch die Zahl der Mikroorganismen in der Erde ist verantwortlich für verschiedene Wasserarten.
Da es viele verschiedene Bodenformationen gibt, gibt es auch viele verschiedene Grundwässer. Das Grundwasser im Bereich der Kalkalpen ist weich, die Grundwässer in magmatischen und metamorphen Gesteinen wie z.B.: Granit sind ebenfalls weich und auch elektrolytarm.
Man kann aber sagen, dass die chemische Zusammensetzung aller Grundwässer sehr ähnlich ist.
Die Hauptbestandteile sind: Na+ (Natrium), Mg2+ (Magnesium), Ca2+ (Calcium), Cl(Chlorid), HCO3- (Hydrogencarbonat), CO32- (Carbonat), SO42- (Sulfat);
Später möchte ich noch genauer auf die Inhaltsstoffe des Wassers eingehen.
3. Quell- und Brunnwasser
Dieses Wasser entstammt einem natürlichen Grundwasseraustritt. Alle Quellen verdanken ihre Entstehung der Tatsache, dass in der Erdoberfläche wasserdurchlässige und wasserundurchlässige Schichten existieren, die sich im Laufe der Zeit gegeneinander verlagert und schräg gestellt wurden und zwar durch Faltung der Erdrinde.
4. Mineral- und Heilwasser
Diese Wässer sind natürliche Quellwässer, die beim Durchgang durch die Erdoberfläche mindestens 1000mg / kg an Salzen oder auch ca. 250 mg / kg an CO2 aufgenommen haben. Wegen des hohen Mineralstoffgehaltes und verschiedener Wirkstoffe wie Schwefel oder Iodid bringt das Wasser eine Heilwirkung mit sich.
5. Oberflächenwasser:
Als Oberflächenwasser wird das Wasser aus stehenden oder fließenden Gewässern bezeichnet. (Bach, Fluss, Teich, See...)
Oberflächenwässer sind ein Gemisch aus Grund- , Quell- , Regen- und Abwasser. Daher schwanken die chemischen Zusammensetzungen ständig.
(a) Fließgewässer:
Unberührte Bäche und kleine Flüsse sind meist sauerstoffreich und frei von Eisen und Mangan. Die Zusammensetzung und die Temperatur können stark schwanken. Neben Calcium und Hydrogencarbonat findet man auch: Chlorid, Sulfat, Phosphat, Nitrat und Ammonium.
(b) Seen und Stauseen:
Natürliche oder künstliche stehende Gewässer sind meist elektrolytarm und weich. Nach einer einfachen Aufbereitung eignet es sich gut als Trinkwasser. Phosphat und Nitrat sind für stehende Gewässer von großer Bedeutung. Sie können das biologische Gleichgewicht eines Sees so stören, dass Eutrophierung eintritt.
6. Meerwasser:
97,4% der Gesamt - Wassermenge der Erde sind Meerwasser. Der Salzgehalt ist mit rund 35g / kg sehr hoch. Humusartige Stoffe verleihen dem Meerwasser seine charakteristische Eigenfarbe. Chemische Zusammensetzung des Meerwassers: Kationen, Anionen, Spurenstoffe und gelöste Gase.
7. Abwasser:
Jedes nach häuslichen oder gewerblichen Gebrauch veränderte, insbesonders verunreinigte, abfließende, auch von Niederschlägen stammende und in die Kanalisation gelangende Wasser ist Abwasser.
Häusliche Abwässer enthalten im wesentlichen organische Stoffe, die beim Einleiten in „gesundes“ Gewässer nach einer gewissen Fließstrecke abgebaut werden können. Abwässer aus Gewerbe und Industrie sind dagegen kaum abbaubar. Zudem enthalten die oft völlig artfremde Stoffe, auch Giftstoffe, die das biologische Milieu schwer schädigen können.
Grundsätzlich darf heute kein Abwasser ungeklärt in einen Vorfluter eingeleitet werden.
II. Gewässergütebestimmung:
1. Saprobiensystem:
Das Saprobiensystem ist eine Einteilung der Wasserqualität bei Fließgewässern.
In der Hauptsache hängt die Wasserwualität eines Gewässers, die Gewässergüte, von seinem Gehalt an abbaubaren organischen Substanzen und anorganischen Substanzen (Nährstoffen) ab.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fanden Kolkwitz und Marsson heraus, dass sich in belasteten Fließgewässern andere Tierarten aufhalten, als in unbelasteten bzw. sauberen Gewässern. Grundlage dieser Erkenntnis war, dass die Konzentration biologisch abbaubarer Substanzen, also faulnisfähige Substanzen, und der Sauerstoffgehalt des Wassers variieren. Das daraus entwickelte Saprobiensystem (sapros, griechisch: faul) mit vier Güteklassen sowie drei Zwischenstufen, wird heute als biologische Methode zur Gewässergütebestimmung von Fließgewässern verwendet.
Die vier Güteklassen sind :
- Oligosarob
- Beta - mesaprob
- Alpha - mesaprob
- Polysabrob
Die Einteilung in die verschiedenen Saprobienklassen erfolgt mittels Identifizierung der vorkommenden Wasserorganismen (Bioindikatoren), die entsprechend ihrer Bedürfnisse den verschiedene Saprobienstufen zugeteilt wurden.
Später werde ich die vier Güteklassen näher charakterisieren aber vorerst möchte ich die Gewässergütebestimmung bei Stillgewässern behandeln. Es handelt sich hierbei um das
2. Trophiesystem:
In Standgewässern kommt es meist zu unterschiedlichen Wasserschichten. Die einzelnen Schichten unterscheiden sich hinsichtlich chemischer (z.B.: Sauerstoffgehalt) und physikalischer (z.B.: Temperatur) Faktoren. Daher kann die Gewässergüte nicht mit den Bioindikatoren wie im Fließgewässer bestimmt werden. Je nach Probenahmestelle und daher je nach Gewässerschicht hätte man im selben Gewässer unterschiedliche Ergebnisse.
Zur Feststellung des Trophiegrades werden das Ausmaß der Produktion (z.B.: Planktonentwicklung), die Sauerstoffverteilung, die Sichttiefe und der Gewässergrund untersucht.
Dies gibt eine Einteilung in die 4 Trophiestufen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Ökomorphologische Untersuchungen:
Nicht nur das Gewässer wird untersucht sondern auch das Gewässerumfeld muss berücksichtigt werden. Dabei kann man Aussagen über den Ausbauzustand und die Naturnähe des Gewässers machen. Die Naturnähe wird im Rahmen einer Begehung oder auch Befahrung beurteilt. Dabei werden unter anderem die Breitenvariabilität und die Uferbeschaffenheit protokolliert.
Schließlich wird das Gewässer ganz oder abschnittsweise in folgende Natürlichkeisklassen zugeordnet.:
1: natürlicher Zustand
1-2: naturnaher Zustand
2: Zustand wenig beeinträchtigt 2-3: Zustand deutlich beeinträchtigt 3: Zustand stark beeinträchtigt 3-4: naturferner Zustand 4: naturfremder Zustand
4. Chemische Gewässeruntersuchung:
Der Vorteil der chemischen Methode liegt darin, dass exakte Messwerte gefunden werden können. Andererseits gibt sie auch nur eine Momentaufnahme wieder und lässt also keine Schlüsse auf vergangene Ereignisse zu.
Der Sauerstoffgehalt gehört zu den bedeutendsten chemischen Faktoren, daher muss er bei jeder Gewässeruntersuchung bestimmt werden. Er sollte möglichst hoch sei, um den im Gewässer lebenden Organismen, insbesonders den Fischen, ein optimales Wachstum zu ermöglichen.
Beinahe genauso wichtig ist der pH - Wert des Gewässers. Er wirkt indirekt auf die Organismen, denn viele chemische Elemente im Gewässer verändern sich, wenn der pH - Wer sinkt oder steigt. So zum Beispiel Ammonium, das sich ab einen pH - Wert von 8 in Ammoniak umwandelt, welches für die Fische toxisch ist. Zu einer genauen Einschätzung der Gewässergüte werden noch zahlreiche andere chemische Parameter bestimmt, wie zum Beispiel der Kalk-, Nitrat- und Phosphatgehalt.
5. Physikalische Gewässeruntersuchung:
Ein wichtiger physikalischer Faktor ist die Temperatur, da viele Organismen in ihrer Lebensentwicklung davon abhängig sind.
Die Messung der Sichttiefe gibt einen Eindruck darüber, die stark die Trübung des Gewässers ist. Dazu wird eine weiße Scheibe solange in die Tiefe heruntergelassen, bis die Ränder verschwinden.
III. Die vier Güteklassen:
Nach dem Überblick über die verschiedenen Arten der Gewässeruntersuchung möchte ich nachträglich die 4 Güteklassen des Saprobiensystems im Angriff nehmen.
Fließende Gewässer werden in 4 Güteklassen eingeteilt und in farbigen Gewässergüteklassen dargestellt. Die Einteilung in die Güteklassen geschieht nach biologischen Merkmalen, daher nach den im Gewässer lebenden Pflanzen und Tieren, vor allem Kleinlebewesen. Jedes Lebewesen ist auf einen bestimmten Zustand seines Lebensraumes angewiesen.
Damit ein Gewässer seine Funktion als Teil unserer Umwelt erfüllen kann, darf es zumindest keine schlechtere Gewässergüte als Güteklasse 2 aufweisen.
a) GÜTEKLASSE 1
Oligasarobe Zone→dunkelblau dargestellt
- unbelastet bis gering belastet
- Sauerstoffgehalt: sehr hoch (nahe dem Sättigungswert)
- Organische Belastung: minimal, daher: Sichttiefe sehr hoch
- Gewässerboden: hell bis braun gefärbt in allen Schichten
- Bakterienzahl: sehr gering, <1000 Bakterien pro cm3
- Artenreich und individuenarm (viele Insektenarten)
Die oligasaprobe Zone wird auch als Reinwasserzone bezeichnet und kommt heute nur noch in Quellregionen und sehr gering belasteten Oberläufen vor.
WO: Oberlauf der Ybbs bis Lunz am See
Steyer
b) GÜTEKLASSE 2:
Beta - mesaprobe Zone→blaugrün dargestellt
Das Wasser ist nur mäßig verunreinigt, daher ist der Sauerstoffhaushalt nicht wesentlich belastet. Das Wasser ist reich an Nährstoffen. Daraus ergeben sich ein größerer Artenreichtum und dichtere Besiedlung mit Algen, höheren Wasserpflanzen und Tieren. Man findet neben Insektenlarven auch Kleinkrebse, Muscheln und Schnecken.
Also: - mäßig belastet
- Sauerstoffgehalt: hoch (schwankend)
- Organische Belastung: vorhanden, aber relativ niedrig daher: Sichttiefe leicht getrübt
- Gewässerboden: gelb / braun, in tieferen Schichten schwarz (Eisen - 2 - Sulfid)
- Bakterienzahl: gering: weit unter 100.000 Bakterien pro cm3
- Arten - und individuenreich
WO: Großteil der österreichischen Donau (einige Strecken ausgenommen)
c) GÜTEKLASSE 3:
Alpha - mesaprobe Zone→gelb dargestellt
Die zunehmende Belastung durch biologisch abbaubare organische Stoffe führt zu Störungen des Sauerstoffgehaltes. Der Artenreichtum am Lebewesen nimmt ab, dafür zeigen die widerstandsfähigen Lebewesen oft eine massenhafte Entwicklung. Die wenigen hier noch gedeihenden Fischarten sind durch den zeitweise auftretenden Sauerstoffmangel in ihrem Bestand gefährdet: Fischsterben können daher immer wieder auftreten. Im Feinsand und Schlamm am Grund des Gewässers, dem sogenannten Sediment, treten bereits Fäulnisvorgänge auf.
Also: - stark verschmutzt
- Sauerstoffgehalt: relativ hoch, jedoch stark schwankend
- Organische Belastung: mäßig hoch, Sichttiefe erkennbar getrübt
- Gewässerboden: Oberfläche gelb / braun, tiefere Schichten schwarz, zum Teil: Faulschlamm
- Bakterienzahl: hoch ca. 100.000 Bakterien pro cm3
- Rückgang der Artenvielfalt (es gibt vorrangig Mikroorganismen)
WO: weite Strecken der Mur
Zahlreiche Gewässer im Weinviertel Weite Strecken der Traun
d) GÜTEKLASSE 4: Polysaprobe Zone→rot
Durch außergewöhnlich starke Verunreinigung ist gelöster Sauerstoff nur mehr in geringer Menge zeitweise oder gar nicht mehr vorhanden. Nur mehr wenige Arten von Lebewesen können hier noch leben: man findet Bakterien und Pilze, die sogenannten „Abwasserpilze“ in Masse und das sowohl im Wasser als auch auf Steinen und Zweigen. Algen und tierische Lebewesen fehlen bereits fast vollständig, nur einige unempfindlichen Arten können unter diesen extremen Lebensbedingungen noch überleben.
Also: - „Abwasserzone“ - übermäßig verschmutzt
- Sauerstoffgehalt: gering: bisweilen gegen Null gehend
- Organische Belastung: hoch: daher Sichttiefe = stark getrübt
- Gewässerboden: nur oberste Schicht hell, ansonsten schwarz, Faulschlamm - Ablagerungen
- Bakterienzahl: sehr hoch: 1.000.000 pro cm3
- Artenarm und individuenreich
WO: Ybbs unterhalb der Zellstofffabrik in Kematen Salzach unterhalb der Zellstofffabrik in Hallein Mur unterhalb der Zellstofffabrik in Gratkorn
IV. Beurteilung der Wasserqualität
→ einige Inhaltsstoffe und deren Bedeutung:
1) Natürliches Wasser enthält eine Reihe von Salzen, die es aus dem Erdboden herauslöst. Weiters Gase, die sich aus der Luft im Wasser lösen und schließlich Schwebstoffe, die durch die Bewegung des Wassers aus dem Erdboden abgeschwemmt werden.
Häufige und wichtige, in natürlichem Wasser vorkommende An- und Kationen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wichtige in natürlichem Wasser gelöste Gase und ihre Herkunft :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kurze Beschreibung der oben angeführten Inhaltsstoffe:
a) KATIONEN:
Na+ : Von den Alkalimetall - Ionen ist das Natrium weitaus am häufigsten Natrium gelangt durch Salzlagerstätten oder durch häusliche Abwässer in das Wasser. Es hat in Grundwässern eine meist nur geringe Bedeutung und kommt in recht geringen Konzentrationen bis zu 50 mg/l vor. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen Na - Überangebot und Herzkranzgefäßerkrankungen als Folge einer Na - geschädigten Niere.
Ca2+: Calcium kommt in der Natur sehr häufig in Gesteinen insbesondere als Carbonat vor. In wässrigen Systemen wird oft Hydrogencarbonat gebildet, das eine höhere Löslichkeit als das Carbonat aufweist und für die Wasserhärte verantwortlich ist. Ca - Minerale sind sehr schwer löslich. In physiologischer Hinsicht ist Calcium für den Menschen von sehr großer Bedeutung: Aufbau der Knochen, Zähne , Zellwände sowie für die Muskelkontraktion und Blutgerinnung. Als Grenzwert gelten 200mg/l .
K+: Die Menge an Kalium in Grundwässern liegt meist bei wenigen mg/l. Kalium weist eine höhere Adsorptionsfähigkeit als Natrium gegenüber Böden auf und dient als Pflanzendünger. Stark erhöhte Gehalte in Grundwässern können demzufolge durch eine Auswaschung von Düngern bedingt sein.
Mg2+: Magnesium gilt ebenso wie Calcium als Härtebildner und kommt oft in Verbindung mit Calcium vor. Es verleiht dem Wasser einen leicht bitteren Geschmack, ist allerdings ein wichtiger Stoff bei der Muskelbewegung sowie der Härtung von Knochen und Zähnen. Magnesium ist auch in Silicaten wie Serpentin, Talk oder Asbest häufig vertreten. Der Grenzwert liegt bei 30mg/l.
b) ANIONEN:
Cl-: Chloride sind gut löslich und gelangen sowohl geogen als auch über kommunale Abwassereinflüsse ins Wasser (auch aus Straßenstreusalz). Der salzartiger Geschmack wird etwa ab Konzentrationen von 100 mg/l wahrgenommen. Der Grenzwert liegt bei 200mg/l.
NO3-: Nitrat findet sich in nahezu allen Oberflächenwässern in Konzentrationen zwischen 0,4 und 8 mg/l. Eine wesentliche Quelle ist die Düngung. Erhöhter Nitratgehalt verursacht bei Kleinkindern Blausucht. 50mg/l sind erlaubt.
SO42-: Sulfate finden sich insbesondere in Gebieten mit Gipslagerstätten sowie in Industrieabwässer und Grubenabwässer. Sulfate sind in der Regel gut wasserlöslich. Industrieabwässer weisen ebenfalls oft einen hohen Sulfatgehalt auf. Der Grenzwert liegt bei 250mg/l.
HCO3-: (Hydrogencarbonat) und CO32- (Carbonat)→Wasserhärte:
Hartes Wasser enthält neben den Ca2+ - Ionen meist auch noch Magnesium- und Eisen
- Ionen: Mg2+ und Fe3+
Calciumcarbonat CaCO3 ist in reinem Wasser praktisch unlöslich.
Versuch: Leitet man CO2 in klares Kalkwasser, so trübt sich dieses; unlöslicher Kalkstein fällt aus:
Ca(OH)2 + CO2→CaCO3 + H2O
- setzt man die Einleitung von CO2 fort, so verschwindet die Trübung wieder. Wasserlösliches Calciumhydrogencarbonat hat sich gebildet.
CaCO3 + CO2 + H2O→Ca(HCO3)2 genauer: Ca2+ + 2 HCO3-
Der Kalkstein im Gebirge wird also durch CO2 - hältiges Wasser als Calciumhydrogencarbonat gelöst. Hartes Wasser hat einen hohen, weiches Wasser einen geringen Gehalt an löslichen Calcium- und Magnesiumsalzen.
Vorübergehende und bleibende Wasserhärte:
Beim Erhitzen zerfallen Hydrogencarbonat - Ionen. CO2 und H2O entweichen, und es bildet sich wieder CaCO3, das sich als Niederschlag absetzt:
Ca2+ + 2 HCO3-→CaCO3 + CO2 + H2O
Hartes Wasser enthält neben den Carbonat - Ionen aber auch noch die Säurerest - Ionen anderer Calcium- und Magnesiumsalze: Sulfat - Ionen SO42- und Chlorid Ionen Cl-. Diese und die zugehörigen Ca2+ und Mg2+ bleiben nach dem Ausfällen der Carbonate beim Erhitzen in Lösung und verursachen die „bleibende Wasserhärte“. Die Wasserhärte wird meist in „deutschen Härtegraden“ (°d) angegeben. 1°d entspricht einem Gehalt an 10 mg CaO pro Liter Wasser. Wasser mit 0 - 7 °d gilt als weich, mit 8-15 °d als mittelhart, mit über 15 °d als hart.
2) Kriterien für die Beurteilung der Wasserqualität:
a) Sauerstoffgehalt: Der Sauerstoffgehalt ist abhängig von der Sauerstoffaufnahme
aus der Atmosphäre und von Sauerstoff verbrauchenden Prozessen im Wasser wie dem biologischen Abbau organischer Verbindungen im Wasser. Der Sauerstoffgehalt ist ein Maß für die Selbstreinigungskapazität des Wassers, da der
Sauerstoff organische Verunreinigungen im Wasser oxidiert. Da die Löslichkeit des Sauerstoffs mit steigender Temperatur sinkt, führen Belastungen der Gewässer durch zu große Mengen Abwärme, z.B.: von Kraftwerken, zu Problemen. b) Biochemische Sauerstoffbedarf (BSB): Es ist dies ein Maß für die biologisch abbaubare Verunreinigung im Wasser. Dabei misst man den Sauerstoffverbrauch in der Wasserprobe beim Stehenlassen. Meist wird nach 5 Tagen gemessen. Ein hoher Wert bedeutet eine starke Belastung durch organische Verbindungen. c) pH - Wert: In den meisten Wässern liegt der pH - Wert um den Neutralpunkt (6,5
- 7,5) Niedrige pH- Werte lassen auf den Eintrag starker Säuren schließen (saurer Regen).
d) Elektrische Leitfähigkeit: Es ist dies ein Maß für den Elektrolytgehalt einer
Wasserprobe. Liegt der pH - Wert im normalen Bereich, so gibt die Leitfähigkeit einen Anhaltspunkt zur Abschätzung des Salzgehalts. Der Salzgehalt kann natürlichen Ursprung sein (Mineralwasser), kann aber auch aus industrieller Einleitung (Bergbau) und aus Düngemitteln der Landwirtschaft stammen. Da Quellen und Wirkungen der Salze sehr vielfältig sind, sollen hier nur einige Gruppen herausgegriffen werden:
- Stickstoffhaltige Salze:Ammoniumsalze, Nitrite und Nitrate stammen meist aus der
Düngung. Ein erhöhter Nitritgehalt lässt auf mangelhafte Kläranlagen schließen.
- Phosphat:gelangt durch Ausschwemmung der Düngemittel und durch den Ablauf der Kläranlagen in die natürlichen Gewässer. Es begrenzt die Algenvermehrung. Stehende Gewässer können mit ihren geringen Sauerstoffgehalt die abgestorbenen Algen nicht abbauen und es kommt zum Umkippen des Gewässers.
- Schwermetallsalze:Die Belastung des Wassers durch Schwermetallsalze ist meist industriellen Ursprungs. Vor allem die stark giftigen Salze von Quecksilber, Blei und Cadmium können hier zu Problemen führen. Neben der Giftigkeit spielen diese Spurenelemente eine wichtige Rolle, denn ein Mangel ist schädlich.
V. Klärung von Abwasser - Abwasserentsorgung:
Nach seinem Gebrauch wird aus Wasser Abwasser, das geregelt entsorgt werden muss. Um Gewässeerbelastungen zu vermeiden, wird es über das Kanalsystem einer Abwasserreinigungslage (Kläranlage) zugeführt. Meist werden dabei häusliche und gewerbliche Abwässer vermischt. Nur manche Industriebetriebe leiten ihr Abwasser direkt in ein Gewässer (Direkteinleiter). Die Reinigung des Abwassers muss dann im Betrieb erfolgen.
Ich möchte hier den Bau und die Wirkungsweise einer mehrstufigen Kläranlage erläutern:
Durch den gestiegenen Wasserbedarf des Menschen und die Änderung der Beschaffenheit von Abwässern werden diese für die Natur immer gefährlicher. Die natürliche Reinigungskraft (= Selbstreinigungskraft) der Gewässer reicht nicht mehr aus um die zusätzlich eingeleiteten Schadstoffe abzubauen. Dadurch wird das biologisch-chemische Gleichgewicht in vielen Gewässern gestört. Aufgrund dessen ist eine vom Mensch durchgeführte Abwasserreinigung nötig, die mit mechanischen chemischen und biologischen Verfahren innerhalb kurzer Zeit auf engem Raum den Reinigungsprozess der Natur nachahmt und den Kreislauf des Lebens wieder schließt.
1. Sammlung und Ableitung der Abwässer
Vom Verbraucher (z.B. Haushalt, Gewerbebetrieben, etc.) fließt das verunreinigte Wasser, über die Kanalisation der Kläranlage zu. Dies geschieht entweder in einem Trennsystem (=Trennung von Regenwasser (von Straßen, Plätzen, etc.) und Schmutzwasser) oder einem Mischsystem (=keine Trennung), das den Vorteil hat, dass auch das Regenwasser (es führt Oberflächenschmutz mit sich) mitgeklärt wird.
2. Stufen der Kläranlage
a) Mechanische Abwasserreinigung (mechanische Reinigungsstufe)
In der 1. Reinigungsstufe werden nur ungelöste Stoffe mittels Sedimentierung, bzw. Heraussiebens aus dem Wasser gefiltert. Sie bewirkt eine Reinigung des Wassers um 30%.
Rechen: Hier werden mitgeschwemmte, sperrige Stoffe (Holz, Blech, Kunststoff, etc.) durch hintereinandergeschaltete Grob- und Feinrechen herausgefiltert. Diese würden sonst in der Anlage zu Verstopfungen führen, oder die Reinigungswirkung stören.
Sandfang: An dieser Stelle werden Sand und ähnliche körnige Stoffe (meist mineralisch) aus dem Wasser herausgeholt. Durch eine Verlangsamung der Fließgeschwindigkeit kann eine Absetzung des Sandes erfolgen. Sie ist aber noch so groß, dass leichte, flockige Schwebstoffe weiter mitgeführt werden und so der Sand von organischen Stoffen weitgehend frei ist. Die an der Wasseroberfläche treibenden Leichtstoffe (Benzin, Öle, Fette, etc.) werden am Ende des Sandfangs in einer Ablaufrinne (=Ölabscheider) weggeschafft und gesammelt.
Vorklärbecken: Die meisten ungelösten Stoffe, die von den vorangehende Reinigungsstoffen nicht erfasst wurden werden nun hier herausgefiltert. Bei einer Beckendurchflussgeschwindigkeit von ca. 2 Stunden erfolgt eine Absetzung all derer Stoffe, die schwerer als Wasser sind. Der nun auf dem Grund abgelagerte Schlamm wird aus den Sohltrichtern des Beckens abgepumpt und so in den Faulraum gebracht.
b) Biologische Abwasserreinigung (biologische Reinigungsstufe) = natürliche Selbstreinigung des Gewässers:
Im nun vorgeklärten Wasser sind jetzt hauptsächlich gelöste, organische Verbindungen vorhanden. Die Zersetzung dieser Stoffe wird mit Kleinstlebewesen (Bakterien, Pilze), die die Verbindungen oxidieren gefördert. Die dabei freiwerdende Energie nutzen sie zur Vermehrung, die so stark ist, dass man Kolonien, in Form von Schaumflocken beobachten kann. Zum Erhalt der Kolonien, muss man diese vor Säuren, Laugen und Giftstoffen schützen und ihnen viel Sauerstoff zuführen, damit auch die aeroben Bakterien (sie zersetzten 10 - 20 mal schneller als Anaerobier) optimal arbeiten können.
Tropfkörperverfahren: In einem Tropfkörper wird das Abwasser auf einer mit einem Bakterienrasen (=biologischer Rasen) überzogen Fläche verregnet. An der Decke eines solchen zylindrischen Behälters, der mit bakterienüberzogenen Steinen (Vorteil: Große Oberfläche, viele Zwischenräume, durch die Luft und Wasser ungehindert hindurchtreten können) gefüllt ist wird das Abwasser mit einem Drehsprenger verregnet. Dieses fließt dann von oben über die Steine mit den Bakterien und Einzellern, welche dann die biologischen Abbauvorgänge bewirken. Dabei werden auch Bakterien mitgespült, die dann ins Nachklärbecken kommen. Für ausreichende Belüftung sorgen Belüftungskanäle. Dieses Verfahren eignet sich besondes für Städte und Gemeinden mit nicht mehr als 30 000 Einwohnern. Bei größeren Anlagen wird das Belebtschlammverfahren im Belebungsbecken angewandt.
Belebtschlammverfahren im Belebungsbecken
In diesem Becken wird mit an Stegen befestigten Kreiselbelüftern dem Wasser reichlich Sauerstoff zugeführt. Dabei erreicht man auch eine permanente Umwälzung des Beckens, wodurch die Schlammflocken gleichmäßig verteilt werden und so im ganzen Becken wirken können. Durch Zugabe von Bakterienschlammflocken aus dem Nachklärbecken erreicht man einen höchst effektiven und schnellen Abbau der gelösten Schmutzstoffe, die nun fast vollständig abgebaut werden. Mit beiden Verfahren kann das Wasser um 95 % gereinigt werden.
Nachklärbecken: An dieser Stelle wird der sich im Wasser befindliche Schlamm am Grund abgelagert. Von der Mitte des Beckens aus wird das schlammige Wasser ins Becken und hier zum Rand geleitet. Innerhalb dieser Strecke hat der Schlamm genug Zeit sich am Boden abzusetzen. Bodenräumschilde schieben den Schlamm in dafür vorgesehen Rinnen, wo er dann abgepumpt und dem Schlammfaulraum zugeführt wird. Das nun geklärte und vom Schlamm befreite Wasser wird jetzt bei einer 2 Stufigen Kläranlage wieder den natürlichen Gewässern zugeführt.
c) Chemische Abwasserreinigung (=chemische Reinigungsstufe):
Im Verlauf der vorrangegangenen biologischen Reinigung des Wassers konnten ca. 95% der Schmutzstoffe herausgefiltert werden. Eine zusätzliche Reinigung wird dann nötig, wenn das Wasser in großem Umfang wieder dem Gebrauch zugeführt werden soll (z.B. aus Wassermangel) oder wenn die Restbelastung die Selbstreinigungskraft des Wassers übersteigt. Die Restverschmutzung des Wassers kann v.a. in stehenden Gewässern ein Nahrungsüberangebot v.a. an NO3- und PO43- (=Minimumfaktor) bewirken, welche in der Kläranlage nur zu 30% abgebaut werden. Sie verursachen ein Verstärktes Pflanzenwachstum (Algen u. Plankton), welches für das ,,Blühen der Seen" verantwortlich und sehr schädlich ist (=Eutrophierung).
Durch Zugabe von Fe3+ und Al3+ wird PO43- zu schwer löslichem FePO4 und AlPO4 ausgefällt. Weiterhin wird NO3- eliminiert. In der Nitrifikation wird Amonium (NH4+) zu NO3- welches dann in der Denitrifikation in gasförmigen N umgewandelt wird. Bei diesem Verfahren werden gleichzeitig Bakterien abgetötet. Hierbei kommt es wieder zu einer Schaumbildung. Dieser Schaum wird dann im ruhigen Wasser des Nachklärbeckens sedimentiert.
3. Entsorgung und Weiterverwendung herausgefilterter Stoff
a) Rechengut: Mit Hilfe von Rechenabstreifern werden die herausgefilterten Gegenstände in Containern zwischengelagert und dann zur Mülldeponie oder - verbrennungsanlage gebracht.
b) Sand aus dem Sandfang :Der vom Grund des Sandfangs abgepumpte Sand kann nun noch zusätzlich gereinigt werden und dann als Bausand weiterverwendet werden. Bei starker Belastung kann dieser auch auf die Mülldeponie befördert werden.
c) Klärschlammbehandlung und Beseitigung:
Faultürme: Der aus den Reinigungsstufen angefallene Schlamm wird nun dem Faulraum zugeführt, damit die verbliebenen Schadstoffe im Schlamm abgebaut werden. Der stinkende, flüssige (95% Wasser) Schlamm wird unter Luftabschluss mit Hilfe anaerober Fäulnisbakterien einem Gärprozess unterworfen. In diesem entstehen bei einer Temperatur von 35° C Faulgase (Methan und Kohlendioxid), die für die Heizung des Faulraumes wiederverwendet werden.
Schlammtrockenbeete: Nach 3 - 4 Wochen wird der immer noch flüssige, nun nicht mehr stinkende Schlamm auf die Schlammtrockenbeete gepumpt, von wo er dann nach der Trocknung als Dünger für Gartenbau und Landwirtschaft verwendet werden kann. Bei einer hohen Schadstoffbelastung (v.a. durch Schwermetallsalze wie CaCl2 oder MgSo4) wird dieser jedoch verbrannt.
QUELLEN:
Leonhard Hütter: Wasser und Wasseruntersuchungen: Seite 26 - 34, 44 - 61
Magyar - Liebhart - Jelinek: allgemeine und anorganische Chemie: Seite 141- 150 Kaufmann, Zöchling: Chemie in unserer Welt: Seite 150 / 151 Ortruba: Angewandte Chemie1: Seite 71
http://www.grundwassersanierung.de/chemie.htm
Häufig gestellte Fragen
Was sind die verschiedenen Arten von Wasser, die im Text "SPEZIALGEBIET AUS CHEMIE: Gewässergüte, natürliche Inhaltsstoffe - Gewässerverschmutzung und Abwasserreinigung (Kläranlagen)" beschrieben werden?
Der Text beschreibt Niederschlagswasser, Grundwasser, Quell- und Brunnwasser, Mineral- und Heilwasser, Oberflächenwasser (Fließgewässer und Seen/Stauseen), Meerwasser und Abwasser.
Was ist das Saprobiensystem und wie wird es zur Bestimmung der Gewässergüte verwendet?
Das Saprobiensystem ist eine Methode zur Einteilung der Wasserqualität in Fließgewässern basierend auf dem Vorhandensein bestimmter Organismen (Bioindikatoren). Es teilt Gewässer in vier Güteklassen ein: Oligosaprob, Beta-mesosaprob, Alpha-mesosaprob und Polysaprob.
Wie unterscheidet sich das Trophiesystem vom Saprobiensystem und wann wird es verwendet?
Das Trophiesystem wird zur Beurteilung der Gewässergüte in Stillgewässern (Seen) verwendet. Da sich hier unterschiedliche Wasserschichten bilden und die Gewässergüte nicht durch die üblichen Bioindikatoren festgestellt werden kann, werden das Ausmaß der Produktion (z.B. Planktonentwicklung), die Sauerstoffverteilung, die Sichttiefe und der Gewässergrund untersucht.
Was sind ökomorphologische Untersuchungen und warum sind sie wichtig?
Ökomorphologische Untersuchungen berücksichtigen nicht nur das Gewässer selbst, sondern auch das Gewässerumfeld. Sie geben Aufschluss über den Ausbauzustand und die Naturnähe des Gewässers und werden anhand von Begehungen oder Befahrungen beurteilt. Es wird protokolliert wie die Breitenvariabilität und die Uferbeschaffenheit sind.
Welche chemischen und physikalischen Faktoren werden bei der Gewässeruntersuchung berücksichtigt?
Zu den chemischen Faktoren gehören der Sauerstoffgehalt, der pH-Wert, der Kalk-, Nitrat- und Phosphatgehalt. Zu den physikalischen Faktoren gehören die Temperatur und die Sichttiefe.
Was sind die vier Güteklassen im Saprobiensystem und welche Merkmale kennzeichnen sie?
Die vier Güteklassen sind:
- Güteklasse 1 (Oligosaprob): Unbelastet bis gering belastet, sehr hoher Sauerstoffgehalt, minimale organische Belastung, geringe Bakterienzahl, artenreich und individuenarm.
- Güteklasse 2 (Beta-mesosaprob): Mäßig verunreinigt, hoher Sauerstoffgehalt (schwankend), geringe organische Belastung, geringe Bakterienzahl, arten- und individuenreich.
- Güteklasse 3 (Alpha-mesosaprob): Stark verschmutzt, relativ hoher Sauerstoffgehalt (stark schwankend), mäßig hohe organische Belastung, hohe Bakterienzahl, Rückgang der Artenvielfalt.
- Güteklasse 4 (Polysaprob): "Abwasserzone", übermäßig verschmutzt, geringer Sauerstoffgehalt (bisweilen gegen Null gehend), hohe organische Belastung, sehr hohe Bakterienzahl, artenarm und individuenreich.
Welche An- und Kationen sind in natürlichem Wasser häufig vorhanden und welche Bedeutung haben sie?
Häufige Kationen sind Na+, Ca2+, K+ und Mg2+. Häufige Anionen sind Cl-, NO3-, SO42-, HCO3- und CO32-. Diese Ionen stammen aus dem Erdboden und haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Wasserqualität und die Gesundheit.
Was bedeutet Wasserhärte und wie wird sie bestimmt?
Wasserhärte bezieht sich auf den Gehalt an gelösten Calcium- und Magnesiumsalzen im Wasser. Sie wird in deutschen Härtegraden (°d) angegeben. Hartes Wasser enthält viele Calcium- und Magnesiumsalze, weiches Wasser enthält wenige.
Welche Kriterien werden zur Beurteilung der Wasserqualität herangezogen?
Kriterien sind Sauerstoffgehalt, biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB), pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit. Diese Werte geben Aufschluss über die Belastung des Wassers durch organische Stoffe, Säuren, Salze und Schwermetalle.
Wie funktioniert eine Kläranlage und welche Stufen der Abwasserreinigung gibt es?
Eine Kläranlage reinigt Abwasser in mehreren Stufen:
- Mechanische Reinigung: Entfernt ungelöste Stoffe durch Rechen, Sandfang und Vorklärbecken.
- Biologische Reinigung: Zersetzt gelöste organische Verbindungen mit Hilfe von Mikroorganismen (Tropfkörperverfahren oder Belebtschlammverfahren).
- Chemische Reinigung: Entfernt restliche Verschmutzungen wie Phosphate und Nitrate durch chemische Fällung und Denitrifikation.
Was geschieht mit den herausgefilterten Stoffen in einer Kläranlage?
Rechengut wird deponiert oder verbrannt. Sand wird gereinigt und wiederverwendet oder deponiert. Klärschlamm wird in Faultürmen abgebaut und getrocknet und als Dünger verwendet oder verbrannt.
- Quote paper
- Getzlaff, Stefanie (Author), 2002, WASSER - Gewässergüte, natürliche Inhaltsstoffe des Wassers, Gewässerverschmutzung und Abwasserreinigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106630