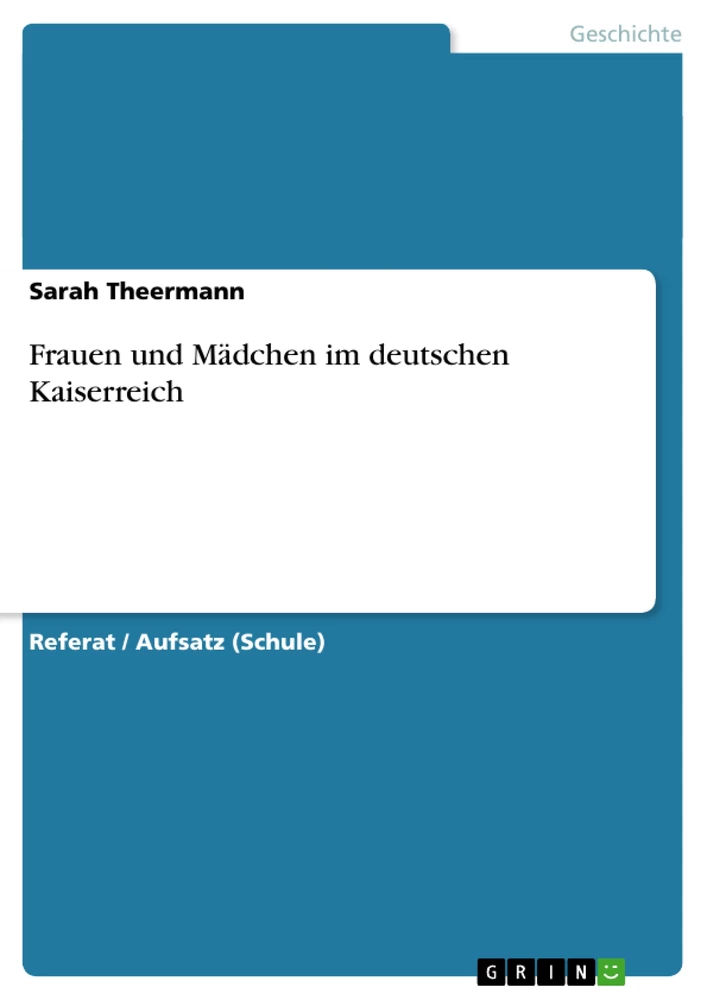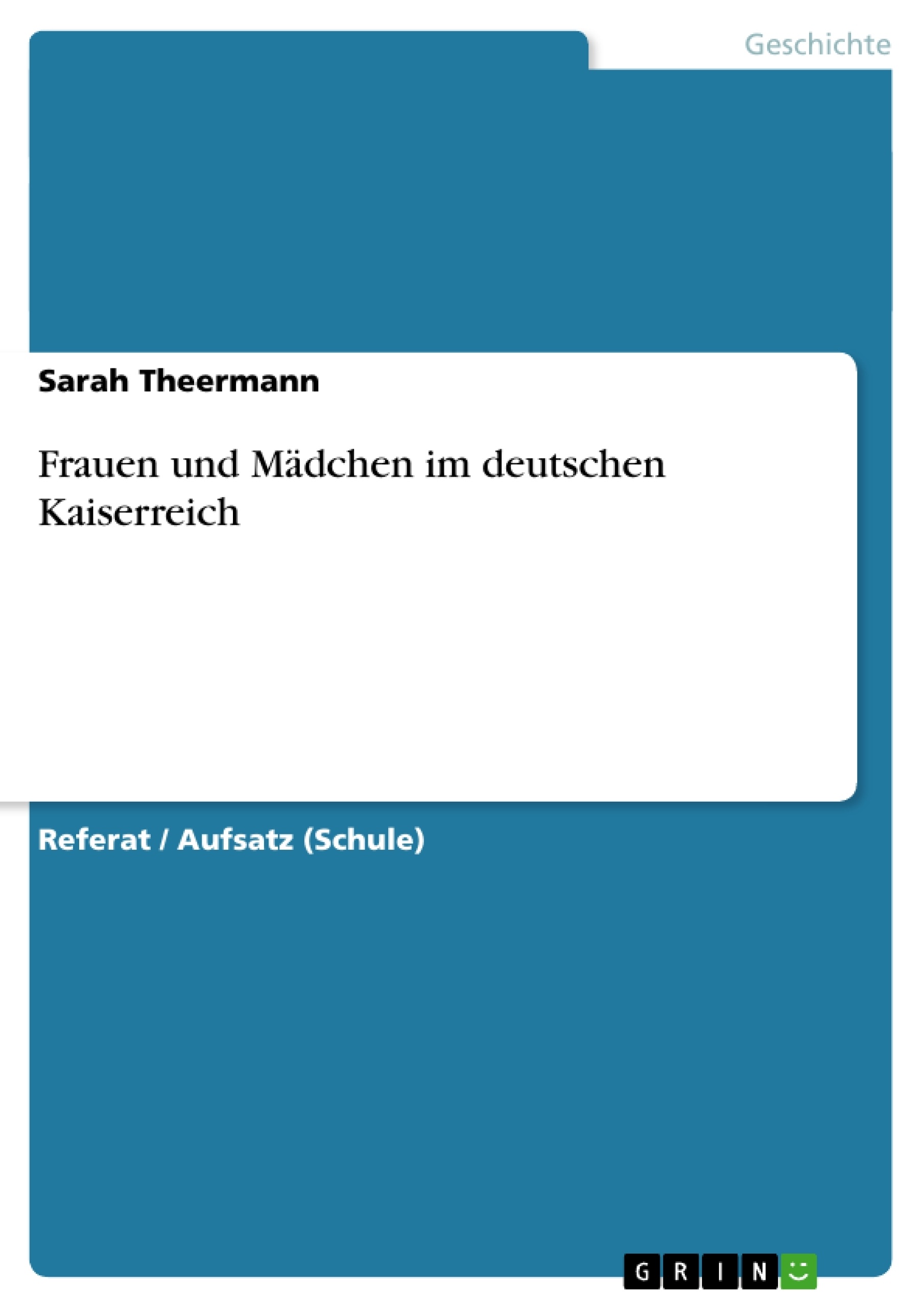War das Kaiserreich wirklich ein Reich der Männer? Entdecken Sie in dieser fesselnden Analyse die verborgenen Lebenswelten von Frauen und Mädchen im Deutschland des 19. Jahrhunderts, eine Zeit des Umbruchs, der Industrialisierung und des aufkeimenden Kampfes für Gleichberechtigung. Erfahren Sie, wie Frauen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten – von Arbeiterinnen in Fabriken bis hin zu Töchtern aus bürgerlichen Familien – ihren Alltag meisterten, geprägt von patriarchalischer Dominanz und begrenzten Möglichkeiten. Die Arbeit beleuchtet die Anfänge der deutschen Frauenbewegung, ihre zentralen Akteurinnen wie Louise Otto-Peters und Clara Zetkin, und die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Bewegung, von den gemäßigten Forderungen der bürgerlichen Frauenrechtlerinnen nach Bildung und Erwerbstätigkeit bis hin zu den revolutionären Zielen der proletarischen Frauenbewegung, die eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft anstrebten. Die Auseinandersetzung mit Themen wie Frauenarbeit, Bildungschancen, Mutterschutz und dem lang ersehnten Frauenwahlrecht wird ebenso thematisiert wie die internen Konflikte und Spaltungen innerhalb der Bewegung, die letztendlich zur Entstehung einer eigenständigen proletarischen Frauenbewegung führten. Tauchen Sie ein in eine Zeit des gesellschaftlichen Wandels, in der Frauen begannen, ihre Stimme zu erheben und ihren Platz in der Welt einzufordern, und verstehen Sie, wie ihre Kämpfe und Errungenschaften den Weg für die moderne Geschlechtergleichstellung ebneten. Ein Muss für alle, die sich für Frauengeschichte, Sozialgeschichte und die Entwicklung der politischen Landschaft Deutschlands interessieren. Entdecken Sie die vielschichtige Geschichte der Frauenbewegung, ihre Erfolge und Rückschläge, und gewinnen Sie ein tiefes Verständnis für die Rolle der Frauen im Kaiserreich und ihren unermüdlichen Einsatz für eine gerechtere Gesellschaft. Die Darstellung der ersten Frauenkonferenz Deutschlands und die Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, der den Ausschluss von Männern vorsah, unterstreicht die Eigenständigkeit und Entschlossenheit der Frauenbewegung. Die Analyse der Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Frauenbewegung und die letztendliche Erlangung der politischen Gleichberechtigung im Jahr 1918 rundet das Bild einer Epoche ab, in der Frauen begannen, die starren gesellschaftlichen Normen aufzubrechen und ihren eigenen Weg zu gehen. Das Buch bietet einen umfassenden Einblick in die Lebensrealitäten, Kämpfe und Erfolge der Frauen im Kaiserreich und zeichnet ein lebendiges und facettenreiches Bild einer Zeit des Umbruchs und der Emanzipation.
I. Einleitung
Das Thema meines Referates lautet "Frauen und Mädchen im deutschen Kaiserreich", allerdings habe ich nach längerer Beschäftigung mit dem Thema erkannt, dass dieses sehr umfangreich ist. Mit Blick auf den begrenzten Umfang der Arbeit sah ich mich deshalb gezwungen dieses Thema einzuschränken und meine Bearbeitung auf die wesentlichen Fakten zu beschränken. Somit gibt mein Referat lediglich einen kurzen Einblick in das Alltagsleben von Frauen und Mädchen, ansonsten habe ich der deutschen Frauenbewegung und deren Spaltung große Bedeutung beigemessen. Abschließend werde ich eine kurze Bewertung der Frauenbewegung von den Anfangen bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges vornehmen.
Kursiv gedruckte Namen und Begriffe finden im Anhang nähere Erläuterung, hier stehen auch nähere Angaben zu den Fundstellen der von mir verwendeten Zitate und natürlich das obligatorische Literaturverzeichnis.
Um zu verstehen, wie es zur Ausbildung einer Frauenbewegung in Deutschland kam, ist ein Einblick in die geschichtlichen Hintergründe (insbesondere in bezug auf den Vormärz 1 und die Revolution von 1848/49 2 ) unerlässlich.
Der geschichtliche Hintergrund
Schon vor Beginn der organisierten Frauenbewegung 1865 begannen die Frauen zunächst zaghaft, später mit Nachdruck für ihre Gleichberechtigung zu kämpfen. 1843 forderte die Begründerin der deutschen Frauenbewegung Louise Otto-Peters die "Teilnahme der Frauen an den Interessen des Staates" und zwar "nicht nur als Recht, sondern als Pflicht"8. Vier Jahre später ergänzte sie diese Forderungen mit dem Recht auf Selbstständigkeit der Frau, das nur durch das Recht auf Bildung und Arbeit erreicht werden könne. Zu dieser Zeit bildeten sich auch erste Frauenerwerbs- und Bildungsvereine. Mit Ausbruch der Revolution von 1848/49 in Deutschland unterstützen demokratische Frauenvereine nicht nur die Aufständischen, sondern es gingen sogar Frauen für Freiheit und Gleichheit auf die Barrikaden. 1849 gründete Louise Otto-Peters die erste politische "Frauen-Zeitung", mit dem Ziel insbesondere innerhalb der Familie Freiheit und Humanität zu erreichen. Diese ersten Emanzipationsbestrebungen der Frauen wurde jedoch durch die Regierung stark beschräkt. 1850 untersagte das Vereins- und Versammlungsgesetz; in Preußen "Frauenpersonen, Geisteskranken, Schülern und Lehrlingen" die Mitgliedschaft in politischen Vereinen und deren Versammlungen (das Gesetz war bis 1908 in Kraft). Das Vereinsgesetz 4 von 1884 führte außerdem zur Auflösung aller Arbeitervereine mit politischen Zielsetzungen und deren Frauenabteilungen. Diese Repressionen führten dazu, dass die deutsche Frauenbewegung stockte und erst mit dem Jahre 1865 in organisierter Form wieder in Erscheinung trat.
II. Hauptteil
1. Der Alltag von Frauen und Mädchen im 19. Jh. und die Anfänge der Frauenbewegung
Im Wesentlichen lassen sich die Frauen zu dieser Zeit in vier Gruppen aufteilen:
1. Die Frauen und Töchter der bürgerlichen Mittel- und Oberschicht ohne Recht auf Arbeit (mit Ausnahme der Gouvernante, Gesellschafterin und später Lehrerin),
2. die in Landwirtschaft, Handel und Gewerbe beteiligen Frauen,
3. ledige oder verheiratete Fabrikarbeiterinnen teilweise mit Kindern, und
4. ledige Dienstmädchen und verheiratete Dienstboten.
Alle diese Frauen lebten in einer von Männern dominierten Welt in der die "gottgewollt. Arbeitsteilung von Männern und Frauen als unveränderlich angesehen wurde (Ergänzungstheorem 5 ). Der Mann hat die Verpflichtung zur Arbeit und zum Kampf, wohingegen. die Frau für die Bewahrung der Güter und für den Schmuck des Hauses zuständig ist. Frau. hatten weder politische noch finanzielle Rechte (Vereinsgesetzt, Mann verfügt über das Vermögen). Als höchste Tugenden der Frau wurden "Unschuld, Sanftmut, Bescheidenheit Artigkeit, Schamhaftigkeit, freundliches und heiteres Wesenb" angesehen, somit fiel der offene Kampf als Mittel der Überzeugung weg. Ferner war es den Frauen untersagt am öffentlichen Bildungssystem teilzunehmen, da Frauenbildung nicht als Notwendigkeit angesehen wurde, sie waren also gezwungen sich Wissen selbst anzueignen, wozu nicht alle Frauen die Möglichkeit hatten. Durch das Vorranschreiten der Industrialisierung 6 , sank ferner der Wert von hauswirtschaftlichen Fähigkeiten und führte gleichzeitig zu einer enormen Steigerung der Lebensansprüche.
Besonders die Arbeiterfrauen hatten unter diesem System zu leiden, da sie gezwungen waren (aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage) für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten. Arbeiterfamilien mussten beide Ehepartner und teilweise auch die Kinder einer Beschäftigung meist in Fabriken nachgehen, um die Familie zu ernähren. Die Frauen waren also einer extremen Doppelbelastung ausgesetzt, da sie nicht nur den Haushalt führen, sondern nebenbei auch no, arbeiten mussten. Dazu kam, dass besonders das Dienstbotenpersonal sehr schlecht behandelt. wurde und die Frauen generell für Hungerlöhne arbeiten mussten. Somit veränderte die Industrialisierung nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch das Familienleben der Arbeiter
In bürgerlichen Familien herrschte zu dieser Zeit eine patriarchalische 7 Hausgemeinschaft vor, d.h. die Frau nimmt die Abhängigkeit vom Mann als gottgewollt hin und die Töchter warten auf eine gute Partie. Außerdem war die Anzahl der vermögensarmen Frauen der Mittelschicht stark gewachsen. Allerdings wurde die Erwerbstätigkeit dieser Schicht nicht als standesgemäßangesehen, deshalb wurde, gingen viele höhere Töchter "heimlich" einer Beschäftigung nach (Verkauf von Handarbeitserzeugnissen). Die Ausbildung der Söhne war recht kostspielig und von einem hohen gesellschaftlichen Stellenwert, außerdem mussten Gesellschaften für die Töchter organisiert werden, um deren Heiratschancen zu verbessern. Diese waren jedoch insgesamt nicht besonders hoch, da Männer eher wohlhabende Töchter ehelichten. So blieb den Mädchen 11 schlechten Heiratschancen nur der Beruf der Gouvernante 8 oder Gesellschafterin (erst ab 18 auch Lehrerin), die jedoch nicht sehr hoch angesehen und zudem noch schlecht bezahlt war (Durch die Beschränkung auf die Familie und den Haushalt senkte auch die geistigen Fähigkeit der bürgerlichen Frauen. Sie hatten zwar viel Zeit, aber keine Gelegenheit wirklich aktiv am öffentlichen Leben teilzunehmen. Trotz dieser Situation bemühten sich dennoch viele bürgerliche Familien ein "standesgemäßes" Leben zu führen, zu dem auch das Dienstbotenpersonal als ei Art Statussymbol gehörte.
Vor diesem Hintergrund begannen zunächst bürgerliche Frauen das Recht auf Bildung und Arbeit zu fordern, um die Selbstständigkeit der Frauen zu stärken und die (v.a. finanzielle) Abhängigkeit vom Mann zu verringern. Diese Ziele wurden jedoch vorerst mit sanften Waffen verfolgt, da man sich gleichzeitig dem Moralsystem dieser Zeit verpflichtet sah. Die Frauen wollten vor allem durch Pflichterfüllung zeigen, dass auch Frauen zur Arbeit fähig sind und Leistung erbringen können und dadurch weitere Rechte und Pflichten erlangen. Die Frauenbewegung jener Zeit stellte die bestehende Gesellschaftsordnung also nicht in Frage und wollte lediglich in die "unpolitischen" Bereichen (d.h. Familie) des Lebens eine Gleichberechtigung erreichen.
Die organisierte Frauenbewegung begann jedoch erst mit der Ersten Frauenkonferenz Deutschlands 9 vom 16. - 19. Oktober 1865, auf der auch der Allgemeine Deutsche Frauenverein 10 (ADF) gegründet wurde. Der Verein untersagte die Mitgliedschaft von Männern, diese waren I als Berater willkommen, aber nicht stimmberechtigt.
2. Die deutsche Frauenbewegung
2.1. Die bürgerliche Frauenbewegung
Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung kämpften vor allem für ihre Selbstständigkeit und somit für die Erwerbstätigkeit um finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Eine Wesentliche Vorraussetzung für die Chancengleichheit bei der Arbeit war jedoch die Chancengleichheit im Bezug auf die Bildung der Frau. Schließlich war einer der Gründe für die Benachteiligung von Frauen deren schlechtere Ausbildung und die wiederum begründete sich in deren schlechteren Schulbildung. So ist es auch nicht verwunderlich, dass auf der ersten Frauenkonferenz vor alle Frauenarbeit und Frauenbildung thematisiert wurden (Resolution vom 19. Okt. 1865 11). Neben diesem übergeordneten Ziel gab es noch weitere konkrete Forderungen, wie etwa die Gründung von Industrie- und
Handelsschulen für Mädchen, Arbeiterinnenschutz, Mutterschutz, Chancengleichheit im Beruf, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und schließlichdas Frauenwahlrecht, das jedoch eher zaghaft gefordert wurde. Die Mitgliederzahl des ADF stieg den ersten fünf Jahren von 34 auf 10.000 Mitglieder. Weitere Vereine wurden gegründet, so au. der "Verein zur Förderung der Erwerbstätigkeit des weiblichen Geschlechts 12 " 1866 (später Lette Verein), dessen Leitung 20 Männern und 5 Frauen oblag, der allerdings die politische Emanzipation ablehnte. 1869 schlossen sich die verschiedensten Frauenvereine unter eine Dachverband zusammen. Trotz der mit immer mehr Nachdruck gestellten Forderungen wurden erst 1872/73 den Frauen andere Berufe als der der Lehrerin zugänglich gemacht (Erzieherin, Bahn-, Post-, Telegraphendienst). Zu dieser Zeit begann Hedwig Dohm die absolute Gleichstellung der Frau im politischen, wie auch im privaten Bereich zu fordern
("Menschenrechte haben kein Geschlecht!C") und grenzte sich dadurch stark von der restlichen Frauenbewegung ab. Die Regierung begann die Vereine als Bedrohung der gesellschaftlichen Ordnung anzusehen und begann mit der Auflösung zahlreicher Vereine aufgrund des Versammlungs- und Vereinsgesetzes.
Der Widerstand gegen die Emanzipationsbestrebungen der Frauen wurde immer stärker. Vie Männer vertraten die Ansicht, dass Frauenbildung nur insofern von Bedeutung ist, dass die Frau den Mann nach einem langen Arbeitstag dann zumindest nicht „langweilt“ Höhere Bildung wurde zum Teil bestärkt durch pseudo-wissenschaftliche Studien als überflüssig bewertet, wurde sogar behauptet "das Studium würde zum Verkümmern der Gebärorgane und damit zu Unfruchtbarkeit führen". Aber auch Frauen, die mit den herrschenden Umständen zufrieden waren (vor allem religiöse und konservative Frauen) stellten sich der deutschen Frauenbewegung entgegen. Ihrer Meinung nach sollte die Frau die Rolle einer Freundin, Ratgeberin und Gesellschafterin für den Mann übernehmen. Die 1887 veröffentlichte Helene Lange eine Petition deren Begleitschrift (die sog. "Gelbe Broschüre 13 ,,) die bisherige Schulausbildung der Mädchen zu eben diesem Zweck kritisierte.
Die bürgerliche Frauenbewegung und besonders deren Vorreiterinnen Helene Lange und Gertrud Bäumer, betonten jedoch immer die Bedeutung der "Mutterschaft als höchster Berufe", wobei Mutterschaft nicht nur im biologischen Sinne gemeint war, sondern als Eigenschaft aller Frauen. Ihnen gegenüber stand nur ein kleiner radikaler Flügel, der die Gleichheit aller Menschen forderte und die auch das Frauenwahlrecht als konkretes Ziel sahen. 1889 wurden erstmals "Realkurse" für Frauen eingerichtet, die zwei Jahre später in Gymnasialkurse umgewandelt wurden. 1890 wurde der "Allgemeine Deutsche Lehrerinnen- Verein 14" gegründet und im Jahre 1892 wurden in Preußen erstmals Mädchen zur Reifeprüfung zugelassen. Trotz dieser Erfolge blieb die Gleichberechtigung der Frauen auch auf politischer Ebene ein fernes Ziel. Am 29. März 1894 schlossen sich 34 (verschiedensten Frauenvereine im "Bund Deutscher Frauenvereine 15 " (BDF) zusammen. Innerhalb des Vereins kam es allerdings aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunkte zu Auseinandersetzungen. Dieser Verein weigerte sich auch aufgrund ihrer politischen Ziele sozialistische Arbeiterinnenvereine aufzunehmen. Diese Begebenheiten führten zusammen mit den Unterschieden in der Zielsetzung schließlich zur Entstehung einer eigenständig proletarischen Frauenbewegung.
1900 wurden in Baden erstmals Frauen zum Studium an Universitäten zugelassen, wo sie vorher nur als Gasthörerinnen toleriert wurden, bis 1909 folgten andere Bundesländer diesem Beispiel. Allerdings entgegen starker Proteste Seitens der Professoren, man berichtet von einem, der ein Schild mit der Aufschrift "Hunde und Damen nicht erwünscht!" an der Hörsaaltür anbringen ließ. 1905 umfasste der "Bund Deutscher Frauenvereine" 190 Verbände und hatte fast 100.000 Mitglieder.
Immer wieder spalteten sich jedoch kleinere Gruppierungen ab, wie etwa konservative Gruppen die sich für eine Aufwertung des Hausfrauenberufes einsetzten und die Emanzipationsbestrebungen ablehnten (sie kümmerten sich hauptsachlich um Wohlfahrtsarbeit). Außerdem gab es verschiedene "linke" Gruppen, die vehement das Frauenwahlrecht forderten und auch tabuisierte Themen, wie die soziale Ächtung lediger Mütter, gesellschaftliche Ursachen der Prostitution und die sexuelle Doppelmoral, behandelten.
2.2. Die Proletarische Frauenbewegung
Vertreterinnen der proletarischen Frauenbewegung und vor allem ihre Vorreiterin Clara Zetkin legten immer wieder großen Wert darauf, dass diese eben nicht nur ein Abkömmling der bürgerlichen Frauenbewegung war, sondern sich von dieser wesentlich unterschied. Die proletarische Frauenbewegung richtete sich im Gegensatz zur bürgerlichen sehr wohl gegen die bestehende Gesellschaftsordnung und forderte deren Aufhebung um die Bedingungen für alle Arbeiter zu verbessern. Die Proletarische Frauenbewegung war also "eingebettet in die sozialistische Arbeiterbewegungf" und kämpfte für eine klassenlose Gesellschaft. Sie forderte die Durchsetzung der Forderungen der Arbeiterbewegung allgemein, sowie deren Anhängerinnen eine Beteiligung an innerparteilichen Kontroversen. Somit wurde die proletarische Frauenbewegung durch die Regierung als Gefahr angesehen und stand Zeit ihres Bestehens unter besonderer Beobachtung (1865: Verbot des "Vereins zur Wahrnehmung der Interessen der Arbeiterinnen").
Auch die proletarische Frauenbewegung hatte gegen den Widerstand vieler Männer (auch innerhalb der Arbeiterbewegung) zu kämpfen, die eine Lösung des Problems nur durch die Rückkehr der Frau ins Haus sahen, um die Löhne der Männer zu erhöhen und zu sicheern. Allerdings wurde eine entsprechende Forderung 1869 auf dem allgemeinen deutschen sozial-demokratischen Arbeiterkongress abgelehnt, aus Angst, man könnte erwerbslose Frauen in die Prostitution treiben.
Die proletarische Frauenbewegung vertrat die Ansicht, dass Frauenarbeit ein wichtiger Schritt zur sozialen Gleichberechtigung der Frau sei und die Konkurrenz zwischen Männern und Frauen nur durch gemeinsame Organisation verringert werden könne. Aber genau dieses feste organisatorische Gefüge fehlte der proletarischen Frauenbewegung.
1878 veröffentlichte August Bebel sein Werk "Die Frau und der Sozialismus" in dem er die Lösung der Frauenfrage nur in der Aufuebung der Klassengegensatze sah. Kurz nach Erschein des Werks wurde es durch das „ Sozialistengesetz I6 " verboten und nur noch unter Tarntiteln weiter veröffentlicht. 1895 nahm die SPD als erste Partei das aktive Wahlrecht für Frauen in ihr Parteiprogramm auf, jedoch nicht das passive. Immer noch herrschte im Reich die Meinung vor, dass Frauen innerhalb der Familie eine entscheidende Rolle spielen, die Politik jedoch dem Mann vorbehalten sein sollte (aufgrund der Unfähigkeit der Frauen). 1902 gründete sich schließlich der "Verein für Frauenstimmrecht 7 " aber erst 1908 wurde es Frauen ermöglicht Mitglieder politischen Parteinen und Gewerkschaften zu werden.
Die proletarische Frauenbewegung wurde jedoch stärker von der Regierung behindert als die bürgerliche und war deshalb auch in ihren Möglichkeiten eingeschränkt. Sie stand nicht nur unter ständiger Beobachtung, sondern wurde wegen ihrer "reichsfeindlichen" Haltung auch Opfer zahlreicher Bestimmungen zum "Schutz der bestehenden Gesellschaftsordnung". So war die proletarische Frauenbewegung weit mehr als die bürgerliche auf Tarnorganisationen und "Untergrundarbeit" angewiesen und ihre Erfolge fielen auch wesentlich "kläglicher" aus, als die der bürgerlichen Frauenbewegung.
2.3. Frauen zu Beginn des Ersten Weltkrieges
1914 gründete Gertrud Bäumer, die Vorsitzende des BDF, den nationalen Frauendienst, der in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und verschiedenen Wohlfahrtsverbänden versuchte die soziale Not in Deutschland zu lindern. Erstmals arbeiteten Vertreterinnen der proletarischen und der bürgerlichen Frauenbewegung zusammen um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Allerdings kam es nun zu Auseinandersetzungen zwischen Nationalistinnen und Pazifistinnen. Während Erstere (besonders Angehörige des konservativ-nationalen Flügels der Bewegung) sich von der Kriegsbegeisterung regelrecht mitreißen ließen, wurden besonders die Anhängerinnen der proletarischen Frauenbewegung in der Friedensbewegung aktiv.
Die endgültige politische Gleichberechtigung wurde erst 1918 mit der Ausrufung der Republik als Ergebnis der "Novemberrevolution 18" erreicht.
3. Fazit
Obwohl es wesentliche Unterschiede zwischen der proletarischen und der bürgerlichen Frauenbewegung gab, insbesondere was die Organisation und die Zielsetzungen angeht, lassen sich dennoch Parallelen ziehen.
Die Vorreiterinnen beider Bewegungen stammten größtenteils aus bürgerlichen Verhältnissen und hatten zumeist eine Lehrerinnenausbildung. Viele hatten während ihrer jungen Jahre auch die ungleiche Behandlung der Geschlechter am eigenen Leib erfahren müssen. Sie alle hatte sich besonders für die aktuelle Politik der damaligen Zeit interessiert und setzten sich für eine Veränderung der Gesellschaft ein um die Bedingungen für Frauen zu verbessern. Redeverbote, die Einschränkung oder sogar das Verbot der Versammlungsfreiheit und die Lächerlichmachung durch politische Gegner haben die Arbeit beider Bewegungen stark beeinträchtigt, wobei jedoch die proletarische Frauenbewegung zugegebenermaßen größeren Einschränkungen unterworfen war. Auch die Ziele beider Bewegungen stimmten teilweise überein, so wollten beide die politische Gleichberechtigung der Frau, wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung, erreichen. Weitere übereinstimmende Forderungen waren: gleicher Lohn für gleiche Arbeit, eine wesentliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Mutterschutz, Gleichstellung von Mann und Frau auch im finanziellen Bereich, sowie gleiche Bildungschancen und das Recht Frauenarbeit. Letzteres führte jedoch zu einer stärkeren Konkurrenzsituation zwischen Männern und Frauen und somit auch zu mehr Widerstand besonders bei der männlichen Bevölkerung. Jedoch kämpften die bürgerlichen Frauen dafür, überhaupt erst mal arbeiten zu dürfen, die proletarischen Frauen dagegen kämpften vor allem gegen das Verbot der Frauenarbeit.
Dennoch gibt es auch wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Bewegungen. Höchste Priorität hatte für bürgerliche Frauen das Recht auf Bildung, da sie hierin die Vorraussetzung für die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der Frau sahen. Sie wendeten sich bei ihrem Kampf um die Realisierung dieses Zieles aber niemals gegen das herrschende politische und gesellschaftliche System und sie hielten zu jeder Zeit an den bürgerlichen Moralvorstellungen fest. Vor allem das Frauenwahlrecht wurde von vielen nur als fernes, utopisches Ziel angesehen und wurde somit stark vernachlässigt, zugunsten der Forderung nach Frauenbildung. Ferner war die bürgerliche Frauenbewegung eher feministisch geprägt als die proletarische, da sie eine Veränderung der
Gesellschaft für Frauen durch Frauen forderte. Die proletarischen Frauen dagegen sahen sich als „Zweig" der Arbeiterbewegung und richteten sich gegen das bestehende System, besonders gegen den Kapitalismus und die Klassengegensätze. Die Frauenfrage war also hier nur ein Aspekt unter vielen. Sie forderten vor allem eine Veränderung der Sozialpolitik des Reiches und schließlich eine klassenlose Gesellschaft, allerdings nicht nur um eine Verbesserung der Bedingungen der Frauen zu erreichen, sondern für die gesamte Menschheit.
Tatsächlich kann man sagen, dass die Frauen zu dieser Zeit viele wichtige Rechte erhielten jedoch ist durchaus fragwürdig ob dies ausschließlich der organisierten Frauenbewegung zu verdanken ist. Meiner Meinung nach waren andere Faktoren ebenso für diese Entwicklung verantwortlich. Die wirtschaftliche Lage hatte sich durch die Industrialisierung stark verändert und auch die Bedingungen für die Arbeiterschaft insgesamt wurden zu dieser Zeit verbessert (Sozialgesetzgebung I9 ), da man immer mehr erkannte welches Potential (auch politisch) in der Arbeiterschaft steckt. Ferner zeigten die Geschehnisse des Ersten Weltkrieges die Abhängigkeit der Männer von den Frauen. Doch vor allem hatte sich die Gesellschaft ideologisch weiterentwickelt und Grundsätze wie etwa Gleichheit, Mündigkeit und Selbstständigkeit wurden immer wichtiger. Ich denke jedoch, dass die Frauenbewegung vor allem durch ihre Öffentlichkeitsarbeit (Zeitungen, Zeitschriften und Flugblätter...) das Bewusstsein der Bevölkerung für die Problematik der Stellung der Frauen in der Gesellschaft geschärft hat und somit nicht unwesentlich zu einem regelrechten Wandel der Gesellschaft beigetragen hat.
ÜI. Anhang
I. Erläuterungen
1: Vormärz: Bezeichnung für die zur Revolution im März 1848 hinführende literarische Epoche. Während ihr Ende mit der Revolution eindeutig datiert ist, gibt es für ihren Beginn unterschiedliche Auffassungen. Drei Möglichkeiten werden diskutiert. 1.1n Analogie zur Geschichtsschreibung umfasst Vormärz als literaturgeschichtlicher Epochenbegriff die Periode von 1815 (Gründung des Deutschen Bundes) bis 1848. Damit richtet sich der Begriff Vormärz zugleich gegen die konkurrierenden Epochenbezeichnungen Biedermeier bzw . Restaurationszeit und die ihnen innewohnende Gewichtung: Betonen diese Begriffe den restaurativen Charakter der fürstlichen Politik im Deutschen Bund und die konservativ-beharrenden kulturellen und literarischen Tendenzen als prägende Momente der Epoche, so legt der Begriff Vormärz den Akzent auf die soziale und politische Dynamik und die kritisch-oppositionellen bzw . revolutionären Literaturströmungen. 2. Verbreiteter ist die Datierung der Epoche von der französischen Julirevolution des Jahres 1830 bis zur Märzrevolution von 1848. Sie lässt sich auch dadurch stützen, dass die politische Zäsur mit dem durch Goethes Tod symbolisierten Ende der klassisch-romantischen Kunstperiode eine Bestätigung auf literarischem Gebiet erhält. Als gemeinsamer Nenner der literarischen Entwicklung in dieser Epoche gilt die zunehmende Politisierung und Radikalisierung, die von der liberalen Publizistik der Jungdeutschen zur revolutionären demokratischen Literatur (ab 1840) führt. 3.Der BegriffVormärz wird auf die Periode von 1840 bis 1848 eingegrenzt, also auf die unmittelbar in die Revolution mündenden Jahre. Nach dem Zerfall der jungdeutschen Bewegung und der literarischen und politischen Stagnation nach 1835/36, setzten um 1840/41 neue Entwicklungen ein: Die so genannte Rheinkrise von 1840 löste eine nationale Begeisterungswelle aus, die Thronbesteigung von Friedrich Wilhelm IV. von Preußen weckte politische Hoffnungen (1840 Amnestie für politische Vergehen, 1841 Lockerung der Zensur), mit dem Auftreten der Jung- und Linkshegelianer, die den eine radikale, systemkritische Dimension. Allerdings war die Lockerung der politischen Repressionsmaßnahmen nur von kurzer Dauer; die meisten Autoren des Vormärz wurden für kürzere oder längere Zeit ins Exil getrieben (Zürich, Brüssel, Paris, London).h
2: Revolution von 1848/49: Träger der Revolutionen waren vor allem das erstarkende Bürgertum, das entsprechend seinem Gewicht in der Gesellschaft Mitwirkung im Staatswesen einforderte; daneben waren in unterschiedlichem Maße nationalstaatliche und soziale Komponenten wirksam. Nicht beteiligt an den europaweiten revolutionären Auseinandersetzungen waren Russland, wo die autokratische Regierung jegliche Opposition unterdrückte, sowie England und Spanien, wo durch gesetzgeberische Maßnahmen vorläufig Ruhe eingekehrt war. Obwohl die verfassungsmäßigen Zugeständnisse der Regierungen in Reaktion auf die revolutionären Erhebungen nur vergleichsweise gering und kurzlebig waren, so zeitigten die Revolutionen doch nachhaltige soziale, wirtschaftliche und nationalstaatliche Wirkungen.i
3: Vereins- und Versammlungsgesetz: In Preußen 1850 verabschiedetes Gesetz, das bis 1908 Gültigkeit hatte und Frauen, Schülern und Lehrlingen die Mitgliedschaft in politischen Vereinen verbot und deren Teilnahme an politischen Versammlungen untersagte.
4: Vereinsgesetz: 1854 vom Bundestag in Frankfurt am Main verabschiedetes Gesetz, dass die Auflösung aller Arbeitervereine mit politischen Zielsetzungen und der in diesen Vereinen tätigen Frauenabteilungen vorschrieb.
5: Ergänzungstheorem: Dogma von der von Gott gewollten Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, bei der sich die Zuständigkeitsbereiche ergänzen. Der Mann ist zuständig für die Arbeit, den Kampfund die Jagd, während die Frau sich um die Familie und deren Versorgung kümmert.
6: Industrialisierung: ein Prozess, der eine Volkswirtschaft so umgestaltet, dass die Industrie im Verhältnis zu Landwirtschaft und Handwerk zunehmend an Bedeutung gewinnt. Aus einer Agrargesellschaft wird im Verlauf der Industrialisierung eine Industriegesellschaft. Bei einer erfolgreichen Industrialisierung steigen das Pro-Kopf-Einkommen und die Produktivität einer Volkswirtschaft. Die Industrialisierung der Erde begann Ende des 18. Jahrhunderts mit der industriellen Revolution in Großbritannien.j
7: patriarchalisch: Patriarchat (aus griechisch archos: Herrschaft, Recht, Ursprung; und lateinisch pater: Vater), männlich dominierte Gesellschaftsordnung, in der der Vater in der Familie über die uneingeschränkte Entscheidungs- und Befehlsgewalt verfügt. Patriarchale Gesellschaftsordnungen sind besonders in Agrargesellschaften verbreitet, in denen die Weitergabe von Erfahrungswissen von besonderer Bedeutung ist und damit ein Mittel der politischen Kontrolle darstellen kann.k
8: Gouvernante: Hauslehrerin, Erzieherin
9: Erste Frauenkonferenz Deutschlands: 1865 von Louise Otto-Peters mitinitiierte Konferenz in Leipzig auf der auch der Allgemeine Deutsche Frauenverein gegründet wurde.
10: Allgemeiner Deutscher Frauenverein: 1865 in Leipzig gegründeter Dachverband, der die Interessen von zahlreichen Frauenerwebs- und -bildungsvereinen bündelte.
11: Resolution vom 19.10.1865: ,,1. Die erste deutsche Frauenkonferenz erklärt die Arbeit, welche die Grundlage der ganzen neuen Gesellschaft sein soll, für eine Pflicht und Ehre des weiblichen Geschlechts, sie nimmt dagegen das Recht der Arbeit in Anspruch und hält es für notwendig, dass alle der weiblichen Arbeit im Wege stehenden Hindernisse entfernd werden. Ü. Wir halten es für ein unabweisbares Bedürfnis, die weibliche Arbeit von den Fesseln des Vorurteils, die sich von den verschiedensten Seiten gegen die geltend machen, zu befreien. Wir halten in dieser Hinsicht die Agitation durch Frauenbildungsvereine und die Presse die Begründung von Produktivassociationen, welche den Frauen vorzugsweise empfohlen werden, die Errichtung von Industrie-Ausstellungen für weibliche Arbeitserzeugnisse, die Gründung von Industrieschulen für Mädchen, die Errichtung von Mädchenherbergen, endlich aber auch die Pflege höherer wissenschaftlicher Bildung für geeignete Mittel, dem Ziele näher zu kommen. [...],,1
12: Lette-Verein: ,,1866 von Wilhelm Adolf Lette in Berlin gegründeter Verein, der sich die Förderung weiblicher Erwerbstätigkeit zum Ziel setzte. Lette beabsichtigte, den Bereich der sozialen Fürsorge für Frauen zu erschließen. Der Verein, der sich später Lette- Verein nannte, wurde von Frauen aus dem gehobenen Bürgertum dominiert; er ist dem bürgerlichen Flügel der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert zuzurechnen. Grundlage seiner Tätigkeit war der Umstand, dass Berufstätigkeit für Frauen aus dem (gehobenen) Bürgertum verpönt oder gar verboten war, während Frauen aus der Arbeiterklasse zur Arbeit gezwungen waren. In den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Frauenverein, den Louise Otto- Peters gegründet hatte. Heute ist der Verein eine Stiftung des öffentlichen Rechts und Träger von Berufsbildungseinrichtungen (Fachschulen), die staatlich anerkannte Abschlüsse vergeben."m
13: Gelbe Broschüre: Begleitschrift, die vor allem das bis dahin angestrebte Bildungsziel der Mädchen kritisierte und aufgrund ihrer sehr deutlichen Sprache zu jener Zeit starkes Aufsehen erregte.
14: Allgemeiner Deutscher Lehrerinnenverein: 1890 von Helene Lange mitbegründeter und geleiteter Verein, der die Forderungen der deutschen Lehrerinnen vertrat.
15: Bund Deutscher Frauenvereine: 1894 durch den Zusammenschluss von 34 Gruppierungen der bürgerlichen Frauenbewegung gegründeter Verein, der ein Zusammenwirken der gemeinnützigen Frauenvereine in Deutschland erleichtem sollte.
16: Sozialistengesetz: "Bezeichnung für das Gesetz "wider die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" im Deutschen Reich. Es wurde auf Betreiben von Reichskanzler Otto von Bismarck am 21.Oktober 1878 vom Reichstag beschlossen, nachdem angebliche Anarchisten auf Kaiser Wilhelm I. zwei (gescheiterte) Attentate unternommen hatten, die den Sozialdemokraten angelastet wurden. Bereits zuvor hatte man die Arbeiterführer August Bebel und Wilhelm Liebknecht, die sich gegen den Deutsch-Französischen Krieg ausgesprochen hatten, wegen Hochverrats inhaftiert. Ziel Bismarcks war es, die 1875 in Gotha gegründete und unter den Arbeitern schnell erfolgreiche Sozialistische Arbeiterpartei (SAP) zu zerschlagen. Verboten wurden alle sozialdemokratischen, sozialistischen und kommunistischen Vereine, die den "Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung" zum Ziel hatten - dazu gehörten neben der SAP auch die Gewerkschaften. Das Gesetz richtete sich gegen die Organisationen selbst, außerdem gegen deren Publikationen und Versammlungen. Bei Zuwiderhandlungen konnten Geld- und Gefängnisstrafen verhängt werden. Die neun Abgeordneten der SAP im Reichstag konnten jedoch weiterarbeiten, ebenso durfte sich die SAP weiterhin an Reichstagswahlen beteiligen. Zunächst auf zweieinhalb Jahre befristet, wurde das Gesetz bis 1890 regelmäßig verlängert. Trotz der staatlichen Unterdrückung ließsich der Erfolg der Sozialdemokratie nicht aufhalten. Die Führung arbeitete im Untergrund weiter. Turn-, Naturfreunde- oder Radsportvereine entstanden als Tarnorganisationen, in denen die regionale Parteiarbeit fortgesetzt wurde. Bei Aufhebung des Sozialistengesetzes 1890 hatte die SAP die Zahl ihrer Wählerstimmen mehr als verdreifacht und war damit, neu formiert als Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), stärkste Wählerpartei im Deutschen Reich."n
17: Verein für Frauenstimmrecht: 1902 in Harnburg gegründeter Verein, der durch Flugblätter, Zeitschriften und Broschüren die Einführung des Frauenwahlrechts forderte.
18. Novemberrevolution: Umsturz in Deutschland im November 1918. der die Monarchien beseitigte und zur Errichtung einer parlamentarisch-demokratischen Republik führte. 19: Sozialgesetzgebung: Unter Bismarck eingeführte Gesetze zur Unfall-(1884), Kranken-(1883), Invaliden- und Altersversicherung (1889).
2. alphabetisches Namenregister
Bäumer, Gertrud: Vorreiterin der bürgerlichen Frauenbewegung und jahrelange Vorsitzende des Bundes deutscher Frauenvereine. G. Bäumer war es auch, die 1914 den Nationalen Frauendienst ins Leben rief, der die soziale Not in Deutschland während des Krieges lindern sollte.
Bebel, August: (1840-1913), Politiker, Mitbegründer der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und deren langjähriger Vorsitzender. Bebel wurde am 22. Februar 1840 in Deutz bei Köln geboren; 1860 ließer sich als Drechslermeister in Leipzig nieder. Unter dem Einfluss Lassalles wandte sich Bebel dem Sozialismus und der Arbeiterbewegung zu; 1865 übernahm er den Vorsitz des Arbeiterbildungsvereins in Leipzig und 1867 den Vorsitz im Verband der deutschen Arbeiterbildungsvereine. 1866 gründete er zusammen mit Wilhelm Liebknecht die Sächsische Volkspartei, für die er noch im selben Jahr in den Reichstag des Norddeutschen Bundes gewählt wurde. 1869 war er in Eisenach, wieder zusammen mit Liebknecht, maßgeblich an der Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) beteiligt, die dem internationalen Sozialismus der Ersten Internationalen und Karl Marx nahe stand und an Lassalle und dessen Allgemeinem Deutschen Arbeiterverein (ADA V) Kritik übte. Seit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 gehörte Bebel fast bis zu seinem Lebensende (mit kurzen Unterbrechungen) dem deutschen Reichstag an, von 1881 bis 1891 zugleich dem sächsischen Landtag. 1872 wurde er zusammen mit Liebknecht wegen Hochverrats und Majestätsbeleidigung zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt; nach seiner Freilassung betrieb er 1875 in Gotha maßgeblich den Zusammenschluss von SDAP und ADA V zur Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP), der Vorläuferin der SPD. Gegen den zunehmenden Erfolg und Einfluss der SAP erließder Reichstag 1878 auf Druck des Reichskanzlers Otto von Bismarck die Sozialistengesetze, auf deren Grundlage neben verschiedenen anderen Gruppierungen und Verbänden wie z.B. den Gewerkschaften auch die SAP verboten wurde; in der Folge war die aus neun Abgeordneten (unter ihnen Bebel) bestehende SAP-Reichstagsfraktion das einzige legale Gremium der Sozialisten in Deutschland. Nach Aufhebung der Sozialistengesetze und dem Sturz Bismarcks war Bebel 1891 entscheidend an der Neuorganisation der deutschen Sozialisten in der SPD und an der Formulierung ihres Erfurter Programms beteiligt und wurde erster Vorsitzender der Partei. In den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts baute Bebel die SPD zu einer Massenpartei aus; 1912 war die SPD stärkste Fraktion im Reichstag. Innerhalb der SPD vertrat Bebel eine marxistische Mittellinie; er war gegen linke Radikalisten und rechte Revisionisten, für einen Ausgleich zwischen marxistischer Theorie und politischer Praxis. Programm und Organisation der SPD hatten Vorbildfunktion für die Zweite Internationale. Bebel schrieb u.a. "Unsere Ziele" (1870), "Der Deutsche Bauernkrieg" (1876), "Die Frau und der Sozialismus" (1879), "Charles Fourier" (1888) und "Aus meinem Leben" (3 Bde., 1910-1914).0
Dohm, Hedwig: Frauenrechtlerin, verfasste zahlreiche provokative Schriften in denen sie die absolute Gleichstellung von Mann und Frau verlangte und unterschied sich durch ihre radikale Einstellung von den meisten Anhängerinnen der organisierten Frauenbewegung. Lange, Helene: (1848-1930), deutsche Sozialpolitikerin und Frauenrechtlerin. Helene Lange wurde am 9. April 1848 in Oldenburg geboren. Nach einer Lehrerinnenausbildung war sie ab 1872 als Lehrerin an verschiedenen Berliner Mädchenschulen tätig. In dieser Zeit baute sie u.a. ein Lehrerinnenseminar auf und wirkte auf eine Reform der Mädchenschulbildung hin, die den Mädchen eine zeitgemäße Ausbildung ermöglichen sollte. 1889 wurden unter ihrer Leitung "Realkurse für Frauen" eingeführt, die auf das externe Abitur oder praktische Berufe vorbereiteten. Im folgenden Jahr wurde sie Vorsitzende des von ihr mitgegründeten Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins, 1892 außerdem Vorsitzende des A11gemeinen Deutschen Frauenvereins, den Louise Otto Peters 1865 gegründet hatte, und 1894 gründete sie den Bund Deutscher Frauenvereine, dem sich zahlreiche deutsche Frauenverbände als Dachorganisation unterordneten. Ab 1893 gab Helene Lange die Zeitschrift Die Frau heraus, die sie zum führenden Organ der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland machte. Unter ihrer Regie erschien auch das fünfbändige Handbuch der Frauenbewegung (1901-1906); außerdem warb sie in zahlreichen Publikationen und Vorträgen für ihr Ziel: die Emanzipation und die rechtliche Gleichstellung der Frauen. Helene Lange starb am 13. Mai 1930 in Berlin. p
Otto-Peters, Louise: (1819-1895), gilt als so genannte Mutter der deutschen Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts. Louise Otto-Peters wurde am 26. März 1819 in Meißen geboren. Im Vormärz und während der Revolution von 1848/49 politisierte sich Otto-Peters und gründete 1849 die erste Zeitschrift der deutschen Frauenbewegung (Frauen-Zeitung), die ab 1851 mit dem Untertitel Ein Organ für die höheren weiblichen Interessen erschien. Mit diesen höheren Interessen waren die Beseitigung der rechtlichen Überordnung des Mannes in der Ehe sowie der Hürden für die weibliche Berufstätigkeit gemeint. Otto-Peters veröffentlichte auch unter dem Pseudonym Otto Stern. 1852 wurde die Frauen-Zeitung verboten, und Otto-Peters heiratete den inhaftierten Demokraten August Peters. 1865 grUndete sie zusammen mit anderen Frauen den Allgemeinen Deutschen Frauenverein, der zum Kern der bürgerlichen Frauenbewegung werden sollte, obwohl sich Louise Otto-Peters auch für Arbeiterinnen einsetzte. Publizistisches Organ des Frauenvereins waren die Neuen Bahnen. Hier wurden Bildung und Arbeit für Frauen sowie das Frauenwahlrecht gefordert. Der Verein schlug eine immer deutlichere nationale Orientierung ein und bekannte sich zum Dienst der Frau an Familie und Vaterland, eine Haltung, die sich insbesondere beim Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 dokumentierte. Kritisiert wurden die Positionen des Frauenvereins u.a. von Clara Zetkin. Louise Otto- Peters starb am 13.März.q
Zetkin, Clara: (1857-1933), deutsche Politikerin. Clara Zetkin wurde am 5. Juli 1857 in Wiederau bei Rochlitz geboren. Nachdem sie zunächst als Lehrerin tätig gewesen war, schloss sie sich 1878 der deutschen Sozialdemokratie an. Nach In-Kraft-Treten des Sozialistengesetzes in Deutschland ging sie ins Exil in die Schweiz. 1882 zog sie nach Paris, wo sie 1889 maßgeblichen Anteil an der Gründung der Zweiten Internationale hatte. Nach Aufhebung des Sozialistengesetzes kehrte sie nach Deutschland zurück, baute hier die sozialdemokratische Frauenbewegung auf und gab von 1891 bis 1917 die SPD- Frauenzeitung Die Gleichheit heraus; ab 1907 leitete sie das neu gegründete Frauensekretariat der SPD. Ab 1914, während des 1. Weltkrieges opponierte Clara Zetkin, u.a. zusammen mit ihrer Freundin und Mitstreiterin Rosa Luxemburg, vehement gegen die deutsche Kriegspolitik und gegen den Burgfriedens-Kurs der Mehrheit der deutschen Sozialdemokraten. Aufgrund ihrer kompromisslosen Haltung kam sie während des Krieges mehrmals in Haft. 1915 organisierte sie in Bern eine internationale sozialistische Anti-Kriegs-Frauenkonferenz, 1916 war sie an der Gründung des Spartakusbundes beteiligt und 1917 an der Gründung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD). 1919 trat sie der neu gegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) bei, die sie von 1920 bis 1933 als Abgeordnete im Reichstag vertrat. Von 1919 bis 1924 gehörte sie der Zentrale, von 1927 bis 1929 dem Zentralkomitee der KPD an. Von 1921 bis 1933 war Zetkin außerdem Mitglied des Exekutivkomitees der Komintern und ab 1925 Vorsitzende der Internationalen Roten Hilfe. In ihrer letzten Rede vor dem Reichstag, sie war dessen Alterspräsidentin, rief sie im August 1932 zum Kampf gegen den Nationalsozialismus auf. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 ging Clara Zetkin ins Exil in die Sowjetunion; sie starb wenig später, am 20. Juni 1933, und wurde an der Kremlmauer in Moskau beigesetzt.r
3. Zitate
a: aus "Informationen zur politischen Bildung" 245, S. 6
b: aus "Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland", S. 19- 20, Z. 35 - 1
c: aus "Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland", S. 24, Z. 16
d: aus http:ttwww.rd.shuttle.de
e: aus: Helene Lange, "Kampfzeiten", S. 161
f: aus "Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland", S. 32, Z. 2 - 3
g: aus " Von der französischen Revolution bis zum Nationalsozialismus", S. 238
h - k: aus Microsoft Encarta 2000 PLUS
I: aus "Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland", S. 21
m - r: aus Microsoft Encarta 2000 PLUS
4. Literaturverzeichnis
Jugendlexikon von A -Z, Isis Verlagsgesellschaft AG Churt Schweiz, 1991
Duden Band 1, Die deutsche Rechtschreibung, Dudenverlag, 22. Auflage, Mannheim 2000
Karl-Dieter Bünting/ Dorothea Ader, Fremdwörterlexikon, Isis Verlagsgesellschaft AG Churt Schweiz 1992
Microsoft Encarta Enzyklopädie PLUS 2001
Informationen zur politischen Bildung 254, Frauen in Deutschland - Auf dem Weg zur Gleichstellung 1997
Ute Gerhard, Unerhört - Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Rohwohl
Rosemarie Nave-Herz, Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland, Leske + Buderich, 4. Auflage, Opladen, 1994
sowie Auszüge aus:
Fenske (Herausgeber), Unter Wilhelm II. 1890 -1918,1982
F.G. Kürbisch und R. Klucsarits (Herausgeber), Arbeiterinnen kämpfen um ihr Recht. Autobiographische Texte zum Kampf rechtloser und entrechteter "Frauenpersonen" in Deutschland, Vaterreich und der Schweiz des 19. und 20. Jahrhunderts, Wuppertal 1991
Helene Lange, Kampfzeiten. Aufsätze und Reden aus vier Jahrzehnten, Band 1, Berlin 1928
Internet:
http://www.susas.detmag/frauenbtfrauenbewegung 04.htm
http://www.hausarbeiten.de/archivtgeschichtet gesch-emanzkaiser.shtl
http://www.rd.shuttle.de/kt 1007/hlange.htm
http://www.ruhr-uni-bochum.detn B-weibl.-bildun .html
http//www.bundestag.de/blickDkt/ arch bDk/frauen8.html
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Frauen und Mädchen im deutschen Kaiserreich"
Worum geht es in dieser Arbeit?
Die Arbeit gibt einen Einblick in das Alltagsleben von Frauen und Mädchen im deutschen Kaiserreich und beleuchtet die deutsche Frauenbewegung und deren Spaltung. Abschließend wird eine kurze Bewertung der Frauenbewegung von den Anfängen bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges vorgenommen.
Welche historischen Hintergründe sind für das Verständnis der Frauenbewegung wichtig?
Ein Einblick in den Vormärz und die Revolution von 1848/49 ist unerlässlich, um zu verstehen, wie es zur Ausbildung einer Frauenbewegung in Deutschland kam. Louise Otto-Peters forderte bereits 1843 die "Teilnahme der Frauen an den Interessen des Staates" und das Recht auf Selbstständigkeit durch Bildung und Arbeit.
Wie war der Alltag von Frauen und Mädchen im 19. Jahrhundert geprägt?
Frauen wurden im Wesentlichen in vier Gruppen aufgeteilt: Frauen der bürgerlichen Mittel- und Oberschicht ohne Recht auf Arbeit, Frauen in Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, Fabrikarbeiterinnen und Dienstmädchen. Sie lebten in einer von Männern dominierten Welt, in der die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen als unveränderlich angesehen wurde. Frauen hatten weder politische noch finanzielle Rechte und ihre Tugenden wurden auf Unschuld, Sanftmut und Bescheidenheit reduziert.
Welche Rolle spielte die Industrialisierung im Leben von Frauen?
Die Industrialisierung führte zu einer enormen Steigerung der Lebensansprüche und senkte gleichzeitig den Wert hauswirtschaftlicher Fähigkeiten. Arbeiterfrauen waren einer extremen Doppelbelastung ausgesetzt, da sie sowohl den Haushalt führen als auch arbeiten mussten. In bürgerlichen Familien herrschte eine patriarchalische Hausgemeinschaft vor, in der die Frau vom Mann abhängig war.
Was waren die Anfänge der organisierten Frauenbewegung?
Die organisierte Frauenbewegung begann mit der Ersten Frauenkonferenz Deutschlands 1865, auf der der Allgemeine Deutsche Frauenverein (ADF) gegründet wurde. Der Verein setzte sich für die Selbstständigkeit der Frauen, die Erwerbstätigkeit und Chancengleichheit bei Bildung und Arbeit ein.
Was waren die Hauptforderungen der bürgerlichen Frauenbewegung?
Die bürgerliche Frauenbewegung kämpfte vor allem für die Erwerbstätigkeit, Bildungschancen, Arbeiterinnenschutz, Mutterschutz, gleichen Lohn für gleiche Arbeit und das Frauenwahlrecht. Sie betonte die Bedeutung der Mutterschaft und forderte Realkurse und Gymnasialkurse für Frauen.
Wie unterschied sich die proletarische Frauenbewegung von der bürgerlichen?
Die proletarische Frauenbewegung richtete sich gegen die bestehende Gesellschaftsordnung und forderte deren Aufhebung, um die Bedingungen für alle Arbeiter zu verbessern. Sie war in die sozialistische Arbeiterbewegung eingebettet und kämpfte für eine klassenlose Gesellschaft. Clara Zetkin war eine ihrer wichtigsten Vertreterinnen.
Welche Rolle spielte August Bebel in der proletarischen Frauenbewegung?
August Bebel veröffentlichte das Werk "Die Frau und der Sozialismus", in dem er die Lösung der Frauenfrage nur in der Aufhebung der Klassengegensätze sah. Das Werk wurde jedoch durch das Sozialistengesetz verboten.
Was geschah mit der Frauenbewegung zu Beginn des Ersten Weltkrieges?
1914 gründete Gertrud Bäumer den nationalen Frauendienst, in dem Vertreterinnen der proletarischen und der bürgerlichen Frauenbewegung zusammenarbeiteten. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Nationalistinnen und Pazifistinnen. Die endgültige politische Gleichberechtigung wurde erst 1918 mit der Ausrufung der Republik erreicht.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gab es zwischen der proletarischen und der bürgerlichen Frauenbewegung?
Beide Bewegungen hatten Vorreiterinnen aus bürgerlichen Verhältnissen und setzten sich für eine Veränderung der Gesellschaft ein, um die Bedingungen für Frauen zu verbessern. Sie forderten politische Gleichberechtigung, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, bessere Arbeitsbedingungen, Mutterschutz und gleiche Bildungschancen. Die bürgerliche Frauenbewegung betonte das Recht auf Bildung und richtete sich nicht gegen das herrschende System, während die proletarische Frauenbewegung sich gegen das bestehende System richtete und eine klassenlose Gesellschaft forderte.
Welche Quellen und Literatur wurden für diese Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Lexika, Enzyklopädien, Informationen zur politischen Bildung, Bücher zur Geschichte der Frauenbewegung und Auszüge aus Werken von Fenske, Kürbisch und Klucsarits, sowie Helene Lange. Außerdem wurden Internetquellen genutzt.
- Arbeit zitieren
- Sarah Theermann (Autor:in), 2002, Frauen und Mädchen im deutschen Kaiserreich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106606