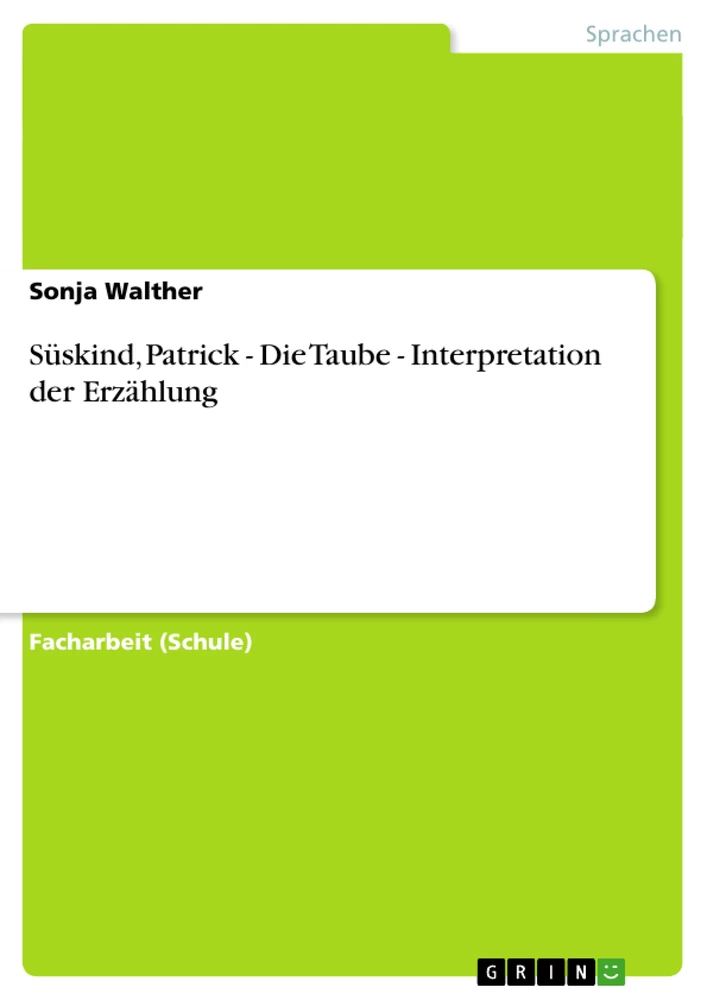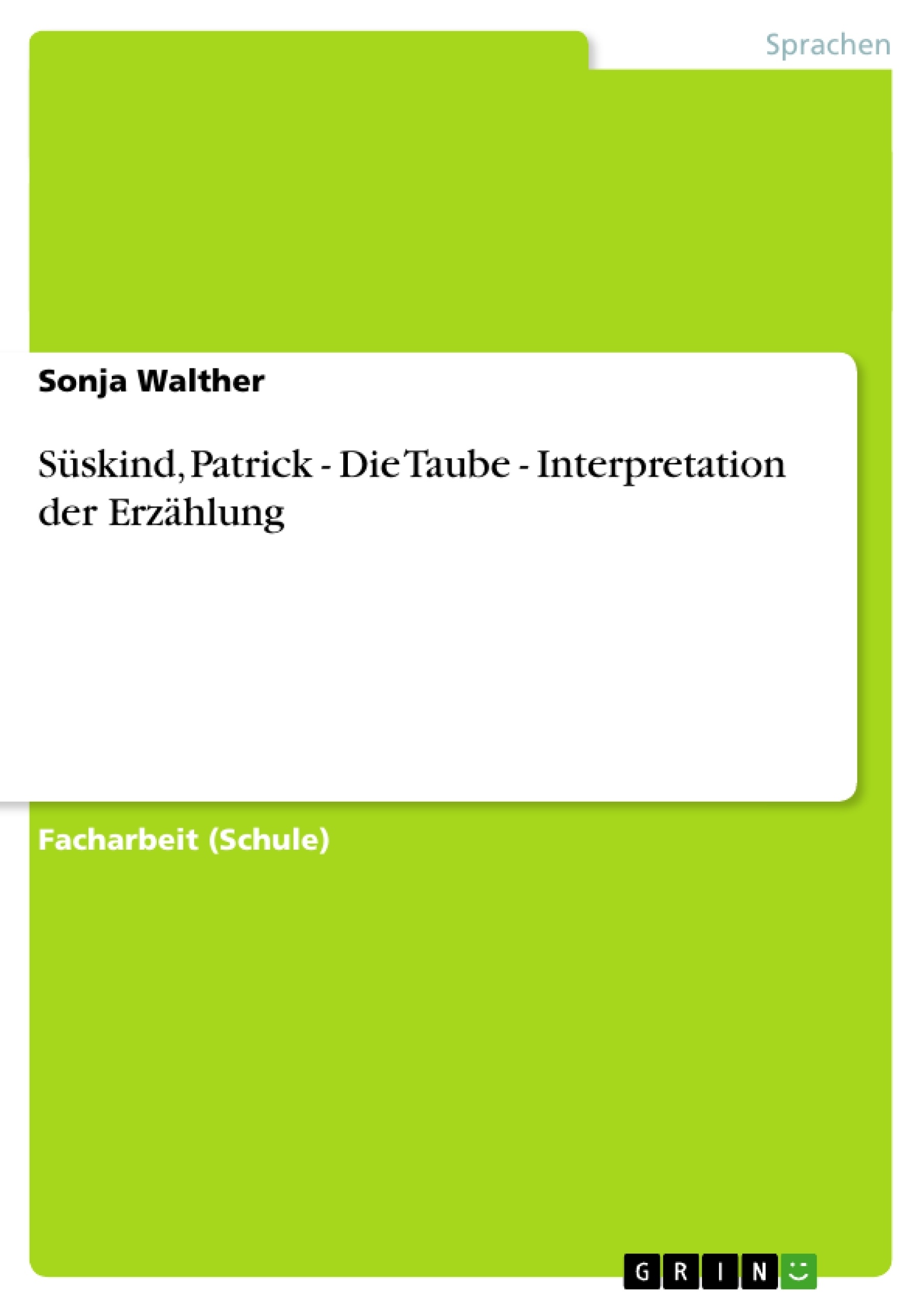Ein einziger Augenblick kann ein ganzes Leben verändern. In Patrick Süskinds meisterhafter Erzählung "Die Taube" wird Jonathan Noel, ein 53-jähriger Wachmann in Paris, mit einer scheinbar harmlosen Begegnung konfrontiert, die die Grundfesten seiner mühsam errichteten Welt ins Wanken bringt. Seit Jahrzehnten lebt Jonathan in einem Zustand selbstgewählter Isolation, getrieben von einer traumatischen Vergangenheit und dem unerschütterlichen Wunsch nach Ruhe und Anonymität. Seine Tage sind geprägt von Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Ordnung und Pflichterfüllung – einem Korsett aus Gewohnheiten, das ihn vor den Unwägbarkeiten des Lebens schützen soll. Doch als eine Taube ihn eines Morgens vor seiner winzigen Wohnungstür erwartet, bricht die Fassade der Normalität zusammen. Die unerwartete Präsenz des Vogels löst in Jonathan eine Kaskade von Ängsten, Erinnerungen und irrationalen Reaktionen aus, die ihn auf einen existenziellenTrip durch die Straßen von Paris katapultiert. Er flieht vor der Taube, verliert seinen Job, irrt umher, konfrontiert sich mit seiner Einsamkeit und sieht sich mit der Sinnlosigkeit seines bisherigen Lebens konfrontiert. Süskind entwirft ein beklemmendes Psychogramm eines Mannes, der sich in den Fängen seiner eigenen Verdrängungsmechanismen verliert. "Die Taube" ist eine fesselnde Studie über die menschliche Psyche, über Angst, Isolation und die verzweifelte Suche nach Sinn und Geborgenheit in einer zunehmend entfremdeten Welt. Tiefgründig und beunruhigend zugleich, wirft diese Novelle Fragen nach der Natur der Freiheit, der Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen und der Möglichkeit der Veränderung auf. Eine intensive Lektüre für alle, die sich für psychologische Spannung und die Abgründe der menschlichen Seele interessieren. Entdecken Sie eine Geschichte über Verdrängung, Einsamkeit und die Möglichkeit eines Neuanfangs. Ein Muss für Liebhaber moderner Klassiker und Leser, die nachdenkliche Unterhaltung suchen. Eine Parabel über die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz und die Kraft der inneren Auseinandersetzung. Süskinds präzise Sprache und die eindringliche Schilderung der Gefühlswelt Jonathan Noels machen "Die Taube" zu einem unvergesslichen Leseerlebnis über Angstbewältigung, Vergangenheitsbewältigung und die Suche nach dem inneren Frieden. Eine Geschichte, die noch lange nach dem Zuklappen des Buches nachhallt.
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Interpretationshypothese
2. Textuntersuchungen:
2.1 Die belastete Vergangenheit bis 1954 und die „ereignislose“ Zeit bis 1984
2.2 Der Verdrängungsprozeßund seine Entwicklung
2.2.1 Pünktlichkeit
2.2.2 Sparsamkeit
2.2.3 Ordnung
2.2.4 Pflichterfüllung
2.2.5 Ansehen
2.2.6 Die Bedeutung der Taube
2.3 Die Monotonie
2.4 Die Anonymität
2.5 Der Wandel Jonathans zu mehr Kontaktbereitschaft
3. Zusammenfassung
0. Einleitung
Die Erzählung „Die Taube“ von Patrick Süskind, erschienen 1987, handelt von einem Freitag im August 1984, der die Lebenseinstellung des 53-jährigen französischen Juden Jonathan Noels schlagartig verändert.
Der Autor wählt die personale Erzählsituation. Nur an manchen Stellen, so wie z.B. im 1.Kapitel , setzt er einen auktorialen Erzähler ein. Die Erzählung ist nach Tageszeiten gegliedert. Sie dreht sich ausschließlich um Jonathan Noel. In den einzelnen Passagen werden die Ereignisse, die ihm widerfahren und seine Reaktionen auf diese, dargestellt.
Kapitel 1 widmet sich der Vergangenheit Jonathans bis 1954 und stellt vor, wie er zu seiner heutigen Lebensphilosophie gelangte und in welchen Verhältnissen er zur erzählten Zeit lebt. Der 2. Teil startet sofort mit dem ersten unvorhersehbaren Erlebnis an jenem Freitag Morgen im August 1984. Dort begegnet er der Taube. Er endet, als er die Wohnung verläßt. Passage 3 behandelt Jonathans Weg zur Arbeit und das Gespräch zwischen ihm und Mme Rocard, einer Concierge. Im 4. Kapitel befindet er sich auf seinem Arbeitsplatz und verpaßt zum ersten Mal in seiner 30-jährigen Dienstkarriere, der Limousine seines Chefs, dem Bankdirektor M.
Roedel, das Tor zu öffnen. Es spielt also in der Zeit von 8:15 Uhr bis 13:00 Uhr.
Im 5. Abschnitt folgt die Schilderung der Mittagspause zwischen 13:00 und 14:30 Uhr.
Jonathan Noel reißt sich seine Diensthose beim Essen im Park ein und sucht eine Schneiderin auf. Der 6. Teil zeigt die Zeit nach der Mittagspause von 14:30 Uhr bis Dienstschlußum 17:30 Uhr. Hier ereignet sich nichts mehr Außergewöhnliches, sondern der Selbsthaßund der Haßauf die äußere Welt Jonathans werden aufgezeigt. In der 7. Passage wandelt er nach Dienstende bis ca. 21:00 Uhr orientierungslos und träumerisch in den Straßen von Paris, bis er hungrig wird und sein Hotel aufsucht. Das 8. Kapitel handelt von der Zeit vor dem Schlafen- gehen. Jonathan ißt, räumt auf und legt sich mit dem Gedanken, daßer sich morgen umbringe, schlafen. Im 9. Teil erwacht er in der Nacht bei einem Gewitter und sucht nach einem Anhaltspunkt, der ihn aufkläre, wo er sei. Nach der Einsicht, daßer ohne die Menschen nicht leben kann, begibt er sich im letzten Erzählabschnitt zurück nach Hause. Der Weg durch Paris wird nochmals, jedoch fröhlicher und harmonischer als im 7. Kapitel, erzählt. Als er in der „Rue de la Planche“ in seine „chambre de bonne“ gelangt, ist es 6:00 Uhr früh und jener Tag im August 1984 ist beendet.
1: Interpretationshypothese
Die Erzählung zeigt einen Menschen, der aufgrund einer belasteten Vergangenheit einen lebenslangen Verdrängungsprozeßlöst und so einen Weg aus der Anonymität und Monotonie seines Lebens zu mehr Kontaktbereitschaft findet.
2. Textuntersuchungen:
2.1 Die belastete Vergangenheit bis 1954 und die „ereignislose“ Zeit bis 1984
Die Zeit von Jonathans Geburt bis zum Umzug nach Paris 1954 wird im 1. Kapitel durch den auktiorialen Erzähler dargestellt. Hier erfährt der Leser den Grund für das Zustandekommen des Verdrängungsprozesses und Jonathans heutige Lebensverhältnisse.
Jonathan Noel ist in Chareton aufgewachsen, von wo seine Eltern im Juli 1942 in ein Konzentrationslager gebracht wurden. Zusammen mit seiner Schwester wuchs er von nun an bei seinem Onkel auf, der die Kinder bis nach Kriegsende vor den Nationalsozialisten versteckt hielt. Es folgten für Jonathan Jahre der harten Feldarbeit. Anfang der 50iger Jahre mußte er für drei Jahre zum Militär. Dort lernt er Gehorsam und Pflichterfüllung. Außerdem ging er nach Indochina, wo er die Brutalität des Krieges zu spüren bekam. Als er 1954 zu seinem Onkel zurückkehrte, war seine Schwester nach Kanada emigriert . Auf Drängen seines Onkels heiratete er Marie Baccouche. In diese Ehe hoffte er endlich Ruhe und Ereignislosigkeit zu finden, doch nach der Geburt seines Sohnes verließihn Marie. Für ihn stand nun endgültig fest, „daßauf die Menschen kein Verlaßsei und daßman nur in Frieden leben könne, wenn man sie sich vom Leibe hielt“ (S. 7 unten).
Bislang hatte er nur getan, was andere von ihm verlangten und erlitt ständige Enttäuschungen: Er verlor eine Familie, hatte eine Kindheit, in der Zeit zum Spielen fehlte, fand auch keinerlei Freundschaften beim Militär und auch seine Ehe verlief nicht nach seinen Vorstellungen.
Zum ersten Mal in seinem Leben traf er eine selbständige Entscheidung: Er zog nach Paris, nahm sich eine „chambre de bonne“, die ihm zwar keinen Komfort, dafür aber Sicherheit vor den Menschheit bot und fand schließlich eine Anstellung als Wachmann bei einer Bank.
Die Jahre seit 1954 in Paris werden zunächst durch den auktorialen Erzähler als ereignislose Zeit in völliger Anonymität beschrieben. Die wenigen Vorkommnisse erfährt der Leser durch die Erinnerungen Jonathan Noels, die meistens dann auftreten, wenn etwas Unvorhersehbares passiert. Diese Rückblicke schildert ein personaler Erzähler. Diese Erzählsituation hat den Vorteil, daßder Leser die Handlung durch die Perspektive der Hauptperson miterlebt. Der Leser sieht und erfährt nur das, was Jonathan in sich aufnimmt, so daßseine Gedanken, Überlegungen und eben auch Erinnerungen deutlicher werden. Ihm wird allerdings auch nur das vor Augen geführt, an das Jonathan sich erinnert. Diese Erzähllücken, die durch dieses Verfahren entstehen, heißen Leerstellen, welche der Leser individuell nach seinen Vorstellungen auffüllt.
Die Erinnerungen Jonathans sind aufgrund ihrer geringen Anzahl weder verblaßt noch ungenau. Meist kann er sich präzise die Jahreszahlen der Vorkommnisse und deren genauen Hergang ins Gedächtnis rufen. Zum ersten Mal erinnert er sich im 1. Kapitel bei seinem morgendlichen Gang zur Toilette, welche sich auf dem Flur befindet, an den einzigen Zusammenstoßmit einem anderen Mieter im Sommer 1959: „Dies gleichartige Erschrecken vor dem Anblick des anderen, der gleichzeitige Verlust von Anonymität bei einem Vorhaben, das durchaus Anonymität erheischte, das gleichzeitige Zurückweichen und wieder Vorangehen, die gleichzeitig hervorgehaspelten Höflichkeiten, bitte nach Ihnen, o nein, nach Ihnen, Monsieur, ...“ (S.13) lassen ihn von da an prophylaktisch an der Türe horchen, um sicherzustellen, daßsich keiner auf dem Hausflur befindet. Die Empörung über dieses Zusammentreffen belegt auch die Struktur des Satzes. Er kann gar nicht mehr aufhören, sich über die damalige „Überraschung“ zu mokieren.
Aus Erinnerungsbruchstücken eines Gebetes ist es ihm dann auch möglich, nach der Begegnung mit der Taube zu beten. Allerdings kann kaum von einem logischem Zusammenhang des Gebetes die Rede sein, sondern von einem „Gestammel“, das auf eine verkümmerte religiöse Erziehung hinweist (S.19). Um sich Mut zu machen und sich nochmals vor die Türe zu der Taube zu wagen, läßt er die Zeit des Krieges in Indochina Revue passieren. Als er den Koffer für seinen Aufenthalt in einer Pension packt, wird ihm bewußt, daßes noch der selbe Pappkoffer ist, mit dem er 1942 von Chareton nach Cavaillon und 1954 von dort nach Paris reiste. Im 2. Kapitel verweist er die Concierge darauf, dass das Gangfenster immer geschlossen bleiben mußund erklärt ihr, daßes im Sommer 1962 einmal zerbrochen ist, da es bei einem Gewitter offenstand. „Es hat damals hundertfünfzig Franc gekostet, die Scheibe zu ersetzen“(S.35), weißer noch genau. An seinem Arbeitsplatz bemerkt er, daßer aufgrund der Hitze nichts mehr deutlich fixieren kann. Dabei ruft er sich ins Gedächtnis, daßer als Kind einmal eine Brille tragen mußte. Sogar die Brillenstärke:„0.75 Dioptrien minus, links und rechts“(S.47) ist ihm noch in Erinnerung. Bei der Mittagspause im Park bemerkt er den Clochard, auf den er vor dreißig Jahren neidisch war, „..., Neid auf die unbekümmerte Art, mit der dieser Mensch sein Leben führte“(S.50). „Aber dann, einmal, Mitte der sechziger Jahre im Herbst, als Jonathan zum Postamt in die Rue Dupin ging und vor dem Eingang fast über eine Weinflasche gestolpert wäre, „...,da sah er ihn auf der gegenüberliegenden Straßenseite zwischen zwei geparkten Wagen sitzen und sah, wie er seine Notdurft verrichtete...“ (S.51).Aus dem Neid auf die Freiheit des Clochard ist Mitleid und Bedauern geworden, da dieser seine Notdurft nicht hinter Schloßund Riegel verbringen kann. Ohne diesen „sicheren Hort“(S.54) hat das Leben für Jonathan keinen Sinn, so daßer seit diesem Tag nie mehr an dem Nutzen seiner Arbeit zweifelte. Bei dem Wunsch in Kapitel 6 vor der Bank zusammenzubrechen, denkt er an seine Kindheit zurück: “Er konnte weinen, wann immer er wollte; er konnte den Atem anhalten, bis er ohnmächtig wurde, oder sein Herz einen Schlag aussetzen lassen“(S.79). Wahrscheinlich war es damals der einzige Weg, um dem Willen der Erwachsen zu entgehen. Damals konnte er sich so helfen. Die Tatsache, daßer seit dreißig Jahren allen Unannehmlichkeiten aus dem Weg geht, läßt ihn heute in Konfliktsituationen hilflos wirken. Die wohl wichtigste Erinnerung hat Jonathan im 9.
Kapitel. Diese ist nicht wie die vorangegangen klar und deutlich. Sie ist eine Mischung aus Unterbewußtsein, Traum und wirklich erlebter Vergangenheit. Sie zeigt eindeutig, daßer seine belastete Vergangenheit noch nicht verarbeitet, sondern für dreißig Jahre verdrängt hat. Er erwacht bei Nacht in dem fremden Hotelzimmer. Da er sich nicht orientieren kann, bildet er sich ein, daßer ein Kind sei. Es sei Krieg und er im Keller des Hauses seiner Eltern eingesperrt. Er fühlt sich einsam und verlassen. Er erträgt die Stille nicht mehr und will gerettet werden. Während er nach den anderen Menschen sucht, sieht er ein: „Ich kann doch ohne die anderen Menschen nicht leben !“
Außerdem erinnert sich Jonathan nicht nur an Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen, sondern ist auch in der Lage, sich die Inhalte der achtzehn Bücher, die er bisher gelesen hat, genau ins Gedächtnis zu rufen. So führt er sich die Dienstordnung in Kapitel 1 (S.17) vor Augen, erinnert sich an das Buch über tropische Tierwelt in Zusammenhang mit der Taube (S.27), im 3. Teil ist er in der Lage Mme Rocard die Hausordnung zu zitieren (S.35), vergleicht in der 4. Passage seine Ruhe mit der der Sphinx (S.42), über die er in dem Buch über das alte Ägypten gelesen hat, erinnert sich im gleichen Kapitel aufgrund einer plötzlichen Sehschwäche und in Abschnitt 5, als ihm das Adrenalin ins Blut schießt (S.63) an sein medizinisches Taschenlexikon. Auch seine Annahme in Kapitel 7: „Gehen beschwichtigt. Im Gehen liegt eine heilsame Kraft“ (S.82) scheint er aus dem medizinischen Taschenlexikon übernommen zu haben. Die Tatsache, daßJonathan Inhalte von Büchern jeder Zeit abrufen kann, verweisen ebenfalls auf sein gutes Langzeitgedächtnis.
2.2 Der Verdrängungsprozeßund seine Entwicklung
Jonathan Noel richtet sein Leben nach einem genauen Muster ein. Für dieses Planen gibt es zwei Ursachen: Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit eines unvorhersehbaren Ereignisses viel geringer als bei einem ungeplanten Alltag, und zum anderen fällt man in der Gesellschaft weniger auf. Auf diese Weise hofft er endlich monotone Ruhe und Anonymität zu finden. Er setzt sich Maßstäbe für sein Leben wie Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Ordnung und Pflichter- füllung. Aus diesen Prinzipien ergibt sich im folgenden eine Skizzierung seines Lebensinhaltes, der seinen Ekel und seine Abscheu gegenüber der Taube erklärt.
2.2.1 Pünktlichkeit
Pünktlichkeit und die Einhaltung eines selbstgesetzten Zeitplans haben für Jonathan eine große Bedeutung. Nachdem ihm die „Sache mit der Taube“ (S.5) widerfährt und er mit seinem normalen Tagesablauf in Zeitverzug gerät, bemerkt er, daßer normalerweise um 7:15 Uhr bereits gefrühstückt und sein Bett gemacht hätte (S.21). Um sich nicht zu verspäten beschließt er, nicht zu frühstücken. Die Tatsache, daßdie Dreiviertelstunde bis Dienstbeginn vom personalen Erzähler als „Galgenfrist“ betitelt wird, verdeutlicht den hohen Stellenwert von Pünktlichkeit für den Wachmann. Anfangs des 4. Kapitels wird dann nochmals betont, daßer „pünktlich“ (S.38) um 18:15 Uhr vor der Bank steht. In der fünften Passage der Erzählung bricht er eine halbe Stunde vor Mittagspausenende zur Bank auf. Diesmal allerdings nicht , um nicht aufzufallen, sondern weil er einfach weg will aus dem Park: “Er hatte genug.“ (S.60). Im Zusammenhang mit der Schneiderin schaut er auf die Uhr: „14:14 Uhr“ (S.68) und wirkt nervös unter dem Druck der Zeit. „‚Ich bin nämlich in Eile, ich habe nur noch‘ - und er sah wieder auf die Uhr - ‚ habe nur noch zehn Minuten Zeit - können Sie es sofort machen? Ich meine jetzt gleich? Unverzüglich?‘“ Für ihn ist der Gedanke des Zuspätkommens unerträglich.
Allerdings ändert sich seine Einstellung am Ende der Erzählung. Er wandelt durch Paris. Es ist ihm unwichtig wie spät es ist. „Es mochte nun gegen neun Uhr sein, aber noch immer war es taghell“ (S.84). Bisher schaute er immer auf seine Uhr: „14:.14 Uhr“ (S.68) waren für ihn Zeitangaben oder „8:15 Uhr“ (S.38). Aber der Ausdruck „es mochte sein“ verweist keinesfalls auf einen zeitbewußten Menschen, sondern auf die Gleichgültigkeit, mit der Jonathan der Zeit nun gegenüberstand.
2.2.2 Sparsamkeit
Jonathan Noel war in seinem bisherigen Leben niemals verschwenderisch gewesen. Seine kleine Wohnung hatte er nur mit dem nötigsten eingerichtet. So war es ihm möglich Reserven zu schaffen. Als er in Kapitel 1 beschließt, seine Wohnung wegen der Taube zu räumen und in eine Pension zu ziehen, führt er sich sein Hab und Gut genau vor Augen. Es stellt fest, daßer „bei größter Sparsamkeit, bis Jahresende im Hotel wohnen und trotzdem die achttausend Franc an Madame Lassalle bezahlen“ (S.23) kann. Er bildet sich also ein, mit seinen 3700 Franc, die er im Monat netto verdient, Hotelkosten, Miete, Lebensunterhaltungskosten und die monatliche Rate für den Kauf seiner Wohnung decken zu können. Dieses Vorhaben erfordert große Sparsamkeit, wenn es nicht gar unmöglich ist. Jonathans Plan, die Finanzierung des Wohnungskaufes weiterhin zu leisten, obwohl er diese nicht mehr bewohnen will, zeigt, daßer keinesfalls auffallen möchte; schon gar nicht aufgrund einer unbezahlten Rechnung.
Seine Sparsamkeit steigert sich folglich im Verlauf der Erzählung. In der 5.Passage macht er sich auf die Suche nach einem Hotelzimmer. Er steuert auf eines zu, in welchem fast nur Gastarbeiter und Studenten kampieren, was wohl Aufschlußüber die geringen Wohnqualität bietet; aber Jonathan ist ja noch nie luxusorientiert gewesen. Die Tatsache, daßer das billigste Zimmer für 55 Franc unbesehen annimmt (S.49), verdeutlicht allerdings wie wichtig ihm es ist, der Taube zu entgehen und dennoch seine anfallenden Rechnungen begleichen zu können. In der Mittagspause kauft er sich eine Tüte Milch und zwei Rosinenschnecken. Eigentlich mag er gar nichts Süßes. „Aber er hatte heute schon fünfundfünfzig Franc für das Hotelzimmer ausgegeben, da wäre es ihm wie Verschwendung vorgekommen, in ein Café zu gehen und dort Omelett, Salat und Bier zu bestellen“ (S.56). Er ißt etwas, was ihm normalerweise nicht schmeckt, nur um der Taube aus dem Weg zu gehen. Dies verweist wiederum auf die große Abscheu Jonathans, die er für die Taube empfindet.
Besonders deutlich wird seine Einstellung und Beziehung zu Geld in Kapitel 5 und 6. Während er „seinen Unterhalt sauer verdiente“ (S:50), gibt es Menschen wie den Clochard, die auf das Mitleid anderer spekulieren. Natürlich hätte Jonathan gerne etwas mehr Geld für sich ausgegeben. Dieses äußert sich ja bereits in dem versteckten Wunsch nach Omelett, Salat und Bier. In Kapitel 6 allerdings wird der Neid auf all diejenigen, die sich mehr für ihr eigenes Wohlbefinden leisten, sehr offensichtlich. Er zerfließt im Haßauf die äußere Welt und somit auch in Selbstmitleid. Er beschimpft das „dämlichen Touristenpack, das da mit Sommerbluse und Strohhüten und Sonnenbrillen bekleidet herumflätze und überteuerte Erfrischungsgetränke“(S.75/76) säuft und beschwert sich über die „astronomische(n) Preise: fünf Franc für einen Espresso, elf Francs für ein kleines Bier, und dazu noch fünfzehn Prozent Aufschlag für die affige Bedienung plus Extratrinkgeld; ...“. Diese Aussagen zeigen klar, wie gern er selbst großzügiger leben würde. Doch mit dem Entschluß, in ein Hotel zu ziehen, hat er sich zur Sparsamkeit gezwungen. Im 9. Kapitel erscheint ihm diese Sparsamkeit, genauso wie zuvor die genaue Zeitplanung, unwichtig. Er wäre in ein Restaurant gegangen, in dem ein Menü inklusive Bedienung 50 Franc kostet, doch er ist verschwitzt, stinkend und seine Hose zerrissen (S.85). Der Preis des Menüs ist nicht die Ursache dafür, daßer das Restaurant nicht aufsucht.
2.2.3 Ordnung
Die Ordnung Jonathans erklärt sich vor allem durch seine Abneigung, wie bereits beschrieben, auf Unvorhergesehen zu stoßen. Der Gedanke, irgend etwas nicht am gewohnte Platz zu finden, hätte bei ihm eine größere Depression hervorgerufen. So ist er z.B. gewohnt, jeden morgen sein Bett zu machen und tut dies auch an jenem Tag im August 1984, obwohl er bereits in Zeitverzug ist; statt dessen verzichtet er lieber auf sein Frühstück (S21). Sein Vergehen, in sein Waschbecken zu urinieren, berührt ihn so, daßer sogar weinen muß. Er empfindet diese Tat als „Sakrileg“ und schämt sich vor sich selbst (S.20). Eine gründliche Reinigung anschließend, ist ihm selbstverständlich. Diese Handlungen und seine emotionalen Reaktionen darauf belegen eindeutig den gesteigert Ordnungssinns des Wachmanns. Der Gipfel seiner Ordnung zeigt sich allerdings im 5. Teil der Erzählung, als er bereits auf dem Weg zurück zum Arbeitsplatz bemerkt, daßer seine leere Milchtüte auf der Bank stehen gelassen hatte. Ohne lange zu überlegen, macht er kehrt, um die Milchtüte ordnungsgemäßin den Papierkorb zu werfen. Er haßt nämlich die Leute, die ihren „Unrat“ aus der Straße liegenlassen (S.60). Außerdem will er gerade an einem Tag , an dem schon so viel Schreckliches vorgefallen ist, in den kleinen Dingen nicht nachlässig sein (S.61). Glücklich darüber, daßseine Unordnung noch keinem aufgefallen ist, ist er im Begriff die Milchtüte in den Abfalleimer zu befördern, als seine Hose reißt.
Sein Ordnungssinn, der ihn eigentlich vor Ungeplantem bewahren sollte, und sein Bedürfnis, nicht aufzufallen, bringen ihn ironischerweise genau in eine solch prekäre Situation. Zwar bemerkt direkt im Park keiner seinen Unfall, doch der Tesafilm, den er später über den Rißklebt, wird wohl kaum zu übersehen sein. Jedenfalls ist ihm ein Mißgeschick unterlaufen, dem er eigentlich aus dem Weg gehen wollte.
Der Wandel dieses Ordnungsgefühls ist genauso deutlich wie der des Zeitbewußtseins und der Geldbezogenheit. So sitzt er im 8.Kapitel in Unterhemd und Unterhose und ißt (S.86). Für jeden anderen wäre dies nichts besonders, doch für einen Menschen, der auf halbem Wege nochmals zu einem Park zurückkehrt wegen einer stehengelassenen Milchtüte, scheint dies ungewöhnlich zu sein. Dennoch räumt er alles auf, bevor er sich schlafen legt. In Anbetracht der Tatsache, daßer mit dem Vorhaben, sich umzubringen einschläft, wirkt dieses Aufräumen auch sehr widersprüchlich in sich selbst, aber passend zur Persönlichkeit Jonathans.
2.2.4 Pflichterfüllung
Pflichterfüllung ist für Jonathan Noel oberstes Gebot. Er kennt z.B. seine Dienstordnung in- und auswendig (S.17). Auch würde er sich in Kapitel 4 gerne kratzen, „aber das ginge ja beileibe nicht, daßein Wachmann sich öffentlich kratze!“ (S.44). Als er die Limousine seines Chefs verpaßt, gehen ihm viele Gedanken durch den Kopf, unter anderem auch, daßer seine Pflicht grob vernachlässigt habe (S.48). Und zum ersten Mal in seiner dreißigjährigen Dienst- karriere lehnt er sich an und schließt kurz die Augen. Die Scham über seine körperliche Schwäche zeigt, wie wichtig er seine Arbeit als Wachmann nimmt. Seine körperliche Schwäche interessiert ihn gar nicht, er fühlt sich wie eine „Karikatur eines Wachmanns" (S.72) und verachtet sich daher selbst. Seine Arbeit hat für ihn also einen höheren Stellenwert als er selbst. Später ändert sich allerdings auch diese Einstellung, als ihm alles egal wird und er einfach nur noch zusammenbrechen will (S.79).
2.2.5 Ansehen
Über die bisher erwähnte Tugenden hinaus gibt es weitere Textstellen, die zeigen, wie wichtig Jonathan sein öffentliches Ansehen ist. Zurückzuführen ist dies auf seine Vergangenheit, in der er, als ihn seine Ehefrau verlassen hatte, zum Gespött der Leute wurde (S.8). Belegt wird diese Angst, nochmals Ziel öffentlichen Geredes zu werden bereits in Kapitel 1 (S.18) bei seinen Überlegungen über die Folgen seiner Flucht vor der Taube. Auch die Befürchtung, jemand könne ihn in Winterkleidung sehen, treibt ihm den Schweißauf die Stirn (S.25/29).
Das Gespräch mit Mme Rocard kommt auch nur dadurch zustande, daßJonathan sich durch ihre Blicke ertappt fühlt (S.30/32). Die Empörung über den Clochard und dessen freizügige Lebensweise in Passage 5 verweist ebenfalls auf das hohe Bedürfnis Jonathans, nicht aufzufallen (S.51). Die erste Reaktion auf sein Mißgeschick im Park ist ein Umschauen, ob durch das „Ratsch“ (S.62) nicht etwa die Aufmerksamkeit aller Parkbesucher auf ihm gerichtet sei.
2.2.6 Die Bedeutung der Taube
Zusammengefaßt wird die Persönlichkeit Jonathan Noels in Kapitel 5: „...-, während er, der doch sein Leben lang ein braver, ordentlicher Mensch gewesen, anspruchslos, asketisch fast und sauber und immer pünktlich und gehorsam, zuverlässig, wohlanständig ... und jeden Sou, den er besaß, auch selbst verdient, und alles immer bar bezahlt, die Stromrechnung, die Miete, das Weihnachtsgeld für die Concierge ... und niemals Schulden gemacht, nicht einmal krank gewesen ... nie irgend jemand irgendwas zuleid getan, nie, nie etwas anderes gewollt im Leben, als nur sich seinen eigenen, bescheiden kleinen Seelenfrieden zu erhalten und zu sichern ...“ (S,58). Dieser Lebensinhalt mit seinen Tugenden erklärt die Abscheu Jonathans gegenüber der Taube.
Die Taube ist das Symbol der Freiheit. Es gibt sie zu Tausenden in den Städten Europas. Von allen wird sie geliebt und gefüttert. Und er, Jonathan, mußsich mit solchen Tugenden herumplagen, um sein Lebensziel zu erreichen: Anonymität und Monotonie. Die Taube hat alle Eigenschaften, die er verabscheut: Sie schwirrt unberechenbar herum, er plant sein Leben. Sie macht Schmutz und verteilt Bakterien, er liebt die Ordnung und Sauberkeit. Sie vermehrt sich rasend, er ist enthaltsam und von seinem einzigen Nachkommen hat er seit dessen Geburt nichts mehr gehört. Während er sein Leben nach einem festen Plan ordnet, ist sie für ihn der Inbegriff von „Chaos und Anarchie“ (S18). Mit einem solchen Geschöpf kann er einfach nicht unter einem Dach leben.
2.3 Die Monotonie
Die Monotonie im Leben Jonathan Noels wird hauptsächlich dadurch belegt, daßer mit plötzlichen Ereignissen nicht umzugehen weiß. Seine Reaktionen auf diese Geschehnisse sind übertrieben und unüberlegt. Seine Gedanken „überschlagen“ sich förmlich. Als Reaktion auf die Taube denkt er z.B., „daßer einen Herzinfarkt erleiden werde oder einen Schlaganfall oder mindestens einen Kreislaufkollaps, ...“. Er fällt immer ins Extrem, befürchtet das Schlimmste. Außerdem erinnert er sich an Inhalte von Büchern oder an Situationen in seiner Vergangenheit wie in 2.1. beschrieben. Durch geringe Vorfälle fühlt er sogleich seine ganze Existenz bedroht. Besonders deutlich wird dies in Kapitel 5, als er die bisherigen Geschehnisse mit Blick auf den Clochard Revue passieren läßt: Er hat die Limousine M.
Rodels verpaßt, wird dann arbeitslos, ist bereits aufgrund der Taube wohnungslos, wird zum Alkoholiker, erkrankt, verarmt und wird dann, wie der Clochard auf der Parkbank, obdachlos (S.58/59). Das Gedankenchaos Jonathans wird auch durch die Satzstruktur deutlich. Die Aneinanderreihung der vielen Hauptsätze versinnbildlicht seine Gedankengänge. Außerdem findet der Leser die erzählte Zeit als Maßstab für Jonathans Gemütszustand. Immer, wenn seine Gedanken durcheinander sind, wird jede Minute beschrieben, wie z.B. als er sich seine gerissene Hose von Mme Topell nähen lassen will. Diese Raffung der erzählten Zeit verweist wiederum auf das penible Zeitverständnis Jonathans. Nach Dienstende, als er in den Straßen von Paris herumirrt, fassen zwei Seiten drei Stunden erzählte Zeit zusammen, was verdeutlicht, daßer seine Prinzipien, wie hier die Zeitplanung, aufgegeben hat. Fortwährende Reaktionen auf solche Veränderungen sind immer Angst, Scham und Verzweiflung, wie z.B. in Kapitel 1: Er uriniert ins Waschbecken und schämt sich dann so, daßer weint (S.20), danach bedrückt ihn seine Verzweiflung so, daßihm wieder die Tränen in die Augen steigen (S,24). Besonders großist seine Angst in Kapitel 5, als er sich die oben genannten Folgen seiner Unaufmerksamkeit im Dienst vorstellt (S.58/59). Für diese Gefühle der Angst, Scham und Verzweiflung gibt es weitere Textbelege (S.37, 48, 49). In Kapitel 4 wird die normale „sphinxische Gelassenheit“ Jonathans in seiner Tätigkeit als Wachmann beschrieben (S.42). Doch an jenem Tag ist seine innerliche Ruhe keinesfalls mit der der Sphinx zu vergleichen. Diese innerliche Unruhe ist auch eine Folge der bisherigen Aufregungen des Tages: Er schwitzt, hat Gleichgewichtsstörungen, ein starker Juckreiz quält ihn und er sieht alles verschwommen.
Nachdem ihm in Kapitel 5 die Hose gerissen ist und er sie auch nur mit Tesafilm notdürftig geklebt hat, erkennt er sich selbst nicht mehr. Er hat das Gefühl, „als stünde er weit weg und außerhalb und betrachte die Welt wie durch ein umgekehrtes Fernglas“ (S.71). Er verliert den Bezug zur äußeren Welt und fühlt sich als Außenseiter. Was mit Gefühlen der Angst, Scham, Verzweiflung und Hilflosigkeit beginnt, kehrt sich in Kapitel 6 in Wut und schließlich Haßum. Zunächst haßt er sich selbst, dann alles und jeden. Wieder wirkt er körperlich geschwächt (S.72): Doch er will sich nicht selbst bemitleiden. Er ist wütend, er will leiden, um sich selbst für diese Schwäche zu bestrafen: „Nichts wollte er tun, um sein Elend zu mildern“ (S.73). Er sieht die Welt durch andere Augen, er will alles hassen. Er ist so mit Haßgeladen, daßdie Augen nur noch als Mittel dienen, alles aufgenommene schlechtzumachen (S.74). Dieses gestörte Weltbild führt also zum Haß, der im Grunde nichts anderes ist als Neid und Selbstmitleid. Am liebsten würde er alles um sich herum zerstören, doch er ist kein Amokläufer, sondern ein „Dulder“ (S.78).
Schließlich ist ihm alles egal. „Er konnte nur noch dastehen und hinnehmen, was ihm widerfuhr“ (S.79). Er wirkt bei allen darauffolgenden Vorgängen passiv. „Er tat dies alles ganz automatenhaft ... “, „Und während er mechanisch die drei Stufen erklomm, ... “ (S.80) zeigen, daßJonathan sein Ichbewußtsein verloren hat. Er hat sich aufgegeben. Er kämpft nicht mehr gegen seine Empfindungen. Er ist nur noch eine „Marionettenmaschine“ mit „einer Art gebrochenen Blick“ (S.81). Er fühlt sich, als sei sein Körper nur noch eine Hülle und er säße als kleiner Zwerg hinter den Augen und betrachte die Welt; unfähig eigenständig zu handeln. Er mußerst einmal abschalten, so daßder zwiefache Jonathan, sein Bewußtsein und seine Körperhülle, wieder eine Einheit wird (S.83).
Als Konsequenz aus allen Vorkommnissen bleibt für Jonathan nur der Selbstmord, dessen Absicht vorher öfter angedeutet wird; z.B. durch das Bedürfnis zu leiden (S.73) oder das Bewußtsein zu verlieren und zusammenzubrechen (S.79).
2.4 Die Anonymität
Die Anonymität Jonathan Noels zeigt sich vor allem in seinem Verhalten zu anderen Menschen, wie z.B. zu Mme Rocard, der Concierge oder zu Mme Topell, der Schneiderin. In Kapitel 3 zeigt sich das Verhältnis Jonathans zu Mme Rocard: er hat keines. Seit dreißig Jahren wohnt er nun in seiner „chambre de bonne“ und hat mit der Concierge noch nie mehr geredet als „Guten Tag“ (S.30 ff). Sie ist die Person, durch die er seine Integrität und Anonymität am meisten gefährdet sieht. Sie schenkt ihm zweimal täglich ihre „ungenierte Aufmerksamkeit“ und hat dadurch Kenntnis über seinen Lebenswandel, wie z.B. seiner Kleidung, wie oft er sie wechselt oder was er sich zum Abendbrot mitbringt. Die Tatsache, daßer dieses Wissen als Eingriff in seine Intimsphäre betrachtet, offenbart sein großes Verlangen nach absoluter Anonymität. Er kennt Mme Rocard so wenig, daßer bisher nicht einmal ihr Äußeres genauer begutachtet hat. In diesem ersten Gespräch bemerkt er plötzlich die „große Zartheit“ ihres Madengesichts (wie er es sonst betitelte). Er realisiert „etwas Weiches“ in ihr und vergleicht sie mit einem kleinen Vogel, der Angst hat. Seine Anonymität reicht also soweit, die Menschen in seiner Umgebung gar nicht wahrzunehmen. Nicht nur er will unbemerkt bleiben, er sieht auch den wahren Menschen, der sich hinter der Fassade des ersten Blicks verbirgt, nicht. Er ist gefangen von dem Bild, daßalle Menschen schlecht sind und verdrängt die wirkliche, vielleicht schöne Seite seines Gegenübers. Er will die Schönheit und Sanftheit der Menschen einfach nicht sehen. Er hat kein Vertrauen mehr zu den Menschen. Er bittet zwar Mme Rocard, die Taube und ihre Kleckse zu entfernen, verläßt das Haus allerdings mit der Annahme, daßsie es sowieso nicht tun wird. „Um nichts wird sie sich kümmern,...,um gar nichts“ (S.38). Er ist gefesselt von der Vorstellung, daßauf andere Menschen kein Verlaßsei.
Auch das Zusammentreffen mit Mme Topell in Kapitel 5 belegt die Anonymität Jonathans. Die Naivität zu glauben, daßeine Schneiderin, nur weil auf ihrem Reklameschild „Jeannine Topell - Änderungen und Reparaturen - sorgfältig und schnell“ (S.64) steht, einen Rißin einer Hose binnen einer knappen halben Stunde reparieren könne, geschweige denn wolle, zeugt nicht von reicher Erfahrung im Umgang mit Menschen.
Diese Menschenunkenntnis resultiert aber nicht nur aus Jonathans Vorliebe zur Anonymität, sondern auch aus seinem geistigen Chaos.
2.5 Der Wandel Jonathans zu mehr Kontaktbereitschaft
Für Jonathan gibt es nur zwei Wege aus seiner Konfliktsituation : Entweder begeht er den Suizid, da die Ereignisse dieses Tages sein Lebensziel (der Monotonie und Anonymität) zerstört haben, oder er ändert seine Lebenseinstellung endlich zu einer positiven Lebensbejahung.
Bisher hat er doch eigentlich gar nicht gelebt. Sein Dasein war für ihn nur durch diese absoluten Einschränkungen erträglich, auch wenn er diese bislang nie als Einschränkungen empfand. Bisher ist der Weg Jonathans zum Suizid vorgezeichnet. Seine ganzen Emotionen, wie ich sie in 2.2. und 2.3. beschrieben habe, lassen nur diese eine Möglichkeit als Folge auf die Ereignisse zu. Den Grundrißseines Hotelzimmers vergleicht er mit einem Sarg, was wohl eindeutig seine Absicht, sich umzubringen, zum Ausdruck bringt (S85). Der eigentliche Wandel beginnt erst in Kapitel 9. Zuvor beteuert er noch, daßer sich am folgenden Tag umbringen wird, doch diese Nacht verändert seine Einstellung zum Leben grundlegend. In der Nacht erwacht er in jenem Hotelzimmer. Die ungewohnte Umgebung macht ihn orientierungslos. Schließlich erkennt er weder, wo er ist, noch, wer er ist. Er sieht sich in seine Vergangenheit zurückgesetzt. Er bildet sich ein, er sei ein Kind in Kriegszeiten und im Keller des Hauses seiner Eltern gefangen. Die Unzufriedenheit mit seinem Leben äußert sich in der Annahme, daßer die Tatsache „ein ekelhafter alter Wachmann in Paris“ (S.91) zu sein nur geträumt habe. Diese Erkenntnis ist der erste Schritt zur Veränderung. Aus Angst allein und vergessen zu sein, sieht er ein, daßer ohne die anderen Menschen nicht leben kann (S.92). Diesen Satz möchte er am liebsten in die ganze Welt hinaus schreien, um die Stille zu übertönen. So großist die Angst „des greisen Kindes Jonathan Noel vor der Verlassenheit“ (S.92). Genau das ist er nämlich: Ein greises Kind. Körperlich ist er zwar gealtert, doch seelisch sind die Wunden aus seiner Kind- und Jugendzeit längst nicht verheilt. Sein ganzes Leben war nichts anderes als eine kindische Trotzreaktion auf die Ereignisse in der Vergangenheit. Durch die Erlebnisse an jenem Tage im August 1984 wird er erstmals mit einem Bündel eigentlich alltäglicher Problemen konfrontiert, die er nicht zu lösen vermag; er erkennt seine Hilflosigkeit. Jene Geschehnisse stoßen ihn darauf, über seine Vergangenheit und seinen heutigen Lebensstil nachzudenken. Doch jetzt wird alles anders. Im 10 Kapitel macht er sich auf den Heimweg. Diese Textpassage läßt Parallelen zu dem 7. Teil der Erzählung erkennen. In beiden Textstellen wird der Weg durch Paris beschrieben. Doch in Kapitel 7 wirkt dieser Weg trostlos, dargestellt durch die aneinanderreihende Aufzählung von Stellen, die Jonathan passiert. Er hat kein Ziel mehr, denn sein bisheriges Lebensziel ist an diesem Tag zerstört worden, sondern er läuft planlos durch die Gegend. Ganz anders wird der Weg in Passage 10 skizziert. Jonathan hat nun ein ganz anderes Bewußtsein für sich und seine Umwelt. Er nimmt seine Umgebung zum ersten Mal bewusst wahr und realisiert z.B. „das kühle graublaue Morgenlicht“ (S.93). In Kapitel 6 wollte er noch alles zerstören, jetzt sieht er die „fast rührende Unschuld“ (S.93), die alles umgibt. Nun war es ihm wirklich egal, was die Leute von ihm dachten. Wäre er nicht zu faul gewesen, hätte er die Schuhe ausgezogen, um barfußweiterzugehen (S.94). Wenigstens patschte er mitten in die Pfützen hinein. Er hat nun ein Ziel: sein zu Hause. Die Stimmung Jonathans strahlt nun eine ungeheurere Lebensfreude aus; eine „wiedergewonnene Freiheit“ (S.94) zu tun und lassen, was er will. Die Folgen seiner „ereignislosen Zeit“ lassen sich allerdings nicht von sofort beseitigen. Er hat immer noch Angst vor der Taube, als er den Hausflur betritt. Doch wieder wird ihm bewiesen, daßsein Mißtrauen in die Menschen übertrieben war: Die Taube ist weg. Der Schmutz weggewischt (S.96).
Die Erzählung ist eine Komplementärgeschichte, hat also ein offenes Ende. Dieses ist typisch für eine personale Erzählsituation. Der Leser denkt über den vom Autor gesetzten Schlußhinaus. Die weitere Entwicklung in Jonathans Leben ist allerdings offensichtlich. Er hat „anfangen“ zu leben. Er wird seine Tugenden, die ich in 2.2. geschildert habe, etwas lockerer sehen und versuchen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Dieser Wandel hat zwar in seinem Inneren mit der Auflösung des Verdrängungsprozesses begonnen, bis zum vollständigen neuen Jonathan ist es allerdings noch ein langer Weg.
3.Zusammenfassung
Jonathan Noel ist ein Mensch, der eine schwere Vergangenheit hatte. Aufgrund der hohen psychischen Belastung beschließt er, nie mehr den Kontakt zu anderen zu pflegen und allen Ereignissen aus dem Wege zu gehen. So lebt er dreißig Jahre in Paris dahin. Er vergeudet sein Leben. Er gönnt sich nichts Außergewöhnliches, ist total vereinsamt und stumpft durch diese stupide Lebensführung völlig ab. An dem Tag im August 1984, der Handlungszeit für die Erzählung ist, passieren ihm viele unvorhersehbaren Ereignisse. Seine Reaktionen sind die eines Kindes. Die geistige Blockade Jonathans ließein Sammeln von Erfahrungen nicht zu, so daßihn diese Geschehnisse unvorbereitet treffen. Er hat bisher eigentlich nur gelebt, um wieder zu sterben. Er reagiert überzogen, naiv und will schließlich nicht mehr leben. Diese Vorkommnisse lösen allerdings seine geistige Blockade, so daßer sich an vergangene Zeiten erinnert und endlich „JA“ zum Leben sagt.
Quellenverzeichnis
1. Patrick Süskind: „Die Taube“ Erscheinungsjahr: 1987
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema von Patrick Süskinds "Die Taube"?
Die Erzählung "Die Taube" von Patrick Süskind handelt von Jonathan Noel, einem Mann, dessen Leben durch eine Taube und die daraus resultierenden Ereignisse an einem einzigen Tag eine Wendung nimmt. Die Geschichte untersucht Themen wie Verdrängung, Monotonie, Anonymität und die Möglichkeit des Wandels.
Wie ist die Erzählung aufgebaut?
Die Erzählung ist in neun Abschnitte gegliedert, die verschiedene Tageszeiten an einem Freitag im August 1984 darstellen. Jeder Abschnitt konzentriert sich auf Jonathans Erlebnisse und Reaktionen.
Wer ist Jonathan Noel?
Jonathan Noel ist ein 53-jähriger französischer Jude, der als Wachmann bei einer Bank in Paris arbeitet. Er hat eine belastete Vergangenheit, die seinen Lebensstil der Anonymität und Monotonie geprägt hat.
Was ist die "belastete Vergangenheit" von Jonathan Noel?
Jonathans Eltern wurden 1942 in ein Konzentrationslager deportiert. Er wuchs bei seinem Onkel auf und erlebte harte Feldarbeit und Kriegsdienst in Indochina. Nach seiner Heirat und der Trennung von seiner Frau beschloss er, sich von anderen Menschen fernzuhalten.
Was symbolisiert die Taube in der Erzählung?
Die Taube symbolisiert das Chaos, die Unvorhersehbarkeit und das, was Jonathan in seinem Leben zu vermeiden sucht. Sie stellt einen Bruch mit seiner geordneten und anonymen Existenz dar.
Welche Rolle spielt die Pünktlichkeit im Leben von Jonathan?
Pünktlichkeit ist ein zentraler Wert für Jonathan. Sie gibt ihm ein Gefühl von Kontrolle und Stabilität in seinem Leben. Das Nichteinhalten seines Zeitplans aufgrund der Taube löst bei ihm großen Stress aus.
Wie sparsam ist Jonathan Noel?
Jonathan ist sehr sparsam und lebt bescheiden. Er vermeidet unnötige Ausgaben und plant seine Finanzen sorgfältig, um seine Reserven zu erhalten.
Was bedeutet Ordnung für Jonathan?
Ordnung ist für Jonathan wichtig, um Unvorhergesehenes zu vermeiden. Er ist darauf bedacht, alles an seinem Platz zu haben und seinen Tagesablauf strukturiert zu gestalten.
Wie wichtig ist Pflichterfüllung für Jonathan Noel?
Pflichterfüllung hat für Jonathan oberste Priorität. Er nimmt seine Arbeit sehr ernst und ist bestrebt, seine Pflichten stets zu erfüllen. Seine Versäumnisse an dem besagten Tag belasten ihn stark.
Warum ist Jonathan sein Ansehen so wichtig?
Jonathans Wunsch nach Ansehen rührt von seiner Vergangenheit her, insbesondere von seiner Scheidung, die ihn zum Gespött der Leute machte. Er versucht, unauffällig zu bleiben, um erneute Scham zu vermeiden.
Wie entwickelt sich der Verdrängungsprozess von Jonathan im Laufe der Erzählung?
Jonathan lebt ein Leben der Verdrängung, um seine traumatischen Erfahrungen zu bewältigen. Die Ereignisse des Tages zwingen ihn jedoch, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen und langsam seine Lebensweise zu hinterfragen.
Wie gestaltet sich das Verhältnis von Jonathan zu anderen Menschen?
Jonathan vermeidet den Kontakt zu anderen Menschen und strebt nach Anonymität. Er hat kaum Beziehungen und nimmt seine Mitmenschen kaum wahr. Seine Begegnungen mit Mme Rocard und Mme Topell verdeutlichen seine Menschenscheu.
Wie wandelt sich Jonathan im Laufe der Erzählung?
Nach einer Nacht der Verzweiflung und Selbstreflexion erkennt Jonathan, dass er ohne andere Menschen nicht leben kann. Er beginnt, seine Lebensweise zu überdenken und sich der Außenwelt wieder zu öffnen.
Was ist das Ende der Erzählung?
Die Erzählung hat ein offenes Ende. Jonathan kehrt zwar in seine Wohnung zurück und findet sie sauber vor, aber wie sich sein Leben langfristig entwickelt, bleibt offen. Der Leser kann jedoch hoffen, dass er seinen Weg zu einem erfüllteren Leben findet.
- Quote paper
- Sonja Walther (Author), 1999, Süskind, Patrick - Die Taube - Interpretation der Erzählung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106597