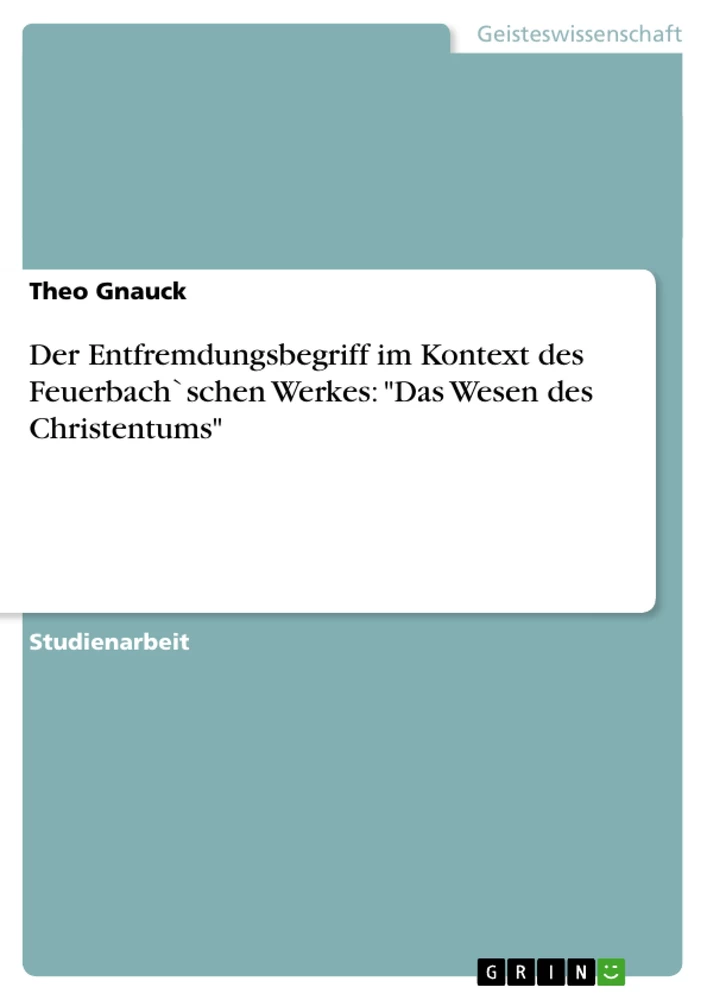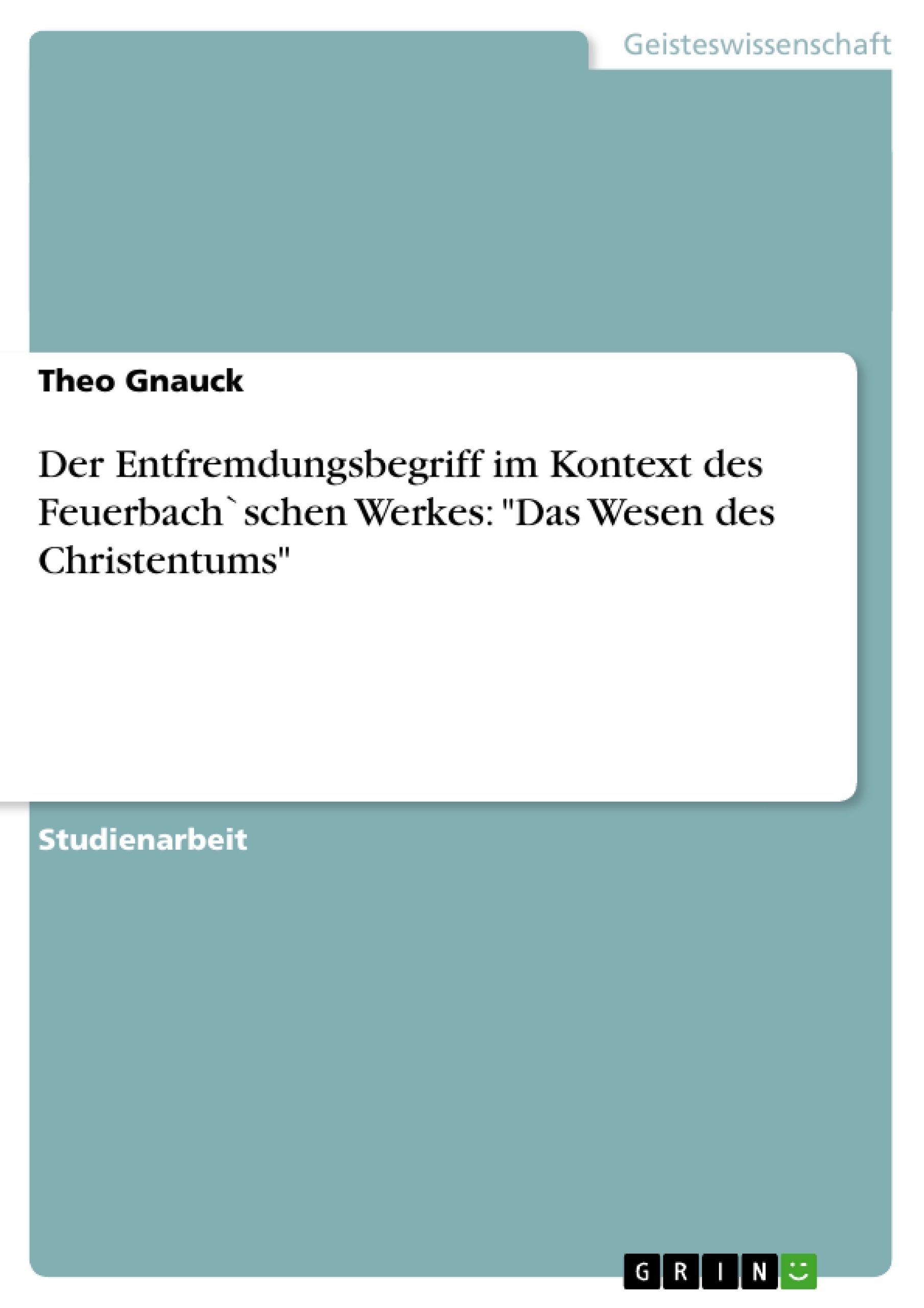Was wäre, wenn die tiefsten Geheimnisse des Glaubens in Wirklichkeit Spiegelbilder unserer Menschlichkeit wären? Tauchen Sie ein in eine provokative Analyse von Ludwig Feuerbachs "Das Wesen des Christentums", einem Werk, das die philosophischen Grundfesten des 19. Jahrhunderts erschütterte und bis heute nachhallt. Diese tiefgründige Auseinandersetzung dekonstruiert auf fesselnde Weise die etablierten religiösen Dogmen und enthüllt die verborgene Anthropologie hinter der Theologie. Entdecken Sie, wie Feuerbach den Begriff der Entfremdung seziert, um die wahre Essenz des menschlichen Wesens freizulegen, das in den komplexen Strukturen des Christentums gefangen ist. Von der Negation Gottes bis zur Verherrlichung der sinnlichen Erkenntnis – folgen Sie Feuerbachs revolutionärem Pfad, der die Liebe, die Moral und den Willen als ureigene menschliche Eigenschaften neu definiert. Untersuchen Sie die brisante Frage, ob die christliche Moral tatsächlich von göttlichem Ursprung ist oder vielmehr eine Projektion unserer eigenen idealisierten Werte darstellt. Diese kritische Analyse beleuchtet die Widersprüche und Dilemmata in Feuerbachs System und untersucht, wie seine persönlichen Konflikte seine philosophischen Schlussfolgerungen beeinflussten. Ergründen Sie die komplexen Beziehungen zwischen Religion, Atheismus und Humanismus, während Feuerbach den "religiösen Atheismus" als das wahre Wesen des Menschen postuliert. Erleben Sie, wie Feuerbach die christlichen Symbole und Rituale neu interpretiert, um eine tiefere Bedeutung für die menschliche Existenz zu finden. Diese Auseinandersetzung mit Feuerbachs Werk bietet nicht nur einen Einblick in die Religionskritik des 19. Jahrhunderts, sondern wirft auch grundlegende Fragen nach unserer eigenen Spiritualität, Moral und dem Sinn des Lebens auf. Wagen Sie es, die Konventionen zu hinterfragen und die verborgenen Wahrheiten zu entdecken, die in den Tiefen des Glaubens verborgen liegen. Enthüllen Sie mit Feuerbach die anthropologischen Wurzeln religiöser Überzeugungen, die Essenz der menschlichen Liebe und Moral, die sich in den Spiegelbildern der christlichen Lehren manifestieren, und die tiefgreifenden Auswirkungen des Sensualismus auf unser Verständnis der Welt. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der die Grenzen zwischen Glauben und Vernunft verschwimmen und die wahre Natur des Menschen enthüllt wird. Lassen Sie sich von Feuerbachs leidenschaftlicher Suche nach Wahrheit inspirieren und entdecken Sie neue Perspektiven auf die menschliche Existenz.
Gliederung
I "Ich negiere Gott"[3]
Die Negation Gottes aus der Position der Religion
II "Religion ist wesentlich dramatisch."[4]
Der historische Entfremdungsbegriff im "Wesen des Christentums"
III "Schein ist das Wesen der Zeit"[5]
Die christliche Moral zur Zeit Feuerbachs
IV "Ich aber..."[6]
Der Widerspruch, der im System bleibt
V "Die heilige Wassertaufe"[7]
Das religiöse Pathos
VI "Genie ist unmittelbares, sinnliches Wissen."[8]
Feuerbachs Sensualismus
Thema: Der Entfremdungsbegriff im Kontext des
Feuerbachschen Werkes:
"Das Wesen des Christentums"[1]
"Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen."[2] ("Die Bibel", Matthäus 5.17)[3]
"Ich negiere Gott"
Die Negation Gottes aus der Position der Religion
"'Ich negiere Gott, das heißt bei mir: Ich negiere die Negation des Menschen, ich setze an die Stelle der illusorischen, phantastischen, himmlischen Position des Menschen, welche im wirklichen Leben notwendig zur Negation des Menschen wird, die sinnliche, wirkliche, folglich notwendig auch politische und soziale Position des Menschen. Die Frage nach dem Sein oder Nichtein Gottes ist eben bei mir nur die Frage nach dem Sein oder Nichtsein des Menschen.'"[3] Ob und in welcher Weise Ludwig
Feuerbach tatsächlich "die Negation des Menschen" - zumindest theoretisch - negiert, und ob er das etablierte System der Entfremdung wirklich aufhebt, soll in dieser Arbeit näher untersucht werden. Im Wesentlichen beschränke ich mich dabei auf das Hauptwerk Ludwig Feuerbachs, "Das Wesen des Christentums". Ich folge dabei dem Text der dritten Auflage von 1849. Die erste Auflage des Buches erschien 1841 in Leipzig.
Den oben angedeuteten Bedenken gegenüber der Strategie Feuerbachs, die Negation Gottes würde aus der illusorischen eine wirkliche Position des Menschen schaffen, diesen Bedenken also folgend, verwende ich nun ein Zitat aus der Feuerbach-Biographie Georg Biedermanns, das zusammenfassend die im "Wesen des Christentums" angelegte Absicht, als auch das eigentlich zwangsläufig in der Umsetzung dieser Absicht entstandene Dilemma beschreibt: "Der 'Grundgedanke' dieses bedeutenden Buches...ist 'ungefähr dieser: Das selbst objektive Wesen der Religion, insbesondere der christlichen, ist nichts anderes als das Wesen des menschlichen, insbesondere christlichen Gemüts, das Geheimnis der Theologie daher die Anthropologie.'(Feuerbach an Wigand, seinen Verleger) Diese wie ein roter Faden sich durch das gesamte Werk hindurchziehende These hat der Philosoph in zwei großen Abschnitten entwickelt: einmal unter dem Gesichtspunkt der Übereinstimmung der Religion mit dem Wesen des Menschen; zum anderen im Hinblick auf den
Widerspruch dieser beiden Kategorien. In Rücksicht dieser doppelläufigen Tendenz, dieses inneren Gegensatzes zwischen Wahrheit und Illusion, die wir hier in einem Stück behandeln, war 'Das Wesen des Christentums' ebenso ein 'Pro als Contra', ein Für und Wider, eine Bejahung und Verneinung der Religion."[9] [4]
II "Religion ist wesentlich dramatisch."
Der historische Entfremdungsbegriff im "Wesen des Christentums"
Der Leitsatz dieses Kapitels soll sofort den Kern des Werkes Ludwig Feuerbachs, "Das Wesen des Christentums", als Problem hervorheben; dazu folgendes Zitat:
"An die Stelle Roms trat der Begriff der Menschheit, damit an die Stelle des Begriffs der Herrschaft der Begriff der Liebe."[10] ; der christliche Gott war also als vermittelnde Instanz zwischen die Menschen getreten und wurde nun als Person, Mythos und Mensch dramatisiert. Die dramatische Figur Gottes als Jesus, dem Menschensohn, ließ die moralischen Formeln des Christentums Fleisch und Blut werden. Ludwig Feuerbach wollte diesen Trick aufdecken. Er wollte zudem die "wahre Tugend"[11], die er der "bloßen Scheintugend"[12] des Christentums vorzog, den menschlichen Kern, der hinter der Theologie sich verbarg, ans Licht bringen. Und so tat er, was vor ihm schon so einige getan hatten: Dieses von jenem trennen und was übrig blieb, als das Wahre anzupreisen: "Die Liebe Christi war eine abgeleitete Liebe."[13], "...das Christentum (machte) selbst wieder eine allgemeine Einheit zu einer besonderen, die Liebe zur Sache des Glaubens, aber setzte sie eben dadurch in Widerspruch mit der allgemeinen Liebe. Die Einheit wurde nicht bis auf ihren Ursprung zurückgeführt."[14] - Daraus folgt: "Die Liebe zum Menschen darf keine abgeleitete sein; sie muß zur ursprünglichen werden. Dann allein wird die Liebe eine wahre, heilige, zuverlässige Macht."[15]
Die Problematik der Entfremdung springt einem geradezu ins Gesicht. Und wenigstens in doppelter Hinsicht: Einmal ist "an die Stelle des Begriffs der Herrschaft der Begriff der Liebe"[16] getreten. Zum anderen ist dieser "Begriff der Liebe" dann jedoch "zur Sache des Glaubens"[17] gemacht worden. Dadurch setzt er sich in Widerspruch zu einer "allgemeinen"[17], "ursprünglichen"15 Liebe.
Was bedeutet das?
Ludwig Feuerbach setzt eine ursprüngliche Liebe als den Menschen gegeben. Von dieser ursprünglichen Liebe hat sich die Menschheit entfernt. Feuerbach nennt dies "die bürgerlichen und politischen Trennungen des Menschen"[16]. Diese erste Form der Entfremdung wurde dann mit dem "Humanitätsprinzip der griechischen Bildung"[16] überwunden. Eine andere existierende Form der Entfremdung von der ursprünglichen Liebe war die Herrschaft Roms: "Das Reich der Politik, das die Menschheit auf eine ihrem Begriffe widersprechende Weise vereinte, mußte in sich zerfallen. Die politische Einheit ist eine gewaltsame.
Roms Despotismus mußte sich nach innen wenden, sich selbst zerstören."[16] Allerdings gelang es nun nicht, dieses Phänomen der Entfremdung zu beseitigen, ohne ein anderes Phänomen der Entfremdung hervorzurufen: Da die ursprüngliche Liebe nicht wie "anderwärts auf dem Wege der Bildung sich geltend machte," sondern "sich hier als religiöses Gemüt, als Glaubenssache" aussprach, konnte "die Einheit...nicht bis auf ihren Ursprung zurückgeführt"[14] werden. Somit ist nach Feuerbach das Christentum - als deren mißglückte Aufhebung - nur eine andere Form von Entfremdung.[5]
III "Schein ist das Wesen der Zeit"
Die christliche Moral zur Zeit Feuerbachs
Friedrich Engels beschreibt die damalige Situation folgendermaßen: "und als gar 1840 die orthodoxe Frömmelei und die feudal-absolutistische Reaktion mit Friedrich Wilhelm IV. den Thron bestiegen, wurde offne Parteinahme unvermeidlich."[18] Eine Steigerung der oben genannten Entfremdung bietet der zu Feuerbachs Zeiten von ihm denunzierte Umgang mit dem Christentum: "Schein ist das Wesen der Zeit - Schein unsre Politik, Schein unsre Sittlichkeit, Schein unsre Religion, Schein unsre Wissenschaft. Wer jetzt die Wahrheit sagt, der ist impertinent, 'ungesittet', wer 'ungesittet', unsittlich. Wahrheit ist unsrer Zeit Unsittlichkeit. Sittlich, ja autorisiert und honoriert ist die heuchlerische Verneinung des Christentums, welche sich den Schein der Bejahung desselben gibt; aber unsittlich und verrufen ist die wahrhaftige, die sittliche Verneinung des Christentums - die Verneinung, die sich als Verneinung ausspricht."[19]
Mit welchem Konzept begegnete Feuerbach diesem Dilemma?
Wie oben erwähnt, will Feuerbach etwas, was vor ihm schon viele gewollt haben: Erfüllung. Zu deren Inhalten später, zuerst zur Methode. Mit der Erfüllung will Feuerbach etwas retten. Wer etwas retten will, muß etwas opfern: "Wenn das Christentum nicht mehr, wenigstens in unsrer Zeit, blutige Opfer seinem Gott darbringt, so kommt das, abgesehen von andern Gründen, nur daher, daß das sinnliche Leben nicht mehr für das höchste Gut gilt. Man opfert dafür Gott die Seele, die Gesinnung, weil diese für höher gilt."[20] Will man dagegen die Gesinnung retten, muß man lediglich Gott der Gesinnung opfern, denn hinter den Prädikaten Gottes, stehen die tugendhaften Inhalte menschlichen Seins.
Wie funktioniert das genau?
Unter Erfüllung verstehe ich moralische Formeln, die durch das Christentum transportiert werden: die Liebe, die Ehe, das Eigentum. Genauer: Die in den christlichen Geboten fixierten Gesetze, die den Gläubigen ein bestimmtes Handeln vorschreiben, formuliert als Imperativ: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst." (Markus 12.31)[21], "Du sollst nicht ehebrechen;...Du sollst nicht stehlen;"(Markus 10.19)[22]. Feuerbach sieht, wie oben geschildert, diese Werte in Gefahr, den es wird nur noch der Schein gewahrt. Schuld daran ist grundsätzlich die Art und Weise der Vermittlung dieser moralischen Formeln: "Gott wird nicht nur geglaubt, vorgestellt als das gemeinsame Wesen, der Vater der Menschen, die Liebe - solcher Glaube ist Glaube der Liebe -, er wird auch vorgestellt als persönliches Wesen, als Wesen für sich. So gut sich daher Gott als ein Wesen für sich vom Wesen des Menschen absondert, so gut sondern sich auch die Pflichten gegen Gott ab von den Pflichten gegen den Menschen - sondert sich im Gemüte der Glaube von der Moral, der Liebe."[23] Damit meint Feuerbach folgendes: Die Menschen, die noch an Gott glauben, glauben um des Glaubens willen, tatsächlich aber haben sie keine Moral, sie erfüllen nicht die "Pflichten gegen den Menschen". Die Menschen aber, die ohnehin nur den Schein wahren, verschleppen die Wahrheit, die Feuerbach hinter der christlichen Moral sieht, als Dekor in ihr halbaufgeklärtes System wissenschaftlicher Spielarten, das gut ausgebildete Wächter hat: "Wahrheit ist aber in unsrer Zeit nicht nur Unsittlichkeit, Wahrheit ist auch Unwissenschaftlichkeit - Wahrheit ist die Grenze der Wissenschaft. Wo die Wissenschaft zur Wahrheit kommt, Wahrheit wird, da hört sie auf, Wissenschaft zu sein, da wird sie Objekt der Polizei - die Polizei ist die Grenze zwischen der Wahrheit und der Wissenschaft."[24] Hier - im Vorwort zur zweiten Auflage - beschreibt Feuerbach schon den ablehnenden Umgang mit seiner öffentlich dargestellten Methode im "Wesen des Christentums", die die Religion und ihren Gott opfert, um deren Moral "durch sich selbst (zu) begründen"[25]: "Wenn wir in Zeiten, wo die Religion heilig war, die Ehe, das Eigentum, die Staatsgesetze respektiert finden, so hat dies nicht in der Religion seinen Grund, sondern in dem ursprünglich, natürlich sittlichen und rechtlichen Bewußtsein, dem die rechtlichen und sittlichen Verhältnisse als solche für heilig gelten."[26] Leider liefert Feuerbach keine konkreten Beispiele, die diese Behauptung erfüllen. Im Gegenteil: Feuerbach persönlich schien damit Schwierigkeiten gehabt zu haben. (Dazu im Anschluß.) So formuliert er die hinter den Repräsentanten der Dreinigkeit stehenden Werte folgendermaßen: "Die göttliche
Dreieinigkeit im Menschen über dem individuellen Menschen ist die Einheit von Vernunft, Liebe, Wille."[27] Das bedeutet, heiliger Geist = Vernunft; Jesus = Liebe; Gott = Wille.[28] Diese Werte sieht er als eigentlich menschliche Inhalte, die "das Wesen des Menschen, dessen er sich bewußt ist"[27] im "Unterschied vom Tiere" ausmachen. Diese Werte sind aber eben in die Religion versetzt: "Das Wesen des Menschen imUnterschied vom Tiere ist nicht nur der Grund, sondern auch derGegenstand der Religion."[29] Nach Feuerbach stellen diese Werte ein Regulativ im Menschen dar, mit dem er sich ständig auseinandersetzen muss. Diesen Prozess beschreibt er wie folgt: "Und wenn du eine Leidenschaft unterdrückst, eine Gewohnheit ablegst, kurz einen Sieg über dich selbst erringst, ist diese siegreiche Kraft deine eigne persönliche Kraft, für sich selbst gedacht, oder nicht vielmehr die Willensenergie, die Macht der Sittlichkeit, welche sich gewaltsam deiner bemeistert und dich mit Indignation gegen dich selbst und deine individuellen Schwachheiten erfüllt?"[30] Die Aussage ist klar: Die Sittlichkeit oder Moral soll den nötigen Willen aufbauen, um die Leidenschaft zu unterdrücken. Es ist nicht allzu gewagt, der Trinitätserklärung Feuerbachs, eine weitere folgen zu lassen, denn die Erklärunglinie lässt sich relativ problemlos verlängern[30a]:heiliger Geist = Vernunft = Moral/Zensur = Über-Ich Jesus = Liebe = unbewußt/triebhaft = Es; Gott = Wille = Bewußtsein = Ich;
Diese Erklärungslinie kann nur als ein solches abstraktesVerständigungsmuster gesetzt werden. Es handelt sich dabei einfach um den Versuch, Feuerbachs Vorstellung von der Wirkungsweise theologisch dominierter Moral im einzelnen Menschen adäquat auszudrücken. Die antizipierende Nähe zur Psychologie, insbesondere die inhaltliche Analogie zum freudschen Erklärungsschema, ergibt sich bei Feuerbach aus dessen weitestgehender Reduzierung der Wirkung des Christentums auf das religiöse Gemüt: "unsere Aufgabe ist es ja eben, zu zeigen, daß die Theologie nichts ist als eine sich selbst verborgene, als die esoterische Patho-, Anthropo-und Psychologie, und daß daher diewirkliche Anthropologie, die wirkliche Pathologie, wirklichePsychologie weit mehr Anspruch auf den Namen: Theologie haben, als die Theologie selbst, weil diese doch nichts weiter ist, als die eingebildete Psychologie und Anhropologie."[30d] Im Übrigen bezeichnetauch Alfred Schmidt Feuerbach als einen "in manchem Freudvorwegnehmende(n) Psychologe(n)".[31] So ist es nicht verwunderlich, dass Freud selbst in seiner Schrift "Das Ich und das Es" die Religion als Beispiel heranzieht: "Das Urteil der eigenen Unzulänglichkeit imVergleich des Ichs mit seinem Ideal (Über-Ich) ergibt das demütigereligiöse Empfinden, auf das sich der sehnsüchtige Gläubige beruft. Im weiteren Verlauf der Entwicklung haben Lehrer und Autoritäten die Vaterrolle fortgeführt; deren Gebote und Verbote sind im Ideal-Ich mächtig geblieben und üben jetzt als Gewissen die moralische Zensur aus."[32]
Das Aufmachen des obigen Verständigungsmusters habe ich deshalb vollzogen, weil Feuerbach mit dem Anerkennen eines Regulativs, das im Menschen - diesem gegenüber stehend - angelegt sei, ja einen Zustand von Dauerentfremdung beschreibt, den er für wünschenswert hält. Wie oben angekündigt, hatte er aber wohl auch persönlich einen Konflikt mit seinem quasireligiösen Postulat: "Johanna (Tochter des mit Feuerbachbefreundeten Friedrich Kapp),...übte durch ihren Charme, ihrgeistvolles Wesen und ihr künstlerisches Talent - sie zeichnete und schrieb Gedichte - einen unwiderstehlichen Reiz auf ihre Umgebung aus. Schon 1841 hatte die noch sehr junge und leidenschaftliche Johanna eine tiefe Zuneigung zu dem um viele Jahre älteren Feuerbach gefaßt, die von diesem auch bald erwidert wurde. Mehr als ein halbes Jahrzehnt zogen sich die widerspruchsvollen, das Gewissen und die sittlichen Normen des Familienlebens in gleicher Weise belastenden Beziehungen hin, bis Feuerbach im Sommer 1846 mit seiner ganzen Kraft der Selbstüberwindung diesem unerträglich gewordenen Zustand ein Ende bereitete; in einer offenen Aussprache mit seiner Frau und danach mit Johanna und ihrer Mutter entschied er sich für seine Frau."[33] Offensichtlich wurde Feuerbach selbst also auch ein praktisches Opfer seines eigenen widersprüchlichen Handlungsmodells.[6]
IV"Ich aber..."
Der Widerspruch, der im System bleibt
"Die Spekulation läßt die Religion nur sagen, was sie selbst gedacht und weit besser gesagt, als die Religion; sie bestimmt die Religion, ohne sich von ihr bestimmen zu lassen; sie kommt nicht aus sich heraus. Ich aber aber lasse die Religion sich selbst aussprechen; ich mache nur ihren Zuhörer und Dolmetscher, nicht ihren Souffleur. Nicht zu erfinden- zu entdecken, 'Dasein zu enthüllen' war mein einziger Zweck; richtig zu sehen mein einziges Bestreben. Nicht ich, die Religion betet den Menschen an, obgleich sie oder die Theologie es leugnet; nicht meine Wenigkeit nur, die Religion selbst sagt: Gott ist Mensch, der Mensch Gott; nicht ich, die Religion selbst verneint den Gott, der nicht Mensch, sondern nur ein Ens rationis ist, indem sie Gott Mensch werden läßt und nun erst diesen menschlich gestalteten, menschlich fühlenden und gesinnten Gott zum Gegenstande ihrer Anbetung und Verehrung macht. Ich habe nur das Geheimnis der christlichen Religion verraten, nur entrissen dem widerspruchsvollen Lug- und Truggewebe der Theologie - dadurch aber freilich ein wahres Sakrileg begangen. Wenn daher meine Schrift negativ, irreligiös, atheistisch ist, so bedenke man, daß der Atheismus - im Sinne dieser Schrift wenigstens - das Geheimnis der Religion selbst ist, daß die Religion selbst zwar nicht auf der Oberfläche, aber im Grunde, zwar nicht in ihrer Meinung und Einbildung, aber in ihrem Herzen, ihrem wahren Wesen an nichts andres glaubt, als an die Wahrheit und Gottheit des menschlichen Wesens."[6]
Deutlicher läßt sich nicht zeigen, wie tief Feuerbach mit den Inhalten der christlichen Religion sich identifiziert. Was ihn stört, ist lediglich die Vermittlungskultur des Christentums mit einem imaginären Gott als Medium im Zentrum. Dafür jedoch stellt er selbst den Atheismusbegriff in den Dienst dieser Moral. Dafür benutzt er das "ich aber", das Jesus in der Bergpredigt als stärksten abgrenzenden Ausdruck gegen Gott verwendet, ebenfalls als Abgrenzung gegen die Philosophen der "Spekulation", die nicht den Menschen im Mittelpukt ihrerPhilosophie sehen, sondern: die Substanz - Spinoza; das Ich - Kant,Fichte; die absolute Identität - Schelling; den absoluten Geist -Hegel. Dafür setzt er sich in eine Linie mit dem Reformer Martin Luther, den er oft und gerne zitiert, besonders in Gleichsetzungen von Gott und Mensch: "Gott ist allmächtig; der aber glaubt, der ist ein Gott."[34] Feuerbach entthront Gott mit den Methoden des Christentums, und so bleibt er in dessen System. Er will nur beweisen, dass Gott eine Vorstellung ohne Realität ist, dass aber die dahinter stehende Moral den Charakter der Wahrhaftigkeit trägt. Dazu benutzt er unter anderemfolgenden Trick: Er konstruiert zwei Atheismusbegriffe, einenreligiösen und einen wahren. Der "religiöse Atheismus"[35] repräsentiert dabei nach Feuerbach das "wahre Wesen"[36] des Menschen. Das erscheint zunächst merkwürdig. Man muß sich aber immer vor Augen halten: Für Feuerbach ist "das Geheimnis der Theologie...die Anthropologie"[37] Dagegen setzt er den wahren Atheismus, dem er durch dessen Verneinung der Theologie indirekt die Verneinung der Menschlichkeit unterstellt. Wie geschieht das genau?
Den "religiösen Atheismus" stellt Feuerbach vor am Beispiel des Gefühls: "Gebunden an äußere Rücksichten, unfähig, die Seelengröße des Gefühls zu begreifen, erschrickst du vor dem religiösen Atheismus deines Herzens und zerstörst in diesem Schrecken die Einheit deines Gefühls mit sich selbst, indem du dir ein vom Gefühl unterschiednes, gegenständliches Wesen vorspiegelst, und dich so notwendig wieder zurückwirfst in die alten Fragen und Zweifel: ob ein Gott ist oder nicht ist?"[35] Er meint also mit "religiösem Atheismus" das eigentlich menschliche Gefühl, das dadurch, dass es in den Dienst des Glaubensgestellt wird, die "Einheit...mit sich selbst" verliert. Einklassischer Fall von Entfremdung. Der wahre Atheismus dagegen hat keine Inhalte: "Ein wahrer Atheist, d.h. ein Atheist im gewöhnlichen Sinne, ist daher auch nur der, welchem die Prädikate des göttlichen Wesens, wie z.B. die Liebe, die Weisheit, die Gerechtigkeit Nichts sind, aber nicht der, welchem nur das Subjekt dieser Prädikate Nichts ist."[38] Feuerbach will kein Atheist sein. Und er nutzt geschickt die atheistische Kategorie, um deren naturgemäßem Vakuum hehre Begriffe menschlicher Idealisierungen gegüberzustellen. Damit klagt er diewahren Atheisten an und versucht zugleich, sich den Vertreternchristlicher Moral anheischig zu machen, bzw. diese in seine Form des religiösen Atheismus einzubinden. Klug setzt er dabei in diesem Fall abstrakte Werte, die einerseits christlich konnotiert sind und andererseits kulturgeschichtliche Grundwerte allgemeinen Charakters darstellen, in eins, denn Werte wie "Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit" sind immer kulturell codiert, abhängig von der Gesellschaft, die diese Begriffe konstituiert hat. Dieses Ineinssetzen ist überhaupt die Zauberformel Feuerbachs: Mit der scheinbaren Befreiung des Menschen von Gott, soll der Mensch zu seinen Urwerten zurückgeführt werden. Dieselässt Feuerbach allerdings in ihren christlichen Konnotationenunangetastet. Er setzt den Beiwert als Grundwert. Den wirklichen Grundwert, das Denotat[39], entdeckt Feuerbach nicht. Er vollzieht lediglich eine Läuterung im System. Er bleibt ein Christ.
V" Die heilige Wassertaufe"
Das religiöse Pathos
"Doch an solche grundeitle, lustsüchtige Subjekte wendet sich auch nicht der pneumatische Wasserheilkünstler. Nur wer den schlichten Geist der Wahrheit höher schätzt als den gleisnerischen Schöngeist der Lüge, nur wer die Wahrheit schön, die Lüge aber häßlich findet, nur der ist würdig und fähig, die heilige Wassertaufe zu empfangen."[40] Was für eine schöne Predigt! Abgesehen davon, dass Feuerbach hier - in seinem Vorwort zur ersten Auflage des "Wesen des Christentums" - das biblischeGebot: "du sollst nicht falsch Zeugnis reden"22(Markus 10.19)referiert, benutzt er als Untermalung seiner Schrift ein Sinnbild, die "Wassertaufe". Und nur wer "den schlichten Geist der Wahrheit" schätzt, also wer "Das Wesen des Christentums" durch und mit Feuerbach erkennt,ist eben dieser "heiligen Wassertaufe" würdig. Was er aberrückübertragend aus dem Ritual der Taufe als abstraktem Bild inwertausweisender Intention für seine Schrift benutzt, wird an andererStelle - bezogen auf das christliche Ritual der Taufe - von Feuerbach kritisiert: "Das Wasser ist die reinste, klarste sichtbare Flüssigkeit: vermöge dieser seiner Naturbeschaffenheit das Bild vom fleckenlosen Wesen des göttlichen Geistes. Kurz, das Wasser hat zugleich für sich selbst, als Wasser, Bedeutung; es wird ob seiner natürlichen Qualität geheiligt, zum Organ oder Mittel des heiligen Geistes erkoren. Insofern liegt der Taufe ein schöner, tiefer Natursinn zugrunde. Indes dieser schöne Sinn geht sogleich wieder verloren, indem das Wasser eine über sein Wesen hinausgehende Wirkung hat - eine Wirkung, die es nur durch übernatürliche Kraft des heiligen Geistes, nicht durch sich selbst hat. Die natürliche Qualität wird insofern wieder gleichgültig: wer aus Wein Wasser macht, kann willkürlich mit jedem Stoff die Wirkungen des Taufwassers verbinden."[41] Wenn also Feuerbachs "schlichter Geist der Wahrheit" für seine "heilige Wassertaufe" Voraussetzung ist, ist das für ihn etwas wesentlich anderes, als wenn die "Kraft des heiligen Geistes" die Erbsünde auswäscht. Dass Feuerbach, solange er die abstrakten Codes des Christentums benutzt, in dessen Entfremdungssystem integriert bleibt, sieht er dabei nicht. Und auch von anderen christlichen Sinnbildern will er sich nicht lösen. In seinem Anthropologie versus Theologie - Konzept scheut er nicht, die einfachste biblische Metapher anzuwenden: "Wollt ihr daher über diese Dinge ins reine kommen, so vertauscht eure mystische, verkehrteAnthropologie, die ihr Theologie nennt, mit der wirklichenAnthropologie...Warum wollt ihr denn nun nur die Splitter in den Augen eurer Gegner, nicht aber die doch so leicht wahrnehmbaren Balken in euren eigenen Augen bemerken,..."[42], oder: "Es ist nur der Egoismus, die Eitelkeit, die Selbstgefälligkeit der Christen, daß sie wohl selbst die Splitter in dem Glauben der nicht christlichen Völker, aber nicht die Balken in ihrem eignen Glauben erblicken."[43] Auch das aber ist Feuerbach noch nicht genug. Um die christlichen Prädikate zu Subjekten zu erheben, bemüht er auch schon mal den Teufel: "Kann ich den Menschen lieben, ohne ihn menschlich zu lieben, ohne ihn so zu lieben, wie er selbst liebt, wenn er in Wahrheit liebt? Wäre sonst nicht die Liebe vielleicht teuflische Liebe? Der Teufel liebt ja auch den Menschen,aber nicht um des Menschen, sondern um seinetwillen, also aus Egoismus,um sich zu vergrößern, seine Macht auszubreiten."[44] Nach dieser Drohung arbeitet Feuerbach nun - der Rhetorik eines Predigers folgend - auf die Erlösung hin: "Denn wenn es auch eine eigennützige Liebe unter den Menschen gibt, so ist doch die wahre menschliche Liebe, die allein dieses Namens würdige, diejenige, welche dem andern zuliebe das Eigne aufopfert. Wer ist also der Erlöser und Versöhner? Gott oder die Liebe? Die Liebe..."[45] Für den Fall, dass einige Leser immer noch nicht von der Darlegung Feuerbachs überzeugt sind, lässt dieser sogleich eine weitere Drohung folgen: "..., so sollen wir auch aus Liebe Gott aufgeben; denn opfern wir nicht Gott der Liebe auf, so opfern wir die Liebe Gott auf, und wir haben trotz des Prädikats der Liebe den Gott, das böse Wesen des religiösen Fanatismus."[45] Ist also das Übel der Entfremdung, nämlich Gott, erst einmal den Prädikaten zuliebe geopfert, ist die Menschheit erlöst. Auch hier zeigt sich deutlich, dassFeuerbach eine christliche Moralformel anpreist, nämlich dieNächstenliebe. Wieder stellt er einen christlich konnotierten Wert nur scheinbar aus dessen Wirksystem heraus, indem er meint, das dieser erst außerhalb der religiösen Praxis des Christenums zum tragen kommen würde. Dass er aber mit der Etablierung christlicher Moralformeln als Subjekte quasi ein identisches System auf dem alten christlichen abbildet - eben nur ohne Gott als Mittler - und ja sowieso dessen Rhetorik noch benutzt, dass er somit in dem alten System bleibt, stört ihn dabei offenbar nicht.[8]
VI"Genie ist unmittelbares, sinnliches Wissen."
Feuerbachs Sensualismus
"Was der Mensch als Wahres, stellt er unmittelbar als Wirkliches vor, weil ihm ursprünglich nur wahr ist, was wirklich ist - wahr im Gegensatz zum nur Vorgestellten, Erträumten, Eingebildeten. Der Begriffdes Seins, der Existenz ist der erste, ursprüngliche Begriff derWahrheit. Oder: ursprünglich macht der Mensch die Wahrheit von der Existenz, später erst die Existenz von der Wahrheit abhängig."[46] Dies ist ein Zitat aus dem "Wesen des Christentums". Die Aussage ist klar und hat den Zweck, eine urspüngliche Sichtweise gegenüber einere späteren entfremdeten, nämlich religiösen, aufzuzeigen. Von dieser Auffassung trennt sich Feuerbach in seiner Schrift "Grundsätze der Philosophie der Zukunft"(1843)! Um sich konsequenter von der Religionsphilosophie abgrenzen zu können, setzt er von nun an einen Zustand der Entfremdung immer schon voraus: "Das Sinnliche ist nicht das Unmittelbare in dem Sinne, daß es das Profane, das auf platter Hand liegende, das Gedankenlose, das sich selbst verstehende sei. Die unmittelbare sinnliche Anschauung ist vielmehr später als die Vorstellung und Phantasie. Die erste Anschauung des Menschen ist selber nur die Anschauung der Vorstellung und Phantasie...Erst in der neueren Zeit ist die Menschheit wieder, wie einst in Griechenland nach Vorausgang der orientalischen Traumwelt, zur sinnlichen, d.i. unverfälschten, objektiven, Anschauung des Sinnlichen, d.i. Wirklichen, aber eben damit zu sich selbst gekommen;..."[47] Karl Marx kommentiert dieses Manöver in der "Deutschen Ideologie" folgendermaßen: Er - Feuerbach - muß "zu einer doppelten Anschauung seine Zuflucht nehmen zwischen einer profanen, die nur das 'auf platter Hand liegende' und einer höheren philosophischen, die das 'wahre Wesen' der Dinge erschaut. Er sieht nicht, wie die ihn umgebende sinnliche Welt nicht ein unmittelbar von ewig her gegebenes, sich stets gleiches Ding ist, sondern das Produkt der Industrie und des Gesellschaftszustandes, und zwar in dem Sinne, daß sie in jeder geschichtlichen Epoche das Resultat, Produkt der Tätigkeit einer ganzen Reihe von Generationen ist, deren jede auf den Schultern der vorhergehenden stand, ihre Industrie und ihren Verkehr weiter ausbildete, ihre soziale Ordnung nach den veränderten Bedürnissen modifizierte."[48] Der Vorwurf Marx' an Feuerbach, dass das "'religiöse Gemüt' selbst ein gesellschaftliches Produkt ist"[49], ist schon in den "Thesen über Feuerbach" enthalten. Im sich bedienen von irrationalen Begriffen entgleiten Feuerbach allmählich die Axiome der Systematisierung ("Überall spricht er von allem.")[50]. So war im "Wesen des Christentums" noch das Gefühlsurteil dem Verstandesurteil entgegengesetzt: "Der moralische Richter, welcher nicht menschliches Blut in sein Urteil einfließen lässt, verurteilt unnachsichtlich, unerbittlich den Sünder...Nicht abstrakte, nein! nur sinnliche Wesen sind barmherzig."[51] In den "Grundsätzen der Philosophie der Zukunft" ist dann jedoch mittlerweile "die Liebe der wahre ontologische Beweis vom Dasein eines Gegenstandes außer unserm Kopfe - und es gibt keinen andern Beweis vom Sein als die Liebe, die Empfindung überhaupt."[52], oder: "Wo keine Liebe, ist auch keine Wahrheit."[53] Karl Löwith bezeichnet "Feuerbachs 'Liebe' (als) eine sentimentale Phrase ohne jede Bestimmtheit"[54]. Immerhin hat aber Feuerbachs leidenschaftliches Wesen doch einen poetischen Satz hervorgebracht, der, in dem Versuch "Das wahre, d.i. das anthropologische Wesen der Religion" aufzudecken, das Tierreich auf rührende Weise bemüht: "Nur die Liebe macht die Nachtigall zur Sängerin."51
Literaturliste:
"Die Bibel" Stuttgart, 1939
Biedermann, Georg "Ludwig Andreas Feuerbach", Köln, 1986
Eco, Umberto "Einführung in die Semiotik", München, 1972
Feuerbach, Ludwig "Das Wesen des Christentums" Stuttgart, 1998
Feuerbach, Ludwig "Kleinere Schriften II" Berlin, 1982
Sigmund, Freud "Gesammelte Werke", Band XIII Frankfurt/Main 1967
Engels, Friedrich "Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie" Berlin, 1989
Fischer-Lichte, Erika "Semiotik des Theaters" Tübingen, 1983
Löwith, Karl "Von Hegel zu Nietzsche", Hamburg 1978, Seite 94 Marx, Karl "Die Frühschriften" Stuttgart 1953, Seite 351
Schmidt, Alfred "Emanzipatorische Sinnlichkeit" München, 1973
[...]
[1] Feuerbach, Ludwig "Das Wesen des Christentums" Stuttgart, 1998
[2] "Die Bibel", "Das Neue Testament", Stuttgart, 1939, Seite 7
[3] Schmidt, Alfred "Emanzipatorische Sinnlichkeit" München, 1973, Seite 7f.
[4] Feuerbach, Ludwig "Das Wesen des Christentums" Stuttgart, 1998, Seite 8
[5] ebenda Seite 14
[6] ebenda Seite 21f.
[7] ebenda Seite 12
[8] Feuerbach, Ludwig "Kleinere Schriften II" Berlin, 1982, Seite 322
[9] Biedermann, Georg "Ludwig Andreas Feuerbach", Köln, 1986, Seite 76
[10] Feuerbach, Ludwig "Das Wesen des Christentums" Stuttgart, 1998, Seite 396
[11] ebenda Seite 391
[12] ebenda Seite 391
[13] ebenda Seite 395
[14] ebenda Seite 397
[15] ebenda Seite 401
[16] ebenda Seite 396
[17] ebenda Seite 397
[18] "Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie", Friedrich Engels, Berlin 1989, Seite 20
[19] Feuerbach, Ludwig "Das Wesen des Christentums" Stuttgart, 1998, Seite 14
[20] ebenda Seite 403
[21] "Die Bibel", "Das Neue Testament", Stuttgart, 1939, Seite 58
[22] ebenda Seite 55
[23] Feuerbach, Ludwig "Das Wesen des Christentums" Stuttgart, 1998, seite 386
[24] ebenda Seite 15
[25] ebenda Seite 405
[26] ebenda Seite 404
[27] ebenda Seite 39
[28] Dreieinigkeit: Nur einmal - zumindest im "Wesen des Christentums" - weicht er von dieser Begrifflichkeit ab, als er die Beziehungen der Repräsentanten untereinander erklärt, da wird dann der heilige Geist zur "Liebe der beiden göttlichen Personen zueinander"28a, repräsentiert also dieser die Liebe zwischen Gott und Jesus.
[28a] Feuerbach, Ludwig "Das Wesen des Christentums" Stuttgart, 1998, Seite 126
[29] ebenda Seite 38
[30] ebenda Seite 40
[30a] Weiterhin zur Dreieinigkeit:[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
x "Die göttliche Dreieinigkeit im Menschen über dem individuellen Menschen ist die Einheit von Vernunft, Liebe, Wille."27
y "Glaube, Liebe, Hoffnung sind die christliche Dreieinigkeit. Die Hoffnung bezieht sich auf die Erfüllung der Verheißungen - der Wünsche, die noch nicht erfüllt sind, aber erfüllt werden; die Liebe auf das Wesen, welches diese Verheißungen gibt und erfüllt, der Glaube auf die Verheißungen, welche bereits erfüllt, historische Tatsachen sind."30b
z "Das Sakrament des Glaubens ist die Taufe, das Sakrament der Liebe das Abendmahl."30c
[30b] Feuerbach, Ludwig "Das Wesen des Christentums" Stuttgart, 1998, Seite 207
[30c] ebenda Seite 354
[30d] ebenda Seite 154
[31] Schmidt, Alfred "Emanzipatorische Sinnlichkeit" München, 1973, Seite 8
[32] "Gesammelte Werke", Band XIII Sigmund Freud, Frankfurt/Main 1967, seite 265
[33] Biedermann, Georg "Ludwig Andreas Feuerbach", Köln, 1986, Seite 93
[34] Feuerbach, Ludwig "Das Wesen des Christentums" Stuttgart, 1998, Seite 206
[35] ebenda Seite 50
[36] ebenda Seite 51
[37] "Vorläufige Thesen zur Reformation der Philosophie" in "Kleinere Schriften II" Ludwig Feuerbach, Berlin 1982, Seite 243
[38] Feuerbach, Ludwig "Das Wesen des Christentums" Stuttgart, 1998, Seite 64
[39] Denotat: "Das Denotatum an sich ist als Position im semantischen System reines Paradigma. Um sich ins Syntagma einfügen zu können und um sinntragende Ausdrücke ermöglichen zu können, muß es konnotative Bestandteile haben." ("Einführung in die Semiotik", Umberto Eco, München 1972, Seite 111); "Innerhalb einer Kultur können wir davon ausgehen, daß den Zeichen dieser Kultur von allen Zeichenbenutzern eine Bedeutung attribuiert wird, die einen für alle gemeinsamen und verbindlichen, relativ stabilen Bedeutungsanteil enthält, das Denotat, und darüberhinaus mögliche zusätzliche Bedeutungsanteile, die Konnotationen, die sehr unterschiedlichen Gruppen gemeinsam sein können, wie z.B. dem gesamten Kulturbereich, einzelnen Klassen oder Schichten, einer bestimmten politischen, ideologischen, religiösen, weltanschaulichen oder anderen Gruppe, den verschiedenen Subkulturen, einzelnen Familien oder anderen Kleingruppen - ja sogar nur für ein einzelnes Individuum Gültigkeit besitzen können - und generell schneller und stärker Veränderungen unterliegen als die Denotate." ("Semiotik des Theaters", Erika Fischer-Lichte, Tübingen 1983, Seite 9)
[40] Feuerbach, Ludwig "Das Wesen des Christentums" Stuttgart, 1998, Seite 12
[41] ebenda Seite 355
[42] ebenda Seite 178
[43] ebenda Seite 376
[44] ebenda Seite 106f.
[45] ebenda Seite 107
[46] ebenda Seite 62
[47] Feuerbach, Ludwig "Kleinere Schriften II" Berlin, 1982, Seite 325f.
[48] "Die Frühschriften" Karl Marx, Stuttgart 1953, Seite 351
[49] "Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie", Friedrich Engels, Berlin 1989, Seite 72
[50] Schmidt, Alfred "Emanzipatorische Sinnlichkeit" München, 1973, Seite 73
[51] Feuerbach, Ludwig "Das Wesen des Christentums" Stuttgart, 1998, Seite 100
[52] Feuerbach, Ludwig "Kleinere Schriften II" Berlin, 1982, Seite 318
[53] ebenda 319
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus der Analyse von "Das Wesen des Christentums" von Ludwig Feuerbach?
Die Analyse konzentriert sich auf den Begriff der Entfremdung im Kontext von Feuerbachs Werk "Das Wesen des Christentums" und untersucht, wie Feuerbach die Negation Gottes aus der Position der Religion betrachtet.
Wie beschreibt Feuerbach die Negation Gottes?
Feuerbach sieht die Negation Gottes als die Negation der Negation des Menschen, wobei er an die Stelle der illusorischen, himmlischen Position des Menschen eine sinnliche, wirkliche, politische und soziale Position setzt.
Was ist die zentrale These in Feuerbachs "Das Wesen des Christentums"?
Die These ist, dass das selbst objektive Wesen der Religion, insbesondere der christlichen, nichts anderes ist als das Wesen des menschlichen Gemüts, und somit das Geheimnis der Theologie die Anthropologie ist.
Wie sieht Feuerbach die Rolle der Liebe im Christentum?
Feuerbach kritisiert, dass die Liebe im Christentum von einer ursprünglichen, allgemeinen Liebe entfremdet und zur Sache des Glaubens gemacht wurde.
Was versteht Feuerbach unter "ursprünglicher Liebe"?
Feuerbach sieht eine ursprüngliche Liebe als dem Menschen gegeben, von der sich die Menschheit durch bürgerliche und politische Trennungen entfremdet hat.
Wie bewertet Feuerbach die christliche Moral seiner Zeit?
Feuerbach kritisiert die heuchlerische Verneinung des Christentums, die den Schein der Bejahung desselben gibt, und betont die Notwendigkeit einer wahrhaftigen, sittlichen Verneinung des Christentums.
Welche Methode verwendet Feuerbach, um die christliche Moral zu retten?
Feuerbach will die moralischen Formeln, die durch das Christentum transportiert werden, retten, indem er Gott der Gesinnung opfert, da hinter den Prädikaten Gottes die tugendhaften Inhalte menschlichen Seins stehen.
Wie stellt Feuerbach die Dreieinigkeit im Menschen dar?
Feuerbach sieht die göttliche Dreieinigkeit im Menschen als die Einheit von Vernunft, Liebe und Wille.
Welche Rolle spielt der Atheismus in Feuerbachs Philosophie?
Feuerbach unterscheidet zwischen einem religiösen und einem wahren Atheismus. Der religiöse Atheismus repräsentiert das wahre Wesen des Menschen, während der wahre Atheismus die Verneinung der Menschlichkeit unterstellt.
Was kritisiert Feuerbach an den christlichen Ritualen wie der Taufe?
Feuerbach kritisiert, dass das Wasser in der Taufe eine über sein Wesen hinausgehende Wirkung hat, die es nur durch übernatürliche Kraft des heiligen Geistes hat, was den natürlichen Sinn des Wassers wieder verloren gehen lässt.
Wie hat Feuerbach seine sinnliche Einstellung verändert?
Im Wesen des Christentums setzte Feuerbach eine ursprüngliche Sichtweise gegenüber einer späteren entfremdeten Sichtweise auf die Welt. Später, ab 1843, setzte er einen Zustand der Entfremdung immer schon voraus.
Was wirft Karl Marx Feuerbach vor?
Marx wirft Feuerbach vor, dass er die sinnliche Welt nicht als ein Produkt der Industrie und des Gesellschaftszustandes sieht, und dass er die Axiome der Systematisierung entgleiten lässt.
- Quote paper
- Theo Gnauck (Author), 1999, Der Entfremdungsbegriff im Kontext des Feuerbach`schen Werkes: "Das Wesen des Christentums", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106573